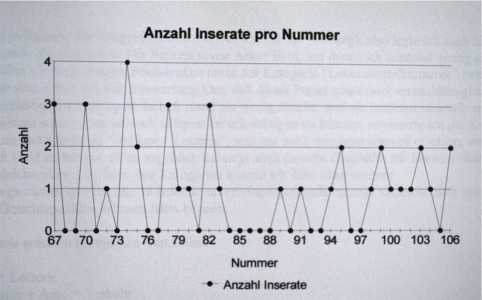
P.R.-Konzept
des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF)
DIPLOMARBEIT
zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie
an der Human- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Wien
eingereicht von
Mag. Patrick Horvath
Wien, Jänner 2002
“WAHRHEIT DES GANZEN”
Leo Gabriel (1902-1987), dem Gründer des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF), zum 100.Geburtstag
Inhaltsverzeichnis
Titelblatt (S.1)
Widmung (S.2)
Inhaltsverzeichnis (S.3)
Vorwort und Danksagungen (S.8)
EINLEITUNG (S.10)
Was ist Public Relations? (S.11)
Erstellung eines P.R.-Konzeptes (S.17)
Forschungsfrage, Thema (S.17)
Was ist ein P.R.-Konzept? Wozu braucht man eines? (S.18)
Wie erstellt man ein P.R.-Konzept? (S.18)
Über die tiefe Sinnlosigkeit eines Gefälligkeitsgutachtens (S.21)
SCHRITT 1: BESTANDSAUFNAHME (S.24)
I.) Situationsanalyse (S.24)
1. Der Gründer: Leo Gabriel (S.24)
1.1. Zur Wichtigkeit einer Rückbesinnung (S.24)
1.2. Die schwere Kindheit eines Philosophen (S.24)
1.3. Studium in Innsbruck (S.25)
1.4. Fortsetzung der Ausbildung: Wiener Jahre (S.26)
1.5. Gegen Nazis und Weltkrieg (S.30)
1.6. Universitätslaufbahn nach 1945 (S.31)
1.7. Die “Wahrheit des Ganzen” (S.32)
1.8. Philosophische Einflüsse auf Leo Gabriel, insbesonders die des russischen Mystikers Wladimir Solowjew (S.37)
1.9. Was bleibt? Zur Wirkungsgeschichte Leo Gabriels (S.39)
1.10. Wider das Vergessen (S.40)
2. Geschichte des UZF von der Gründung bis zur Gegenwart (S.41)
2.1. Vorgeschichte: Das Institut für Friedensforschung an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien (S.41)
2.2. Die Gründung des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) im Jahre 1973 (S.42)
2.3. Die Auflösung des Instituts für Friedensforschung (S.43)
2.4. Der Friedensdialog zwischen Christen und Marxisten (S.45)
2.5. 1995 - Das Jahr der Katastrophe (S.49)
2.6. Die Entwicklung bis zur Gegenwart (S.54)
3. Organisationsstruktur des UZF (S.57)
4. Finanzierung des UZF (S.62)
5. Gegenwärtige Forschungsfelder des UZF (S.63)
5.1. Aktuelle Themen (S.65)
LANDMINEN (S.65)
KRISENHERD BALKAN (S.66)
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN (v.a. OSZE) (S.67)
MINDERHEITENKONFLIKTE (S.69)
FRIEDENSDIALOG DER WELTRELGIONEN (S.71)
Allgemeines (S.71)
Die Weltkulturen (S.73)
Was macht eine Kultur aus? (S.74)
Der “Kampf der Kulturen” (S.74)
Der Westen und seine Herausforderer (S.75)
Friedensstifter Huntington (S.81)
Die Situation im “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) (S.83)
5.2. Prinzipielles (S.87)
FRIEDENSTHEORIE (S.87)
GESCHICHTE DER FRIEDENSBEWEGUNG (S.88)
FRIEDEN UND GERECHTIGKEIT (S.88)
6. Stärken des UZF (S.88)
II.) Problemanalyse (S.90)
1. Strukturelle Defizite (S.90)
2. Steigerungsfähige Mitgliedszahl (S.92)
3. Geringe budgetäre Ausstattung (S.93)
4. Geringer Bekanntheitsgrad (S.93)
5. Widersprüchliche Zielsetzung; Problem Anti-EU-Engagement (S.93)
6. Prüfung des Images unter Mitarbeitern am Institut für Philosophie notwendig (S.93)
III.) Kommunikationsprüfung
1. Public Relations als praktische Friedensarbeit (S.94)
2. Die Herausgabe der wissenschaftlichen Fachzeitschrift “Wiener Blätter zur Friedensforschung” (S.94)
2.1. Selbstverständnis der Zeitschrift (S.94)
2.2. Verbreitung und Finanzierung (S.95)
Kategorienschema (S.97)
Ergebnisse (S.98)
2.3. Die Autoren (S.100)
Kategorienschema (S.100)
Ergebnisse (S.102)
Zusammenfassung (S.104)
2.4. Einige Kriterien zur Qualitätskontrolle (S.105)
Fachliche Qualifikation des Verantwortlichen (S.106)
Einbindung des Verantwortlichen in den internen Kommunikationsfluß (S.107)
Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Publikation (S.107)
Akzeptanz durch die Führung (S.107)
Offenheit gegenüber allen Richtungen, d.h. Meinungsvielfalt (S.108)
Einbindung aller Mitarbeiter (S.108)
Unabhängigkeit der Redaktion (S.110)
Ergebnis der Qualitätskontrolle (S.110)
Redaktionsstatut (S.111)
3. Der Internet-Auftritt (S.113)
3.1. Usability (S.113)
3.2. Anwendung auf das UZF (S.116)
4. Veranstaltungen (S.118)
4.1. Allgemeines (S.118)
4.2. Lehrveranstaltungen (S.119)
4.2. Kongresse (S.119)
TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG AN DEN BEIDEN UZF-VERANSTALTUNGEN DES SOMMERSEMESTERS 2001 (S.121)
1. Internationales Symposium über Minderheiten (S.121)
2. Forschungsgespräch gegen den europäischen Integrationsprozeß (S.130)
SCHRITT 2: PROGRAMMERSTELLUNG (S.138)
I.) Überlegungen zu einem Unternehmensleitbild (S.139)
1. Formulierung der Zielvorstellungen als Voraussetzung für konsequente Öffentlichkeitsarbeit (S.139)
2. Corporate Identity (S.139)
2.1. Begriffserklärung und Relevanz (S.139)
2.2. Die Unternehmenskultur (S.141)
2.3. Das Leitbild (S.141)
2.4. Instrumente der Corporate Identity (S.143)
2.5. Probleme der Corporate Identity (S.144)
3. Anwendung des Gesagten auf das UZF (S.146)
3.1. Erstellung eines Unternehmensleitbildes und eines Corporate Designs (S.146)
3.2. Vereinheitlichung des öffentlichen Auftritts (S.157)
II.) Formulierung des P.R.-Programmes (S. 161)
1. Reaktive versus proaktive Strategie (S.161)
2. Innere Voraussetzungen für effiziente P.R. schaffen (S.161)
3. P.R.-Zieldefinition (S.162)
Kritierien zur P.R.-Zieldefinition (S.162)
Probleme in der Anwendung auf das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) (S.163)
Mit einfachen Methoden evaluierbare Hilfsziele (S.163)
Möglichkeiten der Zielformulierung bei Einsatz komplexerer Evaluationsmethoden (Umfragen) (S.164)
III.) Definition der Zielgruppen (S.165)
1. Allgemeines zur Zielgruppendefinition (S.165)
2. Stärken und Schwächen der Zielgruppenerfassung durch das UZF (S.169)
3. Versuch einer vorläufigen Zielgruppendefintion (S.170)
SCHRITT 3: UMSETZUNG (S.174)
1. Erst Strategie, dann Taktik (S.175)
2. Veranstaltungen (S.175)
3. Presse- und Medienarbeit (S.175)
Leitlinien professioneller Presse- und Medienarbeit (S.175)
Zum Umgang mit Journalisten (S.177)
Interview (S.177)
Presseaussendung (S.178)
Pressemappe (S.180)
Pressekonferenz (S.180)
Medienanfrage (S.181)
Presseverteiler (S.181)
Nachrichtenagenturen (S.188)
4. Kooperationen (S.189)
5. Fund Raising (S.189)
6. Zur Autonomie-Problematik im Fund-Raising: Plädoyer für einen “realistischen Idealismus” (S.193)
7. Interne Kommunikation (S.195)
Relevanz, Zielgruppen (S.195)
Mitarbeiterzeitschrift (S.196)
Videos (S.196)
Meetings (S.196)
Zusatzpublikationen (S.197)
Der Brief (S.198)
Das Gerücht (S.199)
8. “Opinion Leaders” (S.203)
9. Informelle Vereinbarkeitsprüfung bei neuen Mitgliedern (S.204)
10. Studenten (S.204)
11. Institutionelle Verankerung der Public Relations (S.205)
12. Zusammenfassung: Der taktische Block (S.207)
SCHRITT 4: EVALUATION (S.209)
1. Legitimatorische versus tatsächliche Evaluation (S.210)
2. Zur Sinnhaftigkeit von Meinungsumfragen trotz finanzieller Grenzen des UZF (S.210)
3. Informelle oder ohnehin bereits vorhandene Umfragen (S.211)
4. “Unaufdringliche Methoden” (S.211)
5. Medienresonanzanalyse (S.212)
6. Nutzung von einschlägigen Computerprogrammen zur Evaluation der Internet-Präsenz (S.212)
7. Umfassende Dokumentation (S.212)
8. Einrichtung von internen Nachbesprechungen (S.213)
9. Anerkennungspreise (S.213)
Literatur (S.214)
Lebenslauf (S.224)
Vorwort und Danksagungen
Die vorliegende Arbeit hätte niemals geschrieben werden können ohne die Unterstützung der Mitarbeiter des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF), die mir ihre Zeit für Expertengespräche zur Verfügung gestellt haben. Ich kann sagen, daß ich im Laufe dieser Gespräche nicht nur ihre Tätigkeit, sondern auch ihre Persönlichkeit besser verstehen und auch bewundern lernte. Viele dieser Menschen haben in ihrer Arbeit für den Frieden nicht nur ein wissenschaftliches Niveau, sondern auch eine moralische Größe erlangt, die mir Respekt für ihr Lebenswerk abfordert.
Folgende aktive Mitarbeiter des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) waren meine Interviewpartner, wofür ich ihnen meinen Dank ausspreche:
Herr Univ.-Prof.Dr. NORBERT LESER, der Präsident des UZF, ein verdienter und international anerkannter Forscher, der an zahlreichen österreichischen Universitäten und Fakultäten tätig gewesen und Träger wichtiger wissenschaftlicher Auszeichnungen ist. Sein Hauptverdienst für das UZF besteht aber nach meinem Dafürhalten v.a. darin, daß er die Integrität seiner Organisation immer mit Entschlossenheit verteidigt hat. Die vorliegende Diplomarbeit kann als eine Festschrift zum besonderen Anlaß seiner Emeritierung als ordentlicher Professor der Universität Wien verstanden werden, wobei auf meine Arbeit noch weitere und bedeutendere folgen sollten.
Herr Univ.-Prof.Dr. ERWIN BADER, der 1.Vorsitzende des UZF, ein aufgrund seiner vielfältigen Ausbildungen hochqualifizierter Spezialist für interreligiöse Dialoge, mein geschätzter Lehrer der Philosophie, dessen Unterstützung bei meinen Recherchen (insbesonders durch seine zahlreichen Auskünfte und bei der Vermittlung von Gesprächsterminen) für mich unverzichtbar war.
Frau Hofrat Diplom-Dolmetscher Dr. SIGRID PÖLLINGER, die Generalsekretärin des UZF, Mitglied der österreichischen OSZE-Delegation, die sich die Zeit nahm, mir den Redaktionsalltag der von ihr geführten wissenschaftlichen Fachzeitschrift “Wiener Blätter zur Friedensforschung” näherzubringen. Sie konnte mich auch sensibilisieren für den wichtigen Beitrag, den Internationale Organisationen wie die OSZE für den Frieden in Europa und der Welt leisten - im persönlichen Gespräch wie auch durch ihr Standardlehrbuch “Der KSZE/OSZE-Prozeß”.
Herr Botschafter Dr. HELMUT LIEDERMANN, der 2.Vorsitzende des UZF, der als praktische Frucht seiner Friedensarbeit maßgeblich am Zustandekommen der KSZE-Schlußakte von Helsinki 1975 beteiligt war - es ist eines der wichtigsten Völkerrechtsdokumente überhaupt - und heute als hochrangiger Diplomat in Bratislava / Preßburg (Slowakei) und bei den Vereinten Nationen in Wien aktiv ist. Ich muß gestehen, daß ich von seinem Lebenswerk besonders beeindruckt war und er für mich, v.a. hinsichtlich seines verdienstvollen Engagements bei der OSZE (u.a. als ehemaliger Generalsekretär derselben), ein nachzueiferndes Vorbild für meine Zukunft ist.
Herr Senator h.c. Univ.-Prof.Dr. ERICH KAISER, der Kassier des UZF, der mich über finanzielle Möglichkeiten und Grenzen der Public Relations seiner Organisation aufgeklärt hat.
Herr Prof.Dr. HERMANN BÖHM, Vorstandsmitglied des UZF, für seine unverzichtbaren Auskünfte während meiner abschließenden Recherchen.
Herr HERBERT STICKLBERGER, der Schriftführer und Archivar des UZF, für seine Hilfe bei den Forschungsarbeiten zur wissenschaftlichen Fachzeitschrift des Universitätszentrums (“Wiener Blätter zur Friedensforschung”).
Von den ausländischen Forschern des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) möchte ich mich besonders bedanken bei:
Herrn Prof. GARY BITTNER aus Pennsylvania, USA, den ich leider nicht interviewen konnte. Dies hatte den Grund darin, weil er unerwartet früh in seine Heimat abreisen mußte, noch bevor es mir möglich war, einen Gesprächstermin mit ihm abzumachen. Dennoch ist sein unverzichtbarer Standpunkt in die vorliegende Studie eingearbeitet, v.a. über die Hauptaussagen seines beeindruckenden Vortrages “Minorities in the USA” beim Internationalen Symposium des UZF über Minderheiten am 22.Mai 2001 und unter Berücksichtigung seiner zahlreichen Artikel in den “Wiener Blättern zur Friedensforschung”, in denen er lange vor den Attentaten in New York auf das Konfliktpotential zwischen dem Westen und der islamischen Welt hingewiesen hat.
Mein besonderer Dank gilt auch den Mitarbeitern des Souveränen Malteser Ritter-Ordens für die mir zur Verfügung gestellten Informationen über ihre Vereinigung. Besonders sei dabei hervorgehoben:
Herr Dipl.-Ing. RICHARD STEEB, der Kanzler des österreichischen Großpriorates des Souveränen Malteser Ritter-Ordens, für die P.R.-Mappe seines Ordens, die Mitarbeiterzeitschrift “Malteser Kreuz”, die Jahresberichte “Rivista” 1999 und 2000 und zudem insbesonders für seine Offenheit und Freundlichkeit.
Für die Vermittlung historischer Informationen bin ich ganz besonders den beiden von mir interviewten Zeitzeugen zu Dank verpflichtet:
Herrn Prof.Dr. WERNER GABRIEL, dem Sohn des UZF-Gründers Leo Gabriel, der mir das Leben und Werk seines Vaters aus erster Hand nähergebracht hat.
Herrn Univ.-Prof.Dr.Dr. RUDOLF WEILER, dem ehemaligen 1.Vorsitzenden des UZF, einem engagierten Moraltheologen, der sich um die Ziele der Militärgeistlichkeit besonders verdient gemacht hat.
Für seinen Gastauftritt beim Forschungsgespräch gegen die Europäische Union, veranstaltet vom “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) im April 2001, bedanke ich mich ferner bei:
Herrn Prof.Dr. ERWIN WEISSEL für seine von mir persönlich nicht geteilte, aber dennoch aufschlußreiche und zum Nachdenken anregende Meinung.
Folgende beiden Publizistik-Professoren der Universität Wien unterstützten mich ganz besonders beim Abfassen vorliegender Arbeit:
Herr Prof.Dr. ROLAND BURKART, der Betreuer meiner nunmehr zweiten Diplomarbeit aus einem human- und sozialwissenschaftlichen Fach, von dessen umfassender Kompetenz auf dem Gebiet der Public Relations ich mehr als einmal profitieren konnte.
Herr Prof.Dr. MANFRED BOBROWSKY, der sich spontan bereiterklärte, als mein “Zweitprüfer” zu fungieren.
Wien und Kástellos (Kreta), Sommer 2001
Mag. Patrick Horvath
EINLEITUNG
Was ist Public Relations?
“Public Relations”, abgekürzt “P.R.”, wird im Deutschen auch “Öffentlichkeitsarbeit” genannt, all diese Termini sind gleichbedeutend.
Der Begriff “Public Relations” stammt aus den USA, wo diese Disziplin entwickelt worden ist; später hat man sie in den deutschsprachigen Raum übernommen. Die “Eindeutschung” Öffentlichkeitsarbeit geht auf Albert Oeckl zurück, der ab 1950 als Leiter der Presseabteilung des Deutschen Industrie- und Handelstages tätig gewesen ist. Seine damalige Geschäftsführung lehnte den englischsprachigen Begriff ab, also “erfand” er einfach das Wort “Öffentlichkeitsarbeit”. Heute sind U.S.-amerikanische Ausdrücke wieder “in”, die Eindeutschung blieb aber dennoch nebenher bestehen und hat sich mittlerweile allgemein durchgesetzt.
Eine sehr pragmatische Definition von Öffentlichkeitsarbeit hat die Deutsche Public Relations-Gesellschaft (DPRG) vorgelegt; es ist eine Definition, die ohne zusätzliche Kommentare niemals ausreichend wäre (denn sie ist zunächst nur eine reine Funktionsbeschreibung ohne ethischen Werthintergrund), aber sie eignet sich gut für einen Einstieg. Diese Definition besagt u.a., es handle sich dabei allgemein um das Management von Kommunikationsprozessen einer Organisation mit ihren Bezugsgruppen.
Die konkrete Tätigkeit in der Praxis ist sehr vielfältig. Cutlip, Center und Broom, drei U.S.-amerikanische Spezialisten für Öffentlichkeitsarbeit, bemühen sich in ihrem Standardlehrbuch “Effective Public Relations” um eine Aufzählung möglichst vieler Aktivitäten, in die ein P.R.-Manager involviert sein kann. Ich greife wahllos und unvollständig aus ihrer Aufzählung heraus, damit ein gewisser Eindruck von praktischer P.R.-Arbeit entsteht.
P.R.-Manager schreiben z.B. Presseaussendungen, organisieren Pressekonferenzen, reagieren auf Medienanfragen und bereiten sonstiges Informationsmaterial für Journalisten auf. Sie gestalten überhaupt u.a. Broschüren und P.R.-Mappen über ihren Betrieb, auch für andere Zielgruppen als Journalisten (in Profit-Betrieben z.B. für Aktionäre, in Krankenhäusern z.B. für Patienten etc.), zudem sind sie oftmals auch für die Jahresberichte und Mitarbeiterzeitschriften einer Organisation zuständig. Sie werten Meinungsumfragen zu Bekanntheitsgrad und Image ihres Betriebes aus und überlegen sich Maßnahmen, wie man auf Basis dieser Ergebnisse handeln sollte; sie sind also in der Regel in die strategische Planung eines Unternehmens involviert. Oftmals schreiben sie Reden für andere oder sprechen selbst vor Publikum. Sie sorgen für den professionellen Auftritt einer Organisation im Internet. Sie beraten andere Top-Manager auf Basis ihres Fachwissens hinsichtlich der öffentlichen Präsentation, manchmal “trainieren” sie diese sogar dafür und managen die Rahmenbedingungen. Sie verhandeln mit verschiedenen Gruppen, die mit dem Unternehmen in Zusammenhang stehen, z.B. Politikern, potentiellen Sponsoren, Verbänden etc. Diese Beschreibung ist nicht erschöpfend, aber man kann sich ein ungefähres Bild von P.R. in der Praxis machen.
Soweit die rein funktionale Beschreibung. Wie diese Managementtätigkeit aber zu erfolgen hat, d.h. mit welcher “Philosophie” im Hinterkopf, das ist die große Frage. Bei Beantwortung dieser gibt es - historisch und unter Umständen noch heute - einen Grundwiderspruch zwischen hauptsächlich zwei Typen von Auffassungen (wobei Abstufungen zwischen den Extremen vorkommen). Der eine Typus hat rein instrumentellen, der andere durchaus moralischen Charakter.
Man kann dieses innere Spannungsfeld gut illustrieren anhand des “Vier-Phasen-Modells” der beiden U.S.-Amerikaner Grunig und Hunt, an denen in der P.R. kein Weg vorbeiführt. Dabei wird die historische Entwicklung der Public Relations von ihren Anfängen bis heute in vier Phasen eingeteilt.
1.Publizität (publicity) - ab 1850
Verständnis von P.R. als Propaganda, Kommunikation ist eine bloße Einbahnstraße, Wahrheit ist nicht wichtig.
2.Information (public information) - ab 1900
Verständnis von P.R. als Verbreitung von Information, Kommunikation ist Verlautbarung, Wahrheit und Überprüfbarkeit sind allerdings wichtig
3. Kommunikation als asymmetrischer Dialog (two-way-asymmetric) - ab 1920
Verständnis von P.R. als Überzeugen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, der Empfänger soll reagieren, aber im Grund hat man an einem echten Dialog kein Interesse.
4. Kommunikation als symmetrischer Dialog (two-way-symmetric) - ab 1960
Verständnis von P.R. als Überzeugen, aber auf der Basis von gleichgewichtigen Austauschprozessen und Einflußmöglichkeiten. Es geht darum, gegenseitiges Verständnis zu schaffen und es gibt ein echtes Interesse an den Reaktionen der Empfänger, das man auch in die eigenen Handlungen wiederum einfließen läßt.
Die vier Phasen haben einander nicht direkt “abgelöst”, sondern es ist in jeder historischen Phase ein neuer Ansatz quasi “hinzugekommen”. D.h. bis heute gibt es Unternehmen, die P.R. im Sinne von Modell 1, 2 oder 3 verstehen, obwohl es schon eine “Weiterentwicklung” gibt. In gewisser Weise kann man die vier Modelle auf einer Art Skala zwischen den Extrembezeichnungen “unmoralisch”, d.h. rein instrumentell und manipulativ einerseits sowie “moralisch”, d.h. demokratisch und dialogorientiert andererseits einordnen. Dieses Spannungsfeld der verschiedenen Ansätze besteht bis heute, was sich in den unterschiedlichen Definitionen von P.R. niederschlägt.
Es stellt sich aber die Frage, ob ein Widerspruch zwischen Erfolg und Moral im Bereich der Kommunikation nicht nur scheinbar besteht oder ob ein - klug und langfristig gedachter - instrumenteller und ein moralischer Ansatz nicht letztlich sogar in eines zusammenfallen. Praktiker im P.R.-Bereich sind nämlich in der Regel der Meinung, daß sich “fair play” in der Kommunikation - zumindest langfristig - auch auszahlt. Und es spricht wirklich vieles dafür: Denn werden sich die Menschen nicht von einem abwenden, wenn man ihnen durch seine Worte oder Taten zu verstehen gibt, daß man sie im Prinzip nur als beliebig manipulierbare Werkzeuge betrachtet? Wie will man seine Öffentlichkeitsarbeit optimieren, wenn man auf Rückmeldung des Publikums keinen Wert legt? Lassen sich Menschen überhaupt beliebig manipulieren? Letzteres ist wohl sicher nicht der Fall. Ein Chemiekonzern kann den besten P.R.-Berater anheuern; er wird den Menschen nicht erklären können, warum es z.B. gut ist, die Flüsse mit Quecksilber zu verseuchen. Und kann man nach Belieben offensichtlich bestehende Probleme vertuschen? Das wohl ebenfalls nicht. Nach einem Chemieunfall, der praktisch den gesamten Bestand der Fische im Rhein auslöschte, die aufgedunsen und tot an der Oberfläche schwammen, schaltete die daran Schuld tragende Firma Sandoz eine Anzeigenkampagne mit dem Titel “Lieber Rhein! Lieber Fluß!”, in der es u.a. hieß, daß die Belastung mit Schwermetallen um fünfzig Prozent gesunken sei. Solche kosmetischen Maßnahmen, die versuchen, ein Problem nicht an der Wurzel anzupacken, sondern nur schönzureden bzw. die versuchen, die Welt zu ändern, aber niemals das eigene Unternehmen, haben natürlich nichts geholfen, weil sie vollkommen unzureichend waren; sie werden aber bis heute häufig praktiziert.
Ein P.R.-Manager kann also etwa in einem solchen Fall weder beliebig manipulieren, noch beliebig die offensichtlichen Fakten unterdrücken, vorausgesetzt, er wollte es überhaupt. Aber er kann, wenn er einen Dialog mit der Öffentlichkeit aufnimmt, z.B. dem Unternehmen die öffentliche Meinung berichten und die Gründe für deren ablehnende Haltung (in diesem Fall Umweltsünden). Er kann darauf hinwirken, daß die Firma darauf reagiert, z.B. durch tiefgreifende innere Reformen, Reparaturen der Schäden, Restitutionen an die Betroffenen etc. Dann kann er wiederum der Öffentlichkeit die Versuche des Unternehmens durch Kommunikationsmaßnahmen vermitteln, das Problem in den Griff zu bekommen. P.R. hat schon oft Betriebe “geläutert”; es gibt Beispiele von Unternehmen aus der Praxis, die, nachdem sie eine professionelle P.R. annahmen, vom umweltverseuchenden “bad guy” zum umweltbewußten “good guy” wurden, dadurch ihr Image verbesserten und auf diese Art letztendlich günstigere Rahmenbedingungen für die Entfaltung ihrer Verkaufsaktivitäten schufen. Schon Immanuel Kant nannte die “Publizität” als Kriterium für Moralität, will heißen: Wenn ich mir überlege, ob etwas moralisch ist oder nicht, soll ich mich fragen, ob ich es öffentlich vertreten kann oder nicht. Für Kant ist die Öffentlichkeit also weniger eine beliebig manipulierbare Masse, sie ist vielmehr Kontrollinstanz; ihrem strengen Blick entgeht fast nichts.
Natürlich ist es so, daß man die Öffentlichkeit durch Aktivität beeinflussen kann, aber eben nicht beliebig; die Öffentlichkeit hat aber auch ihre Ansichten, die geeignet sind, durch ihre Rückmeldungen eine Organisation zu beeinflussen, so letztere diese aufzunehmen bereit ist, was sich aus noch zu besprechendem Grunde empfiehlt.
Es ist also offenbar ratsam, zu den modernen, dialogorientierten Modellen zu greifen und überhaupt auch im Einklang mit ethischen Kodizes der P.R. zu handeln; im europäischen Raum ist dabei der “Athener Kodex” sehr bekannt, obwohl aufgrund seiner “Verschwommenheit” von Praktikern oftmals kritisiert; der “Public Relations Verband Austria” (PRVA), die österreichische P.R.-Standesvertretung, hat auch einen hilfreichen Ehrenkodex erarbeitet; besonders für die Praxis brauchbar, weil sehr konkret, erscheinen mir zudem die ethischen Richtlinien der “Public Relations Society of America” (PRSA). Sie alle versuchen im Prinzip, eine gewisse Ethik in der Kommunikation eines Unternehmens einzumahnen und fordern u.a. ein “demokratisches” Menschenbild, das einen rein instrumentellen Zugang ausschließt. Es kann durchaus sein, daß diese Ansätze nicht nur moralischer, sondern letztlich sogar erfolgreicher sind als all jenes, was man zuvor in der Geschichte finden kann.
Ich möchte zum vorliegenden speziellen Thema gleich anmerken, daß andere P.R.-Modelle als dialogorientierte einer auf Dialog und Verständigung ausgerichteten Organisation wie dem “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) sicherlich nicht angemessen wären.
Es folgen drei Beispiele für Definitionen von P.R., die aus einem modernen, dialogorientierten Verständnis von diesem Fachgebiet entspringen und damit auch fest auf dem Boden der Demokratie stehen. Die Auswahl erfolgt rein nach persönlichem Geschmack, die Darstellung ist knapp und unvollständig.
In Österreich sehr anerkannt ist die entsprechende Definition des Public Relations Verbandes Austria (PRVA). Für die österreichische “Standesvertretung” der P.R.-Agenturen bedeutet Öffentlichkeitsarbeit im Prinzip, vertrauensbildende Maßnahmen in der Öffentlichkeit zu setzen. Wichtig ist für den PRVA dabei nicht zuletzt eine zugrundeliegende Gesinnung, die zur Übernahme gesellschaftlicher Rechte, aber auch Pflichten bereit ist. Es wird also soziale Verantwortung eingemahnt, der man durch Vertuschen, Progaganda etc. ohne Zweifel nicht gerecht werden kann.
Der Definition von P.R., die Cutlip, Center und Broom anregen, liegt ebenfalls ein dialogorientiertes Modell zugrunde. Sie meinen: “Public Relations is the management function that establishes and maintains mutually beneficial relationships between an organization and the publics on whom its success and failure depends.” Es geht also um die Etablierung von Beziehungen zwischen einer Organisation und ihren “Öffentlichkeiten” (es gibt, obwohl wir im Alltag immer davon reden, eigentlich nicht “eine” Öffentlichkeit, sondern streng genommen eine riesige Zahl einzelner Menschen mit individuellen Anschauungen, Erfahrungen und Gefühlen, die aber nach gewissen gemeinsamen Kriterien in bestimmte soziale Gruppen erfaßt und mit für die jeweilige Gruppe geeigneten Medien mehr oder weniger gezielt angesprochen werden können; diese Gruppen nennt man in alternativen und völlig gleichwertigen Bezeichnungen Zielgruppen, Bezugsgruppen bzw. Dialoggruppen oder auch Teilöffentlichkeiten). Wichtig ist auch der Hinweis in der obigen Definition, daß diese Beziehungen zum gegenseitigen Vorteil sind. Die Autoren betonen auch den Gegensatz zwischen “offenen” und “geschlossenen” Systemen. “Offene Systeme” sind solche, die mit ihrer Umwelt in einem starken Austausch stehen, daher Veränderungen außerhalb gut wahrnehmen und sich mit diesen auch selbst ständig verändern. Diese Systeme haben den Vorteil, sich einfach besser an Umweltbedingungen anpassen zu können; daher sind sie überlebensfähiger. Geschlossene Systeme hingegen stehen in keinem oder nur sehr geringem Austausch mit der Umwelt und neigen daher in gewisser Weise dazu, “den Anschluß zu verlieren”. Ein Unternehmen und insbesonders seine P.R. sind dann besonders erfolgreich, wenn es sich bei ihnen um “offene Systeme” handelt. Das ist auch der ein paar Absätze zuvor schuldig gebliebene Hauptgrund dafür, daß dialogorientierten Methoden eine solche Bedeutung zukommt: Sie “öffnen” ein Unternehmen für Anregungen nach außen und machen es so, auch wenn man das zunächst oft nicht zu glauben geneigt ist, stärker. Unternehmen müssen flexibel, sie müssen wandlungsfähig sein, sonst wird ihr Untergang wahrscheinlicher. Nur wer mit der Zeit geht, wird langfristig überleben.
Am Wiener Publizistik-Institut, an dem ich meine P.R.-Ausbildung erhielt, wurde auch ein eigener Ansatz entwickelt, der den nach Dialog strebenden Philosophen des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) ohne Zweifel zusagen wird, nämlich die “verständigungsorientierte Öffentlichkeitsarbeit”, kurz VÖA. In diesem Modell wird an Habermas’ Diskursethik angeknüpft und an seine Durchleuchtung des Begriffes der “Verständigung”. Diese wird in der heutigen Gesellschaft mit ihren zunehmenden Interessenskonflikten immer problematischer; und es ist Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit, diese verlorengegangene Verständigung durch einen geregelten Diskurs wiederherzustellen. Dabei orientiert man sich, auch aus demokratischen Gründen, an der “idealen Sprechsituation”, die in der Realität natürlich niemals vollständig gegeben ist, der man aber nach Kräften entgegenstreben kann. Diese ideale Sprechsituation ist von Gewaltfreiheit gekennzeichnet, d.h. es wird rational argumentiert, ein Konsens gesucht, die Beteiligten folgen einzig dem “zwanglosen Zwang” der Vernunft. Im Prinzip koordiniert in diesem Verständnis ein P.R.-Manager eine Art Mediationsverfahren zwischen einem Unternehmen und den Menschen, die andere bzw. entgegengesetzte Interessen haben - der Öffentlichkeitsarbeiter wird so zum Friedensstifter und Diplomaten, der die “zerstrittenen” Gruppen einander näherbringt. Dieser Ansatz wurde bereits in der Praxis erfolgreich erprobt, und zwar anläßlich eines Spezialfalles der Errichtung zweier Sondermülldeponien in Niederösterreich, die von den Anrainern natürlich heftigst kritisiert worden ist. Die P.R.-Verantwortlichen leiteten ein Mediationsverfahren ein und versuchten, alle irgendwie Betroffenen einzubinden und deren gegensätzlichen Interessen auszugleichen. Öffentlichkeitsarbeit und Friedensarbeit scheinen nach dem “Wiener” Verständnis von P.R. letzten Endes in eines zusammenzufallen.
Um einer häufigen Verwechslung gleich vorweg zu begegnen, sei zudem festgestellt: Zwischen P.R. und Werbung besteht ein gravierender Unterschied, daher sollten beide Disziplinen innerhalb eines Unternehmens zwar eng miteinander kooperieren, aber unabhängig voneinander operieren. Werbung, die in der Regel eher kurzfristig denkt und wirkt, funktioniert in etwa nach dem Prinzip “Geld gegen Publizität” (Beispiel: man bezahlt ein Inserat im Anzeigenteil einer Zeitung).
P.R. ist als Rahmenbedingung z.B. für den Absatz eines Wirtschaftsunternehmens sehr wohl wichtig, geht aber weit darüber hinaus, bloße Verkaufsaktivität zu sein; vielmehr geht es um Kommunikation mit und Image in der Öffentlichkeit; für das Image sind unter Umständen aber auch gesellschaftliche Gruppen relevant, die keine Bedeutung für den Absatz im engeren Sinne haben, weil sie das entsprechende Produkt nicht kaufen; man muß aber auch mit ihnen reden (z.B. Bürgerinitiativen, Umweltschutzgruppen, Politiker etc.).
Öffentlichkeitsarbeit wirkt zudem ausschließlich langfristig und funktioniert - professionell, auf ethischer Basis und im Einklang mit den Gesetzen gehandhabt - eher nach dem Prinzip “Information gegen Publizität” (Beispiel: man gibt einer Zeitung Informationen zu einer Veranstaltung der eigenen Organisation und diese berichtet darüber - im redaktionellen Teil natürlich, der mehr Vertrauen und Aufmerksamkeit bei den Lesern genießt). Eine institutionelle Trennung zwischen P.R. und Werbung ist empfehlenswert, weil sonst in der Praxis Irritationen entstehen können.
Noch ein weiterer Aspekt von Öffentlichkeitsarbeit muß abschließend u.a. im Anschluß an Detlef Luthe betont werden. Er sieht die wichtigste Aufgabe der P.R. in der Herstellung, Aufrechterhaltung und Erweiterung der Autonomie einer Organisation. Es geht also um ihre Unabhängigkeit, ihre Möglichkeit, weitgehend über sich selbst zu bestimmen, ihre Ziele selbst zu wählen und frei handeln zu können, denn nur unter dieser Bedingung ist die Selbstentfaltung und Selbstbehauptung einer Organisation möglich, wobei die P.R. ihr bei diesem Unterfangen hilft. Natürlich ist die hundertprozentige Autonomie für keine Organisation möglich; aber das heißt nicht, daß man diesem Ziel nicht wenigstens entgegenstreben sollte. Man muß Kollisionen der Ziele zwischen der eigenen Organisation und irgendeiner anderen zumindest in den eigenen internen Entscheidungsgremien nach Möglichkeit ausschließen, um nicht erleben zu müssen, daß die eigenen Ziele nicht einmal intern mehr formulierbar, geschweige denn nach außen durch Kommunikationsmaßnahmen umsetzbar sind, nur weil irgendein Außenstehender aus irgendwelchen Gründen vielleicht etwas dagegen haben könnte.
Nach diesem Verständnis ist der P.R.-Manager eine Art “Wachhund” des Unternehmens, für das er arbeitet. Seine Loyalitäten sind eindeutig; und er tut alles, um Versuche der Fremdbestimmung seiner Organisation zurückzuweisen. Und er ist noch in einer weiteren Hinsicht ein “Wachhund”: Er fungiert als eine Art Frühmeldesystem für potentielle P.R.-Krisen und hilft gleich vorsorglich bei ihrer Entschärfung, was manchmal lästig und unangenehm sein kann (denn er kritisiert intern alles und jedes, was ihn nicht immer allgemein beliebt macht), es ist aber immer noch besser als Schönreden, Vertuschen, Ignorieren und darauffolgende noch stärkere Eskalation in der Öffentlichkeit.
Erstellung eines P.R.-Konzeptes
Forschungsfrage, Thema
Die vorliegende Arbeit geht von einer ganz klaren Forschungsfrage bzw. Forschungsaufgabe aus. Diese besteht darin, ein professionelles P.R.-Konzept für eine bestimmte, am Institut für Philosophie der Universität Wien angesiedelte Forschungsstelle, nämlich das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF), zu erstellen.
Die genannte Organisation (über die eine umfassende und genaue Darstellung noch folgt, in der jeder der hier genannten Punkte detailliert und mit Zitierungen ausgeführt wird) ist relativ klein, aber insoferne bedeutend, weil sie - so der momentane Stand - die einzige Verankerung der Friedens- und Konfliktforschung an einer staatlich anerkannten österreichischen Universität ist. Die Friedensforschung ist ein international etabliertes Fachgebiet, das leider in Österreich wesentlich geringer präsent ist als anderswo; es handelt sich dabei um eine interdisziplinäre Wissenschaft, die sich der Analyse der Bedingungen des Ausbruchs von Gewalt im allgemeinen (und Krieg im besonderen) widmet; im Anschluß an solche Analysen werden Strategien entwickelt, wie gewaltsame Auseinandersetzungen präventiv vermieden oder nach Ausbruch eingedämmt bzw. beendet werden können. Man bedient sich bei der Forschung wissenschaftlicher Methoden verschiedenster Fächer, wobei v.a. Philosophie, Politikwissenschaft, Geschichte, Völkerrecht, Psychologie, Soziologie etc. relevant sind. Der Friedensforscher ist dabei einem philosophischen Wert (dem Frieden) verpflichtet, der in moderner Begrifflichkeit eng mit anderen Werten (Demokratie, Menschenrechte etc.) zusammenhängt.
Gäbe es die Forschungsstelle “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) nicht, würde eine wesentliche Kompetenz der Universität Wien gegenüber anderen österreichischen Universitäten verloren gehen. Außerdem wäre die Pflege eines wichtigen Faches in Österreich noch viel weniger gewährleistet als bisher - was schade wäre. Die besagte Wissenschaft ist nämlich sehr aktuell und praxisbezogen und v.a. im Bereich Journalismus, Diplomatie und Politik gut anwendbar. Diese beiden Umstände der Aktualität und des Praxisbezuges sind eine in Hinblick auf die Kommunizierbarkeit der Anliegen des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) nicht zu unterschätzende Stärken.
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) widmet sich u.a. der philosophischen Grundlagenforschung, aber auch ganz aktuellen Themen (Minderheitenprobleme, Landminen, Friedensdialoge der Weltreligionen, Internationale Organisationen etc.) sowie der Verbreitung der Ergebnisse seines Fachgebietes, zudem in kleinerem Ausmaß der Lehre an der Universität Wien. Außerdem gibt es, wie später genauer ausgeführt, Bestrebungen, auch in der praktischen Friedensarbeit tätig zu sein.
Es ist vom dortigen Top-Management aus verschiedensten Gründen erwünscht (u.a. zur Verbreitung der Friedensidee, aber auch in Hinblick auf die Selbstbehauptung der ständig von Einsparungen bedrohten Organisation), daß die Vereinigung in der Öffentlichkeit wirksam ist; ja, es sollte nach dem Ergebnis praktisch aller von mir durchgeführten Expertengespräche sogar ein Hauptzweck der Organisation sein. Es bestehen bereits vielversprechende Ansätze dazu: Man publiziert die einzige wissenschaftliche Zeitschrift zum Fachgebiet in Österreich (“Wiener Blätter zur Friedensforschung”), veranstaltet Kongresse, ist im Internet aktiv etc.
Die vorliegende Arbeit soll helfen, solche und ähnliche P.R.-Aktivitäten noch erfolgreicher zu gestalten.
Was ist ein P.R.-Konzept? Wozu braucht man eines?
Ein P.R.-Konzept ist ein
methodisch entwickeltes,
kreatives
und in sich schlüssiges
Planungspapier für kommunikationspolitische Problemlösungen einer Organisation, und zwar sowohl für interne, als auch für externe. Man ist sich weitgehend darüber einig, daß ein strategischer “Masterplan”, aus dem zielgerichtete P.R.-Taktiken abgeleitet werden können, schon die halbe P.R.-Arbeit ist. Professionelle Konzeptionierung ist Voraussetzung für wirkungsvolle Public Relations, weil sie das Risiko des Scheiterns minimiert. Planloses Handeln ist unprofessionell.
Wichtig für die P.R. ist die (letztlich auf den preußischen General Clausewitz zurückgehende) klare Unterscheidung zwischen Strategie und Taktik, die auch in der vorliegenden Arbeit konsequent durchgehalten wird. Anhand eines sehr einleuchtenden Beispiels sei der Unterschied dargestellt: Hannibals Strategie bestand darin, daß er Rom erobern wollte (Zweck). Um dies zu erreichen, zog er - als taktische Maßnahme - mit Elefanten über die Alpen (Mittel). Er hat nicht die Eroberung Roms angestrebt, um “irgendetwas” mit Elefanten und Alpenwanderungen machen zu können, z.B. weil Elefanten so lustige Tiere sind oder Alpenwanderungen gerade modern.
Die Strategie ist der Taktik übergeordnet. Eine Organisation muß sich zunächst über ihre Zwecke bewußt werden, dann die geeigneten Kommunikationsmittel zur Umsetzung wählen. Die Präsenz im Internet, die Herausgabe einer Zeitschrift, die Veranstaltung von Kongressen etc. sind keine Zwecke; sondern es sind Mittel, um einen höheren Zweck umzusetzen, über den man sich immer im Klaren sein muß. Die vorliegende Arbeit begleitet und unterstützt daher nicht nur die taktische Umsetzung der Kommunikationsmaßnahmen, sondern v.a. auch die strategische Willensbildung des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF).
Wie erstellt man ein P.R.-Konzept?
Ich beziehe mich bei der Vorgangsweise der Erstellung eines P.R.-Konzeptes auf jene Methode, auf der Cutlip, Center und Broom ihr Standardlehrbuch “Effective Public Relations” zu einem nicht unwesentlichen Teil aufgebaut haben, nämlich das Modell der “four steps”, der “vier Schritte” des P.R.-Managementprozesses. Zunächst sollen die vier Schritt aufgezählt, danach ihr Hauptzweck und die Vorgangsweise kurz und bündig zusammengefaßt werden.
1.) Bestandsaufnahme
2.) Programmerstellung
3.) Umsetzung
4.) Evaluation
ad 1.) Eine Voraussetzung für die Erstellung von P.R.-Strategien ist, daß man die betreffende Organisation wirklich gut und gründlich kennt. Daher muß sie ziemlich vollständig und umfassend wissenschaftlich durchleuchtet und aufgearbeitet werden. Dieser “Schritt” beinhaltet zunächst eine Situationsanalyse, also eine Art allgemeine Darstellung der Organisation. In dieser können viele Aspekte relevant sein, z.B. die Organisationsstruktur, die Budgetzahlen, die Biographien der wichtigsten Funktionäre etc. Cutlip, Center und Broom betonen aber auch die Bedeutung der historischen Annäherung; oftmals kann man das “Wesen” einer Organisation nur dann verstehen, wenn man ihre Geschichte kennt. Dies hat auch einen ganz praktischen Nebeneffekt: Da Unternehmen meist keinen “hauseigenen” Historiker angestellt haben, können alle Auskünfte über Geschichte der Organisation dann gleich von der P.R.-Abteilung erfolgen, in der diese Informationen verfügbar sind. Im “ersten Schritt” enthalten sein muß auf jeden Fall auch eine Problemanalyse, d.h. man soll insbesonders ein Hauptaugenmerk auf alle faktischen oder potentiellen Probleme legen, die sich für die Organisation in ihrer Gesamtheit und speziell für ihre P.R. stellen. Darauf folgt eine Kommunikationsprüfung, in der im Prinzip alle bestehenden Kommunikationsaktivitäten mit den einschlägigen und mit Recht allseits gefürchteten Methoden der Publizistikwissenschaft (z.B. der Inhaltsanalyse) möglichst schonungslos durchleuchtet werden.
Dieser erste Teil ist natürgemäß der umfangreichste. Das soll und muß so sein, weil es eben die Aufgabe dieses Schrittes ist, möglichst viele Fakten zusammenzutragen und auszuwerten; diese “Faktensammlung” ist darum wichtig, weil man bei Beurteilung der P.R. immer wieder auf diese zurückgreifen muß. Oft können Fakten, die zunächst irrelevant aussehen, sich bei der Lösung einer gewissen Schwierigkeit als unglaublich bedeutend herausstellen; es gibt fast nichts, was in einer Organisation passiert, das für die P.R. nicht relevant sein kann. In der Fachliteratur rund um Konzeptioniertechnik wird vor einer zu schmalen Faktenbasis gewarnt.
Die Methode der Expertengespräche empfiehlt sich für die allgemeine Analyse einer Organisation, aber darüberhinaus ist die Sammlung aller zur Verfügung stehenden Daten, Publikationen etc wichtig. Bei den Expertengesprächen weisen Cutlip, Center und Broom (die überhaupt einen ähnlichen Wahrheitsbegriff wie der Gründer des “Universitätszentrums für Friedensforschung” Leo Gabriel zu vertreten scheinen) darauf hin, daß man immer möglichst alle Seiten befragen und aufmerksam anhören muß, weil sonst leicht ein falscher Eindruck von einer Organisation entsteht - nicht, weil direkt “gelogen” wird, sondern weil eben jeder Beteiligte seine höchstpersönliche Sichtweise auf sein Unternehmen hat; nur zusammengefügt und in eine Synthese gebracht ergeben diese Sichtweisen eine umfassende Wahrheit. Aus diesem Grund habe ich versucht, möglichst viele verschiedene Standpunkte einzuholen; insbesonders ging ich abwechselnd zu all jenen, von denen ich wußte, daß sie verschiedene Meinungen vertraten, die ich dann miteinander kritisch verglich; ja, ich ging sogar zu den “Verworfenen”, die mit dem heutigen UZF “verkracht” sind, denn man muß immer alle Seiten eines Problems kennen und unvoreingenommen prüfen, um, wenn uns Menschen dies überhaupt möglich sein sollte, so etwas wie “Wahrheit” ansatzweise erahnen zu können. Es erwies sich für die Niederschrift dieser Arbeit als äußerst günstige Voraussetzung, daß ich zuvor eine semesterlange Ausbildung in sozialwissenschaftlicher Methodenlehre durchlief, in der ich u.a. in Spezialseminaren an der Universität Wien für die Führung professioneller Expertengespräche systematisch trainiert wurde.
ad 2.) Der “zweite Schritt” liegt in der Erstellung eines P.R.-Programmes, d.h. in der Ausformulierung konkreter P.R.-Ziele, die auch evaluierbar sind (d.h. man muß sie “operationalisierbar” im Sinne von nachprüfbar formulieren).
Die Evaluation wird in der P.R. immer wichtiger, denn wie in jedem Managementbereich gibt es heutzutage überall großen Legitimationsdruck; und wer keine Erfolge nachweisen kann, wird schnell wegrationalisiert. Daran überhaupt zu denken, Öffentlichkeitsarbeit (die Wissenschaft von der Selbstbehauptung eines Betriebes!) einzusparen ist zwar eine vollendet Dummheit, aber was will man vom heutigen kurzsichtigen ökonomischen Denken, das auch zu glauben scheint, gründliche Bildung sei langfristig für die Selbstbehauptung entbehrlich?
Außerdem muß es eine Definition der Zielgruppen geben; das vorher erwähnte P.R.-Programm muß zudem im Rahmen der Vorgaben eines Unternehmensleitbildes oder Grundsatzprogrammes formuliert werden, das allgemeine Richtlinien zu Werten und Zielen eines Unternehmens beinhaltet. Ist ein solches Unternehmensleitbild nicht vorhanden, muß man einen Vorschlag dazu ausarbeiten; eine Organisation kann nur dann effiziente P.R. besitzen, wenn sie weiß, was sie eigentlich will und dies, um über ihren Willen Klarheit zu schaffen, auch schriftlich fixiert.
ad 3.) Darauf folgen Gedanken über die einzelnen P.R.-Maßnahmen auf der taktischen Ebene, die der Erreichung des strategischen Zieles dienen sollen.
ad 4.) Über die Evaluation ist bereits gesprochen worden; und im entsprechenden “vierten Schritt” wird auch noch davon die Rede sein. Nur, wenn man ständig überprüft, ob man die angestrebten Erfolge auch erreicht hat, kann man seine Handlungen verbessern und adaptieren; selbst aus Mißerfolg lernt man, wenn man ihn registriert. Evaluation in einem Unternehmen darf nicht nur “legitimatorischen” Charakter haben, sondern es muß eine “tatsächliche” Evaluation geben, die Aufschluß darüber geben kann, “wie es so lief”. Fehler machen ist keine Schande, die Schande liegt nur darin, nicht aus ihnen zu lernen oder sie gar nicht wahrzunehmen.
Evaluation kann auf drei Stufen des Kommunikationsprozesses stattfinden, die man auseinanderhalten sollte. Erfolg in der jeweils vorhergehenden Stufe bereitet den Erfolg in der nächsten vor, garantiert ihn aber nicht. Die Stufen sind:
Preparation (Vorbereitung)
Implementation (Umsetzung)
Impact (Wirkung)
Ich möchte diese drei Stufen am Beispiel der Presse- und Medienarbeit illustrieren. Ob überhaupt Presse- und Medienarbeit vorhanden ist, ob alle in der Fachliteratur genannten Möglichkeiten genutzt werden, ob die nötigen internen Voraussetzungen dafür geschaffen sind, kann geprüft werden (Preparation). Ob z.B. die Presseaussendungen auch abgedruckt werden, ebenfalls (Implementation). Die andere Frage ist, was es für Meinungsänderungen beim Publikum bewirkte, kann man z.B. durch eine Umfrage erfahren (Impact).
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) hat leider dermaßen wenig Geld, daß manche Evaluationsmaßnahmen (z.B. eben Umfragen) momentan schwierig finanzierbar sind; die Folge war, daß auch die Zielformulierung dadurch schwierig wurde, die ja wie gesagt überprüfbar sein muß. Aber umgekehrt: Darin liegt auch ein gewisser Reiz und eine Herausforderung; Öffentlichkeitsarbeit findet aber natürlich im UZF sehr schwierige Bedingungen hinsichtlich ihrer Entfaltungsmöglichkeiten vor.
Über die tiefe Sinnlosigkeit eines “Gefälligkeitsgutachtens”
Jeder Forscher muß sich sinnvollerweise vor einem wissenschaftlichen Projekt fragen, wie weit es um seine eigene Objektivität bestellt ist. Er muß sich fragen: “Wenn meine Subjektivität mit mir durchginge, was würde ich dann denken, sagen, schreiben?” Er muß seine eigenen Schwächen kennen, schon alleine, um sich anschließend um größtmögliche Objektivität zu bemühen.
Ich stehe dem “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) persönlich stark positiv gegenüber. Das liegt zum Teil daran, weil es wirkliche Stärken hat; die größte dieser Stärken ist, daß es eine betreffende Organisation hierzulande überhaupt gibt. Es wäre objektiv ein Rückfall für das österreichische Bildungswesen hinter internationale Standards, wenn die weltweit bedeutsame Friedensforschung gerade an der Universität Wien nicht präsent wäre. Zu einem anderen Teil bin ich natürlich auch subjektiv voreingenommen, weil ich u.a. am UZF selbst studiert und sehr positive Erfahrungen mit den dortigen Mitarbeitern gesammelt habe. Sie haben mich auch später ohne Ausnahme, obwohl sie hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Ränge als Universitätsprofessoren, Hofräte, Botschafter etc. weit über mir stehen, bei meinen Recherchen mit viel Hilfsbereitschaft und Entgegenkommen unterstützt. Daß ich die Organisation prinzipiell schätze, zeigt sich auch schon alleine an dem Umstand, daß ich mich so lange mit ihr auseinandergesetzt habe.
Bei aller möglichen positiven Voreingenommenheit weigere ich mich aber, ein “Gefälligkeitsgutachten” oder eine “Jubelbroschüre” zu verfassen; und wer anderes erwartet hat, kennt mich schlecht. Ich habe in meinen gründlich geführten Recherchen u.a. nicht unbeträchtliche Probleme aufgespürt, die man als Voraussetzung für professionelle Öffentlichkeitsarbeit lösen oder zumindest diskutieren wird müssen. Die Voraussetzung für eine Lösung der Probleme ist, daß man sie beim Namen nennt. Alle genannten Schwierigkeiten sind ohne gravierende Einschnitte oder revolutionäre Umstürze lösbar und ändern nichts an den ansonsten überwiegend positiven Seiten, die auch gebührend gewürdigt werden; aber wo Licht ist, ist eben auch Schatten.
Wer mir vorwerfen sollte, der Organisation durch das offene Ansprechen ihrer Probleme zu schaden, geht fehl; denn ich würde ihr vielmehr schaden, wenn ich wichtige Erkenntnisse aus Gefälligkeitsgründen verschwiege. Dann ginge ich zwar nicht das Risiko ein, daß manche auf mich beleidigt sind (oder überhaupt alle); aber die ganze Arbeit wäre dann völlig umsonst und eigentlich zutiefst sinnlos. Denn Kritik - selbstredend konstruktive Kritik, die argumentativ begründet wird - ist immer die Voraussetzung für Verbesserungen, und genau diese sollen eben im P.R.-Bereich erzielt werden; deshalb mache ich das Ganze ja überhaupt!
Ich betone also nochmals ausdrücklich, daß meine Intentionen immer positiv sind, sowohl gegenüber der Organisation in ihrer Gesamtheit, als auch gegenüber jeder einzelnen Person, die für sie aktiv ist. Man soll dies bei der Lektüre meiner Arbeit immer berücksichtigen und auch ja nicht vergessen, selbst wenn ich einmal meine “Samthandschuhe” ausziehe und schonungslos sozialwissenschaftliche Analysemethoden an die Organisation anlege, die möglicherweise auch Defizite zutage bringen. Man soll dies nicht persönlich nehmen; man läßt sich ja auch nicht von einem Arzt gründlich untersuchen, um dann von ihm aus Gefälligkeit über den eigenen Gesundheitszustand angelogen zu werden; damit will ich nicht sagen, daß das UZF krank wäre, genau das Gegenteil ist der Fall; aber ich will damit sagen, daß man keinen P.R.-Berater braucht, der P.R.-Probleme, wenn er sie erkennt, nicht anspricht, nur weil er irgendjemandem schmeicheln will. In gewisser Weise ist das auch ein Prüfstein für die Zukunft, denn wer Kritik nicht aushält, sollte überhaupt erst gar nicht in die Öffentlichkeit gehen; gerade vor diesem “Tribunal” muß man nämlich immer auf scharfe Reaktionen gefaßt sein, umso mehr, je erfolgreicher man wird. Und außerdem ist es besser, man diskutiert alle potentiellen P.R.-Probleme intern gleich im Vorfeld aus, als dann später vor Publikum.
Doch zunächst ist dies noch nicht relevant, denn im Zuge meiner historischen Forschung habe ich meiner Ansicht nach einen wahren Schatz gehoben, der ohnehin geeignet ist, das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) in hellem Lichte erstrahlen zu lassen - nämlich das Leben und Werk des Gründers des Universitätszentrums, des Philosophen Leo Gabriel; und ich bin froh, daß ich auf Basis meines ersten Magisteriums in Philosophie die Kompetenz mitbringe, seine zwar noch immer weitgehend ignorierte, aber tatsächlich vorhandene Bedeutung für die Geistesgeschichte erkennen und umfassend würdigen zu können. Ich denke, daß das UZF gut daran täte, sich auf Leo Gabriels Ideen und Taten zu besinnen, obwohl sie - weil der Prophet bekanntlich an der eigenen Universität nichts gilt - schmählicherweise schon fast vergessen sind. Dennoch wirken sie in allem, was das UZF bis heute tut, unbemerkt nach.
Gerade das nun folgende Kapitel, obwohl scheinbar vom Thema weit entfernt, wird sich in weiterer Folge für die Lösung meiner oben beschriebenen Forschungsaufgabe - die Erstellung eines P.R.-Konzeptes für das UZF - noch als sehr bedeutsam erweisen, trotz der Tatsache, daß es bei oberflächlicher Betrachtung der Diplomarbeit zunächst so aussieht, als hätte ich die eigentliche Aufgabe der Arbeit aus den Augen verloren und würde mich “verzetteln”. Das geschieht aber zu keiner Zeit, denn ich weiß immer ganz genau, was ich tue; und wer anderes meint, kennt mich ebenfalls schlecht.
Worin die Bedeutung der Aufarbeitung von Leo Gabriels Leben und Werk besteht, die - trotz bedeutender und unverzichtbarer Vorarbeit anderer - meines Wissens noch nirgends so umfassend dargestellt ist wie hier, wird man v.a. im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit erfahren, wenn es um die Ausarbeitung eines Unternehmensleitbildes für das “Universitätzentrum für Friedensforschung” (UZF) geht, dessen Erstellung ohne besagte Rückbesinnung aus verschiedensten Gründen niemals möglich sein kann, v.a. weil man im gegenwärtigen UZF, so mein persönlicher, aber nicht unbegründeter Eindruck, sich teilweise in Unklarheit über die eigene Mission befindet. Da der Gründer diese Mission aber einst deutlich vor sich gesehen hat, kann die folgende Aufarbeitung dazu geeignet sein, eindeutig Klarheit über Werte und Ziele der Organisation zu schaffen.
Nun aber will ich in den ersten der “vier Schritte” eintreten, in die Bestandsaufnahme, die jenen von Cutlip, Center und Broom aufgestellten Kriterien zu genügen versucht und entsprechend, wie gefordert, wiederum ihrerseits aus drei Teilen besteht: Situationsanalyse, Problemanalyse und Kommunikationsprüfung.
Schritt 1:
Bestandsaufnahme
Situationsanalyse
1. Der Gründer: Leo Gabriel
1.1. Zur Wichtigkeit einer Rückbesinnung
Eine der Stärken des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) und ein Umstand, der die Vereinigung von anderen gegenwärtigen Friedensorganisationen maßgeblich unterscheidet, ist, daß das UZF nicht vor allzu kurzer Zeit von Namen- und Bedeutungslosen aus dem Boden gestampft worden ist, sondern eine jahrzehntelange und wesentlich ehrwürdigere Tradition repräsentiert.
Das grundlegende Ethos des UZF (die “Wahrheit des Ganzen”) ist engstens verknüpft mit Leben und Werk seines Gründers, Leo Gabriel, eines im Wien der Nachkriegszeit wirkenden Philosophen, dessen Werk damals einen nicht unbeträchtlichen, zunächst regionalen Bekanntheitsgrad erlangte. Obwohl gegenwärtig innerhalb wie außerhalb der von ihm gegründeten Organisation die Gefahr einer zunehmenden Verdrängung seiner Ansätze besteht, lohnt eine Rückbesinnung auf Gabriels Denken allemal. Denn es handelt sich nicht nur um einen faszinierenden, meiner Meinung nach für die abendländische Geistesgeschichte bedeutsamen und leider noch immer weitgehend ignorierten Versuch, einen Wahrheitsbegriff zu erarbeiten, der zahlreiche Probleme der bisher bekannten Ansätze zu überwinden vermag (um freilich seinerseits neue Probleme aufzuwerfen), auch empfehlen sich seine Ideen wegen ihrer großen praktischen Anwendbarkeit auf dem Feld der Diplomatie, Mediation, Politik etc.
Eine Rückbesinnung auf die Gründerpersönlichkeit einer Organisation ist für diese aus der Perspektive der P.R. aber nicht zuletzt auch für die Entwicklung und Festigung einer Corporate Identity entscheidend. Man darf niemals vergessen, daß das Bewußtsein einer gemeinsamen Geschichte wahrscheinlich der wesentlichste Bestandteile eines “Wir-Gefühls” ist, dessen bloßes Vorhandensein die Effizienz des öffentlichen Auftretens einer Vereinigung erhöht.
Aus all diesen Gründen habe ich Leben und Werk Leo Gabriels aufgearbeitet; und im folgenden soll ausführlich davon die Rede sein.
1.2. Die schwere Kindheit eines Philosophen
Leo Gabriel wurde am 11.9.1902 in Wien geboren. Er stammt aus einfachsten Verhältnissen. Beide Elternteile starben früh, er kannte sie kaum und sie hinterließen ihm nichts. Als Waisenkind wurde er von der Obrigkeit der damaligen Donaumonarchie in die Südsteiermark zu einer Pflegefamilie geschickt. Möglicherweise hängt die Wahl des Ortes damit zusammen, daß in der Südsteiermark eine große slowenische Minderheit lebt und man die “deutschösterreichischen” Elemente durch die Ansiedelung von Waisenkindern systematisch stärken wollte. Von seiner Pflegefamilie wurde Gabriel in erster Linie als billige Arbeitskraft auf ihrem Bauernhof betrachtet. Obwohl er später von dieser schweren Zeit niemals gerne sprach, kann aus seinen spärlichen Berichten geschlossen werden, daß er zu Kinderarbeit mißbraucht und regelmäßig geprügelt wurde.
Dennoch erhielt er die Möglichkeit, zumindest in gewissem Ausmaß die dörfliche Volksschule zu besuchen. Dabei kam es zu einer schicksalshaften Begegnung, die ihm wesentliche Möglichkeiten für die Zukunft eröffnete: Der Kaplan des Ortes wurde auf den begabten, aber völlig mittellosen Knaben aufmerksam und nahm sich seiner an. Er überzeugte die Pflegeeltern, möglicherweise mit Verweis auf ihr künftiges Seelenheil, von der Notwendigkeit, den Jungen auf ein Gymnasium zu schicken. Seiner Initiative ist es zu verdanken, daß Gabriel nach Graz kam, wo er in das Fürstbischöfliche Gymnasium (ein katholisches Knabeninternat) eintreten konnte, finanziell unterstützt von Organisationen der Katholischen Kirche, insbesonders vom Jesuitenorden, dem besagter Kaplan nahestand. Sein Schützling, so lautete der gutgemeinte Plan des Mentors, sollte dereinst katholischer Priester werden.
1.3. Studium in Innsbruck
Der Jesuitenorden ermöglichte Leo Gabriel ein Studium an der Universität Innsbruck; die Wahl des Studienortes beinhaltet insoferne eine gewisse Logik, weil die katholisch-theologische Fakultät dieser Universität bis heute als “Jesuiten-Fakultät” bekannt ist und auch damals ein geistiges Zentrum des Ordens darstellte. Die Endphase seines Studiums absolvierte Gabriel traditionsgemäß in Rom - ein Studienaufenthalt in Rom war zumindest damals obligatorische Voraussetzung für die Übernahme künftiger innerkirchlicher Führungsaufgaben.
Im Jahre 1926 erwarb er den Doktorgrad in scholastischer Philosophie (Doctor philosophiae scholasticae, Abkürzung Dr.phil.schol. - es handelte sich dabei um einen von der theologischen Fakultät vergebenen philosophischen Titel. Einen solchen gibt es sehr zum Ärger der meisten österreichischen Geisteswissenschaftler, die ihrerseits keine theologischen Titel verleihen dürfen, als Innsbrucker Spezifikum noch immer, die genaue Bezeichnung lautet heute aber Dr.phil.fac.theol. also Doctor philosophiae facultatis theologicae).
Aus Gabriels Innsbrucker Studienzeit gibt es einiges zu berichten, zum Beispiel, daß er sich schon damals für wissenschaftstheoretische Fragestellungen interessierte, wobei ihm v.a. vom Jesuiten Alois Gatterer, seinem ersten Doktorvater, die Methoden der Naturwissenschaften, insbesonders der Biologie und Chemie vermittelt wurden. Es zeigte sich aber auch Gabriels Begeisterung für die Diskussion, den Dialog: Es war damals in Innsbruck üblich, philosophische Streitgespräche nach mittelalterlichem, scholastischem Muster zu führen, d.h. einerseits in lateinischer Sprache, andererseits in Rede und Gegenrede. Gabriel, so heißt es, übernahm dabei besonders gerne die Rolle des “adversarius”, dessen Aufgabe darin bestand, die vom Gesprächspartner aufgestellten philosophischen Thesen zu bekämpfen und zu widerlegen.
Besonders bemerkenswert ist allerdings eine Entscheidung des jungen Mannes am Ende seines Studiums, die die Weichen für sein künftiges Leben stellen sollte. Sie kann wahrscheinlich als seine erste wirklich autonome Entscheidung betrachtet werden, nachdem er aufgrund seiner schlimmen Ausgangssituation jahrelang dem Willen anderer folgen mußte: Nach seiner Promotion verweigerte er die Weihung zum katholischen Priester, für die er eigentlich von seinen ihm zweifellos wohlmeinenden Förderern “vorherbestimmt” gewesen war.
Gabriels Weigerung, den ihm zugedachten Weg der Priesterlaufbahn einzuschlagen, hatte mit ziemlicher Sicherheit nichts mit einer plötzlichen Ablehnung der Religion, radikalen Glaubenszweifeln oder ähnlichem zu tun. Vielmehr blieb er Zeit seines Lebens ein tiefgläubiger Mensch, ging auch regelmäßig in die Kirche etc. Zudem schied er nicht im Streit von seinen Förderern, sondern blieb ihnen auch später in lebenslanger Freundschaft und Dankbarkeit für ihre Hilfe verbunden.
Die Entscheidung lag vielmehr darin begründet, daß Gabriel den Weg des zölibatären Lebens nicht als den seinen empfand. Er wollte, seinen angeborenen Bedürfnissen folgend, heiraten und eine Familie gründen; und ich glaube persönlich, daß es Unrecht wäre, ihm aus dieser nachvollziehbaren und zweifellos menschlichen Entscheidung einen Vorwurf zu machen. Es muß lobend festgestellt werden, daß Gabriel von seinem Orden weiterhin finanzielle Unterstützung erhielt; so konnte er seine Studien fortsetzen und seine Ausbildung einerseits umorientieren, andererseits vervollkommnen.
1.4. Fortsetzung der Ausbildung: Wiener Jahre
Der Mittzwanziger inskripierte ein Philosophie-Lehramtsstudium mit dem Zweitfach Geschichte an der Universität Wien. Er promovierte dort 1929 ein zweites Mal (diesmal zum Dr.phil.) mit einer Dissertation bei Heinrich Gomperz über den Gottesbegriff Plotins.
Seit dieser Zeit ist Gabriels Wirken untrennbar mit der österreichischen Hauptstadt verknüpft, in der er den größten Teil seines künftigen Lebens zubringen sollte. Und Gabriel erhielt in Wien enorme intellektuelle Anregungen; man darf nicht vergessen, daß das Wien der Zwischenkriegszeit ein geistiges Zentrum außergewöhnlicher Blüte war, in dem Denker von Weltrang lebten und wirkten. Besonders folgenreich wurde Gabriels Begegnung mit Moritz Schlick, einem der Hauptprotagonisten des “Wiener Kreises”, bei dem er die Staatsprüfung für das Lehramt ablegte.
Schlick und seine Gefolgsleute hatten u.a. in Auseinandersetzung mit Wittgensteins “Tractatus logico-philosophicus” den Positivismus des 19.Jahrhunderts zum sogenannten “Neopositivismus” weiterentwickelt.
Wittgensteins philosophisches Hauptanliegen war - in seiner frühen Philosophie - die Schaffung einer Art “perfekten” Sprache, die als Spiegel der Welt fungieren soll. Jedem Gegenstand in dieser Sprache entspricht ein Begriff; es gibt einen empirisch feststellbaren, wissenschaftlichen Rückbezug auf die Realität. Die Verhältnisse, in denen sich die Gegenstände befinden, werden zunächst in sogenannten Elementarsätzen ausgedrückt, das sind Satzatome, die nicht mehr weiter reduzierbar sind, ohne den Charakter eines Satzes zu verlieren, z.B. Müller ist reich. Diese Satzatome werden nun durch gewisse logische Operationen miteinander kombiniert. Wittgensteins Sprache folgt also streng wissenschaftlichen Kriterien und schaltet jedes sinnlose “Geschwätz” aus. Man kann in dieser Sprache nur sagen, was sich (wissenschaftlich) sagen läßt; über den Rest, meint Wittgenstein, hat man zu schweigen. Es fällt der Mystik anheim und ist unartikulierbar - wie z.B. Gott. Philosophie ist eine Tätigkeit, die dem wissenschaftlich Sagbaren eine Grenze zieht und die faulen, also unwissenschaftlichen Stellen aus der Sprache entfernt. Sie gleicht daher in gewisser Weise - so ein späteres Bild Wittgensteins - dem Apfelschälen.
Der “Wiener Kreis” um Schlick ging mit Wittgenstein zunächst weitgehend d’accord. Er führte alles Wissen auf empirisch-experimentelle Forschung und darauf aufbauende logisch-mathematische Ableitungen zurück. Wichtig wurde v.a. die Kriterienlehre, durch die wissenschaftliches Sprechen vom Unsinn getrennt werden sollte. Die Kriterien waren dabei v.a. empirische Kontrolle, Intersubjektivität, Widerspruchsfreiheit etc. Alle Aussagen wurden vom “Wiener Kreis” in drei Gruppen eingeteilt: Analytische Aussagen sind in sich selbst begründet, wie z.B. der Kreis ist rund. Synthetische Aussagen sind aus Erfahrung gewonnene Sätze der Naturwissenschaft. Metaphysische Aussagen sind durch das Experiment unbeweisbare Aussagen, die aus dem Denken und Sprechen ausgeschieden werden sollten. Der “Wiener Kreis” hat mit Wittgensteins Philosophie gemeinsam, daß er nur wissenschaftliche Aussagen als sagbar zuläßt und alles andere in das Schweigen verbannt. Der Unterschied ist allerdings der, daß der “Wiener Kreis” das auf diese Art Nicht-Sagbare wie die Religion geringschätzte, während der tiefgläubige Wittgenstein einen Zugang zur Weisheit in der Versenkung in das Schweigen suchte. Für den “Wiener Kreis” gab es aber nur innerhalb der Wissenschaft Erkenntnis. Jede Art spekulativer Metaphysik war für ihn eine irrationale Ausweitung des Denkens. Er definierte in diesem Zusammenhang entsprechend das Empiristische Sinnkriterium, das besagt, daß jede nicht empirisch verifizierbare Aussage eine “sinnlose Aussage” ist und daher eben verworfen werden muß. Darunter fallen naturgemäß alle Aussagen der Theologie, Ethik und Ästhetik.
Das Problem dieses Ansatzes hat niemand klarer gesehen als Wittgenstein selbst. Wenn man nur mehr über das sprechen darf, was sich wissenschaftlich beweisen läßt (und man Wissenschaft dazu noch sehr eng definiert, nämlich im Prinzip reduziert auf empirische Beobachtungen und formalwissenschaftliche, d..h. mathematische und logische Operationen), und über alles übrige schweigen muß, kann man die wichtigsten menschlichen Lebensprobleme nicht mehr sprachlich thematisieren, geschweige denn bewältigen. Mit einer solch “perfekten” Sprache können wir uns weder über Moral, noch über Politik, noch über Kunst und schon gar nicht über Religion unterhalten, sondern wir können höchstens die Verweigerung eines Dialoges darüber artikulieren. Eine Kommunikationsform, die aber ohne Zusammenhang mit all jenem steht, was die Menschen innerlich bewegt und interessiert, ist eigentlich völlig sinnlos - eine Erkenntnis, die Wittgenstein in späteren Lebensjahren zu einer Modifikation und Erweiterung seiner Ansätze führen sollte. Der sich mit Wittgenstein auseinandersetzende “Wiener Kreis” war seinem “Meister” intellektuell letztendlich nicht ebenbürtig und hat diese Problematik niemals bewältigt.
Gabriel, der ein persönlich ausgezeichnetes Verhältnis mit Schlick hatte, war inhaltlich völlig anderer Meinung als sein Lehrer. Seiner Ansicht nach war der Wissenschaftsbegriff des “Wiener Kreises” einfach zu eng. Genau das von Wittgenstein selbst genannte Argument der tiefen Sinnlosigkeit eines so engen Wissenschaftsbegriffs für das menschliche Dasein war für Gabriel schlagend.
Das umgekehrte, ebenso von ihm abgelehnte Extrem erblickte Gabriel in der Philosophie Martin Heideggers, mit dem er später trotz Meinungsverschiedenheiten ebenfalls eng befreundet sein sollte. (Es war übrigens schon damals ein charakteristischer Wesenszug Gabriels, daß er fachliche Meinungsverschiedenheiten einfach nicht persönlich nahm). Heideggers Philosophie beruht weitgehend auf Intuition, ist in dunklen, schwer verständlichen und mehrdeutigen Worten formuliert und beinhaltet “logische” Schlüsse, die intersubjektiv kaum nachvollziehbar sind - ein kurzer Blick in “Sein und Zeit” genügt, um zu wissen, was gemeint ist. Ein solches Konzept von wissenschaftlicher Methodik erschien Gabriel viel zu unwissenschaftlich, so eine Methodik bei Heidegger überhaupt vorhanden sein sollte (Heidegger hatte immerhin einmal gemeint “Die Logik löst sich auf...”).
Gabriel plädierte zeitlebens für eine Synthese dieser beiden Extreme: Es müßte doch möglich sein, meinte er, einen Begriff von Wahrheitserkenntnis und wissenschaftlicher Forschung zu entwickeln, der einerseits wissenschaftlich ist, d.h. mit einer intersubjektiv nachvollziehbaren Methode arbeitet und sehr wohl auch eine Trennung von begründeter Erkenntnis und Falschinformation erlaubt, der aber andererseits wieder nicht so eng ist, daß er keine wirkliche Bedeutung mehr für die menschlichen existentiellen Probleme hat. Einen solchen Wahrheitsbegriff zu finden machte er sich selbst zur künftigen Lebensaufgabe.
Ab 1932 war Gabriel Lehrer für Philosophie und Geschichte am Gymnasium in der Schopenhauerstraße im 18.Wiener Gemeindebezirk und auch politisch aktiv. Aus seiner Sozialisation in der Katholischen Kirche und der sicherlich nicht völlig ausgewogenen und unparteiischen Erziehung als Waisenkind in einem jesuitischen Knabeninternat wird verständlich, warum er damals dem bürgerlichen, katholischen, konservativen Lager nahestand. Das bürgerliche Lager in Österreich dachte und handelte damals bekanntlich nicht gerade demokratisch; 1933 putschte der christlichsoziale Kanzler Dollfuß und begründete ein kurzlebiges Regime, den vom autoritären Katholizismus geprägten “Austrofaschismus”, der 1938 von den Nazis beseitigt und durch eine viel schlimmere Regierungsform abgelöst wurde.
Gabriel kann daher aus heutiger Perspektive der Vorwurf gemacht werden, als junger Mann der austrofaschistischen Bewegung nahegestanden zu sein und diese aktiv unterstützt zu haben. Er war Mitglied der Vaterländischen Front und als politischer Funktionär v.a. im Bildungsbereich tätig, mit einer teilweisen Zuständigkeit für die Volkshochschulen. Dieser Vorwurf wiegt schwer, waren doch in Österreich die Austrofaschisten die ersten, die die Demokratie zerstörten und Verfolgungen politischer Gegner anzettelten.
Ich hielte es allerdings für einen Fehler, Gabriels spätere Philosophie der Toleranz wegen seines einstigen politischen Engagements zu verwerfen. Vielmehr gebe ich zu bedenken, daß die Größe eines Menschen ja nicht darin besteht, niemals Fehler zu begehen, sondern darin, aus ihnen zu lernen. Und es waren eben die Erfahrungen der Zwischenkriegszeit, die Gabriel, der dereinst selbst ein einigermaßen verstockter Ideologe gewesen war, später zu einem massiven Umdenken bewegen sollten. Denn die Lagerkämpfe zwischen Sozialdemokraten und Bürgerlichen, die 1934 Österreich sogar in einen Bürgerkrieg trieben, führten ihm deutlich vor Augen, daß es Spaltung und schließlich Untergang einer politischen Gemeinschaft zur Folge hat, wenn man seine eigenen Überzeugungen so absolut setzt, daß man Menschen, die eine andere Meinung vertreten, knebelt und unterdrückt, anstatt in einen Dialog mit ihnen einzutreten, sie in die Politik einzubinden und Kompromisse mit ihnen zu schließen. Entsprechend begann Gabriel später - in Korrektur seiner eigenen politischen Fehler - Toleranz, Dialog und Versöhnung glaubhaft zu vertreten, was ihn eben zur Friedensforschung bringen sollte. Und vielleicht muß man selbst einmal ein Ideologe gewesen sein, um die Grenzen und Defizite jeglichen Fanatismus’ zu erfahren. In diesem Zusammenhang erscheint mir der Hinweis angebracht, daß Gabriels Zeitgenosse Karl Popper, der Philosoph der “offenen Gesellschaft”, an dessen Aufrichtigkeit im Kampf für Demokratie und Freiheit kein Kenner seiner Werke zweifelt, in seiner Jugend kurzzeitig Kommunist gewesen ist. Für mich ist dies ein Anzeichen dafür, daß man eben nicht als guter Demokrat vom Himmel zu fallen pflegt; Verständnis von Demokratie ist ein langer und wahrscheinlich niemals ganz abgeschlossener Lernprozeß, der Reife, Einsicht, Vernunft und redliches Streben nach einem besseren Zusammenleben der Menschen zur Voraussetzung hat.
Eine wesentliche Motivation für Leo Gabriels Engagement für den sogenannten “Ständestaat” war aber auch seine von Anfang an vorhandene Gegnerschaft zum aufstrebenden Nationalsozialismus. Das bürgerliche Lager in Österreich hatte ja nicht zuletzt deshalb zu einer autoritären Lösung gegriffen, weil es glaubte, die nationalsozialistische Bedrohung auf diese Art effizienter abwehren zu können. Aus heutiger Perspektive lag freilich diesbezüglich eine Fehleinschätzung vor, was Gabriel später auch erkannte. Neueste historische Forschungsergebnisse zeigen, daß die Austrofaschisten, trotz ihrer Motivation, die Nazis aufzuhalten, durch ihre politischen Handlungen eigentlich den Boden für sie bereiteten. Viele Arbeiter des damaligen Österreich wären bereit gewesen, gegen Hitler und für die Unabhängigkeit ihrer Heimat, aber sicherlich nicht für eine bürgerliche Diktatur die Waffen zu ergreifen, die sie politisch unterdrückte. Das Verbot der Sozialdemokratie und die Verhaftung ihrer maßgeblichen Persönlichkeiten, die sich - wie der spätere Bundeskanzler Kreisky - ihre Zellen während der austrofaschistischen Ära oftmals mit Nazis teilen mußten, spalteten daher das Land und machten es verteidigungsunfähig. Dennoch muß man Gabriel hinsichtlich seines politischen Engagements zumindest die lobenswerte Intention zugutehalten, daß er einen Beitrag gegen den Aufstieg des Nationalsozialismus leisten wollte, auch wenn er hinsichtlich der tatsächlichen Folgen seiner Handlungen offensichtlich - wie viele andere - einem Irrtum oblag.
In das Jahr 1938 fällt die Heirat Leo Gabriels mit der um vier Jahre jüngeren Johanna, geboren Straka - wie bereits gesagt, hat Gabriel für die Möglichkeit einer Ehe die ihm ursprünglich zugedachte Bestimmung zum Priesteramt aufgegeben. Johanna Straka war früher Sekretärin im Niederösterreichischen Bauernbund gewesen und hatte u.a. auch für den späteren österreichischen Bundeskanzler Figl gearbeitet. Dieser war in der Zwischenkriegszeit bekanntlich für das bürgerliche Lager ebenfalls politisch tätig gewesen, bevor ihn die Nazis ins Konzentrationslager steckten, das er nur knapp überlebte. Gabriels Ehefrau kam also auch aus einem katholisch-konservativen Umfeld, nach der Heirat wurde sie auch entsprechend traditionell Hausfrau und Mutter. Mit ihr hatte Gabriel später auch zwei Söhne, nämlich Werner (geb.1941) und Leo (geb.1945).
Der ältere Sohn hat mittlerweile eine ähnliche berufliche Laufbahn wie sein Vater eingeschlagen und ist heute Professor für Philosophie an der Universität Wien mit dem Spezialgebiet außereuropäische Philosophie. Der zweite Sohn ist Direktor des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Lateinamerika und freier Journalist. Es fällt auf, daß die Söhne des Philosophen einen nicht unbeträchtlichen Teil ihres Lebens der Erforschung außereuropäischer Kulturen widmen; möglicherweise entspringt dieser Umstand dem in der späteren Philosophie des Vaters entwickelten Bewußtsein, daß auch uns Europäern ein Teil der umfassenden Wahrheit “fehlt” - und wir daher gut daran täten, diesen Teil bei anderen Völkern zu suchen, anstatt den Nicht-Europäern mit ungerechtfertigtem Dünkel und anmaßender Geringschätzung zu begegnen. Es tut der Größe unserer Kultur keinen Abbruch, wenn wir die Größe einer anderen anerkennen.
1.5. Gegen Nazis und Weltkrieg
Leo Gabriel war, wie bereits festgestellt, von Anfang an ein strikter Gegner des Nationalsozialismus, dessen Verherrlichung der Gewalt und dessen Haß auf das Fremde er zutiefst verabscheute. Er erblickte im Nationalsozialismus eine Verneinung aller ihm teuren Prinzipien der Nächstenliebe, des Mitleids und der Menschlichkeit. Die Nationalsozialisten wußten um Gabriels mangelnde Regimetreue, war dieser doch zuvor auch politischer Funktionär eines feindlichen Systems gewesen; und er bekam ihre Feindschaft auch zu spüren, freilich nicht so heftig wie viele andere Nazi-Gegner oder Bürger jüdischer Abstammung.
Zunächst wurde er von den Nazis als Gymnasiallehrer aus politischen Gründen strafversetzt, nämlich an eine weitaus weniger prestigeträchtige Schule in Wien Simmering. Außerdem bekam er massive Probleme mit der Gestapo und konnte nur knapp einer Verhaftung entgehen. Schließlich wurde er - gegen seinen Willen - zur Wehrmacht eingezogen. Gabriel hatte keine Möglichkeit, sich dem Militärdienst in diesem von ihm als ungerecht empfundenen Krieg zu entziehen. Um sich nicht an den Verbrechen der Nazis aktiv beteiligen zu müssen, unternahm er alles, um zum Sanitätsdienst zugeteilt zu werden, was ihm auch gelang. Diese Wahl hatte auch einen anderen Grund. Eines von Gabriels Lebensprinzipien war die Gewaltlosigkeit. Er lehnte es aus moralischen Gründen ab, ein Gewehr in die Hand zu nehmen und auf Menschen zu schießen, denn er war überzeugt davon, daß man eventuelle Konflikte auch anders lösen konnte. Als Sanitäter war er des Schießens enthoben; und auch während seiner Grundausbildung versuchte er das Schießen zu vermeiden, wo er nur konnte.
Er selbst hat später oft die Anekdote erzählt, daß er im Laufe seiner Grundausbildung an einem Tag, an dem er hätte schießen sollen, einfach im Bett geblieben sei - ein Verhalten, das eine offene Befehlsverweigerung darstellte und mit massivsten Strafen geahndet wurde. Der ihm vorgesetzte Unteroffizier wäre allerdings so verblüfft über dieses Verhalten gewesen, daß er es nicht weitermeldete. Aus heutiger Sicht kann nicht mehr beurteilt werden, ob die Erzählung in dieser Form stimmt; aber daß Gabriel sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit vor dem Schießen gedrückt hat, kann unzweifelhaft angenommen werden. Und sicher wäre es gut gewesen, wenn sich während dieses ungerechten Kriegs alle Beteiligten vor ihrer vermeintlichen vaterländischen Pflicht, gegen die Prinzipien der Menschlichkeit zu verstoßen, einfach gedrückt hätten.
Es bleibt noch zu bemerken, daß Gabriel während der Nazizeit auch im Widerstand tätig war - als Mitglied des illegalen CV. Die Organisation ist heute eine ÖVP-nahe Akademikervereinigung, damals war sie verboten und ein Zentrum des christlich motivierten Widerstandes gegen den nationalsozialistischen Ungeist.
1.6. Universitätslaufbahn nach 1945
Nach dem Krieg wurde Gabriel zunächst wieder als Lehrer an seinem alten Gymnasium in der Schopenhauerstraße tätig. Seine intensive wissenschaftliche Forschungsarbeit, seine zahlreichen Publikationen und die Gründung einer eigenen philosophischen Fachzeitschrift (“Wissenschaft und Weltbild”) ebneten ihm aber in kürzester Zeit den Weg für eine beachtliche Karriere an der Universität Wien.
Bereits 1947 habilitierte er sich für Philosophie bei Alois Dempf mit einer Arbeit zur “Logik der Weltanschauungen”, welche die Lehren, die er aus den eigenen Fehlern der Zwischenkriegszeit gezogen hatte, erstmals anschaulich dokumentierte. Es handelt sich bei dieser Arbeit um ein Plädoyer für Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Gabriel fordert in ihr, daß die Defizite einer jeden Ideologie, die immer nur einen Teilaspekt der Wahrheit erkennt, durch die Stärken der ihr entgegengesetzten Ideologie ergänzt werden müssen, ein erster Schritt zu seinem Konzept der “Wahrheit des Ganzen”, von dem im nächsten Abschnitt ausführlich die Rede sein soll. 1948 gab er seine Gymnasiallehrerstelle endgültig auf, 1950 wurde er außerordentlicher, 1951 ordentlicher Universitätsprofessor. Er übernahm auch die Funktion eines Vorstands des Instituts für Philosophie an der Universität Wien.
Gabriel war nach Berichten von Zeitzeugen ein hervorragender Redner. Eine ehemalige Studentin von ihm, die heute eine Führungsposition im “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) innehat, bezeichnete seine Vorlesungen im Gespräch mit mir als ein “Feuerwerk”. Mir wurde von einem anderen Interviewpartner unabhängig davon versichert, ihm seien eine ganze Reihe ehemaliger Hörer bekannt, die sich heute noch mit Begeisterung an Gabriels mitreißende Rhetorik erinnern würden.
Der Erfolg seiner öffentlichen Vorlesungen war entsprechend groß, seine Vorträge an Katholischer Akademie und Volkshochschule wurden in der unmittelbaren Nachkriegszeit echte Massenveranstaltungen (dies war nicht zuletzt auch deshalb möglich, weil nach den Jahren der Diktatur, Zensur und Unterdrückung die Menschen intellektuell “ausgehungert” waren - so war das Interesse für Bildung allgemein größer als heute).
Gabriels wissenschaftliche Interessen waren vielfältig und zeigten seine umfassende Aufgeschlossenheit: Er beschäftigte sich mit der Existenzphilosophie, der Philosophie des naturwissenschaftlichen Denkens (z.B. der Relativitätstheorie), der Psychoanalyse, der modernen Kunst, der außereuropäischen Philosophie und den Grundlagen des Kommunismus. Da er all diesen Ansätzen auch einen gewissen Anteil an einer umfassenden Wahrheit zubilligte, wurde er bald von manchen Teilen der Kirche, der er immer treu geblieben ist, als Ketzer angesehen.
Im Jahre 1968 war Leo Gabriel Präsident des renommierten “Weltkongresses der Philosophie”, den er in diesem Jahr nach Wien brachte. Es war das Jahr des Prager Frühlings und der Studentenproteste und die heftigsten politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen Ost und West brachen bei diesem internationalen Forschertreffen auf. Gabriel führte den Vorsitz über den Kongreß anerkanntermaßen souverän, wobei er zwischen allen Gruppen zu mediieren versuchte. Er konnte dabei Kontakte nach Osteuropa knüpfen, die den “Friedensdialog zwischen Christen und Marxisten” des von ihm gegründeten “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) erst ermöglichen sollten - doch davon soll später die Rede sein. Diese wertvollen Kontakte konnten im darauffolgenden Jahr noch vertieft werden, als Leo Gabriel auch die Präsidentschaft des philosophischen Weltkongresses in Varna, Bulgarien übernahm. Ab 1968 wurde Gabriel auch Präsident der “Fédération international des Sociétés de Philosophie”.
Die Gründung des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) als praktische Umsetzung seines philosophischen Ansatzes der “Wahrheit des Ganzen” erfolgte 1973, wobei auf das Gründungsereignis und die darauf folgende historische Entwicklung im Kapitel 2 noch näher eingegangen werden soll.
Gabriel war ein politisch engagierter Mensch und z.B. an den Verhandlungen über die damalige österreichische Schulgesetzgebung maßgeblich beteiligt. Damals sensationell war auch sein als Mitglied einer Delegation der Katholischen Kirche betriebener Friedensdialog mit den Orthodoxen. Papst Johannes Paul II. hat sich erst jüngst auf einer Reise in die Ukraine um Überwindung von alten Differenzen mit der Ostkirche bemüht - und stieß heute noch auf große Hindernisse und Widerstände. Gabriel war mit seinen damaligen Versöhnungsinitiativen seiner Zeit und sogar unserer Gegenwart weit voraus, obwohl sie rückblickend nur als ein kleiner Schritt auf einem langen, noch zu vollendenden Weg betrachtet werden können. Insgesamt kann man sagen, daß er großen Wert darauf legte, seine philosophischen Erkenntnisse, insbesonders die Wertschätzung des Friedens, des Dialoges und der Offenheit für andere Meinungen, auch in die Praxis umzusetzen.
1.7. Die “Wahrheit des Ganzen”
Leo Gabriel entwickelte sein Konzept der “Wahrheit des Ganzen” anhand einer Analyse gegensätzlicher philosophischer Positionen, die im Laufe der Geistesgeschichte vertreten worden waren. Er gewann den Eindruck, daß an jeder der gegensätzlichen Positionen etwas “fehlte”, obwohl jede einzelne zweifellos einen Teil einer umfassenderen Wahrheit widerspiegelte und daher auch nicht direkt als “falsch” zu bezeichnen war.
Ich möchte diese Beobachtung an einem Beispiel aus der Philosophiegeschichte illustrieren, wobei ich nicht sagen kann, ob sich Gabriel genau darauf bezogen hat. Das Beispiel erscheint mir allerdings geeignet, seinen Standpunkt anschaulicher darzustellen.
In der englischen Moralphilosophie des 18.Jahrhunderts gab es einen Streit über die Natur des Menschen. Vereinfacht gesagt vertrat Thomas Hobbes die Meinung, daß der Mensch von Natur aus schlecht sei. Ein berühmtes Zitat von ihm lautet “homo homini lupus”. Der Mensch, sagt Hobbes, verhält sich dem Menschen gegenüber wie ein Wolf, wie eine reißende Bestie. Die Menschen sind seiner Meinung nach egoistische, habgierige Triebwesen, die ohne Zögern Verbrechen gegen ihre Mitmenschen begehen, wenn sie nicht die Angst vor Strafe davon abhält. Entsprechend braucht man eine starke Obrigkeit, die die Menschen im Zaum hält und verhindert, daß diese sich in einem “Krieg aller gegen alle” gegenseitig zerfleischen. Er versuchte die Schlechtigkeit der Menschen anhand zahlloser Beispiele zu belegen, was ihm nicht sehr schwer fiel.
Demgegenüber vertraten die Philosophen Shaftesbury und (in Anknüpfung an diesen) Hutcheson die Meinung, daß der Mensch ein zum Mitleid, zur Barmherzigkeit und zur Liebe fähiges Wesen sei. Das von ihnen vertretene Menschenbild ähnelt weniger dem Wolf als der Taube. Und sie berichten von beispielloser Aufopferung, zu der Menschen für andere fähig sind.
Welcher der beiden gegensätzlichen Standpunkte ist nun die “Wahrheit”? Beide nehmen ja für sich in Anspruch, die ganze Wahrheit über den Menschen zu beinhalten; und beide Positionen sind einander so diametral entgegengesetzt, daß man auf den ersten Blick annehmen könnte, sie wären völlig unvereinbar.
Nach Gabriel spiegeln zwei gegensätzliche Positionen aber - trotz ihres falschen Anspruches, die ganze Wahrheit zu beinhalten - eben nur einen Teil der Wahrheit wider. Die “Wahrheit des Ganzen” erhält man, wenn man die beiden gegensätzlichen Positionen zunächst gegeneinander prüft. Das setzt voraus, daß Vertreter der unterschiedlichen Weltanschauungen in einen Dialog miteinander eintreten und daß - um einen solchen Dialog überhaupt erst zu ermöglichen - eine grundsätzliche Offenheit gegenüber anderen, auch gegenteiligen Meinungen vorhanden ist. Überzeugungen, auch die eigenen, sollten also “offene” und nicht “geschlossene” Systeme sein.
Nach einem gewissen Diskussionsprozeß, der gewaltfrei und auf Basis rationaler Argumente geführt wird (schon alleine, um der Wahrheit keine Gewalt anzutun), kann man die Defizite und Einseitigkeiten der einen Position durch die Stärken der jeweils anderen ergänzen. Die scheinbar entgegengesetzten Positionen entpuppen sich dann meist als durchaus miteinander vereinbar; durch die Synthese ist man der tatsächlichen Wahrheit um einen wesentlichen Schritt näher gekommen. Die Annäherung an diese “Wahrheit des Ganzen” bleibt natürlich dennoch ein Prozeß, denn alle anderen Perspektiven wird man im Laufe seines Lebens alleine aus Zeitgründen nicht berücksichtigen können; Wahrheitssuche und Diskussion können also nie wirklich endgültig abgeschlossen sein. Der Mensch bleibt immer ein Suchender, aber es ist auch nicht so sehr das Ziel, sondern eben der Weg zur Wahrheit, nämlich der Dialog von “offenen Systemen”, auf den es ankommt.
Im vorliegenden Beispiel würde man nach einem solchen Diskussionsprozeß wohl ungefähr auf ein ähnliches Ergebnis kommen wie David Hume, der die Positionen Hobbes’ und Shaftesburys bzw. Hutchesons in eine Synthese gebracht und so die Wahrheit über die menschliche Natur eben besser erkannt hat. Er stellte nach reiflichem Gegeneinander-Abwägen der Argumente fest, daß der Mensch sowohl Eigenschaften des Wolfes, als auch der Taube in seiner Psyche vereint, beide Standpunkte also in gewisser Weise wahr sind, aber eben nicht ganz. Und tatsächlich findet man in der Menschheitsgeschichte oder auch im Lokalteil einer Tageszeitung Berichte von Taten, die so schrecklich sind, daß man kaum glauben kann, daß Menschen in der Lage sind, anderen so etwas anzutun. Ich denke in diesem Zusammenhang z.B. an die Greuel der Konzentrationslager der Nazis, die Massenvergewaltigungen im Jugoslawienkrieg oder, um von historischen zu tagesaktuellen Beispielen zu kommen, Ermordungen von Kindern durch perverse Triebtäter, die immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Andererseits ist es oftmals kaum zu glauben, in welcher Weise Menschen bereit sind, sich für andere aufzuopfern. Als Beispiele fallen mir spontan Heilige wie Franz von Assisi ein, der bedingungslos für Kranke sorgte oder die Männer der sinkenden Titanic, die Frauen und Kindern freiwillig ihre Plätze in den zu knappen Rettungsbooten überließen und pfeiferauchend im Salon auf ihren Tod warteten. Man hört auch immer wieder von Leuten, die andere unter Einsatz ihres Lebens aus brennenden Häusern oder Autos retten. Auch in Gabriels Leben gab es Menschen, die ihm halfen und solche, die ihn mißbrauchten.
Man könnte natürlich auch andere Beispiele für die Anwendung des Konzepts der “Wahrheit des Ganzen” anführen. Gabriel selbst hat z.B. (wie oben besprochen) für eine Synthese zwischen Wittgensteins und Heideggers Denken plädiert; und man kann sich auch auf Basis des Gesagten vorstellen, wie er z.B. die beiden philosophischen Extrempositionen “Alles ist Materie” und “Alles ist Geist” beurteilte - nämlich als korrekturbedürftig anhand der jeweils anderen.
Jeder Mensch hat nach Gabriel also eine bestimmte Perspektive auf die Wahrheit und sieht einen Teil von ihr. Die “Wahrheit des Ganzen” entsteht in der Zusammenfügung der scheinbar gegensätzlichen Sichtweisen. Fallen lassen muß man zunächst nur den Dogmatismus, den Fanatismus, die Intoleranz - oder wie immer man die “Geschlossenheit” des eigenen ideologischen Systems bezeichnen will. Diese “Geschlossenheit” äußert sich u.a. in dem anmaßenden Dünkel, daß man glaubt, ohne weiteres Suchen bereits die ganze und allein seligmachende Wahrheit zu besitzen. Aber nach Gabriel ist eben Offenheit gegenüber dem und Eingehen auf den Andersdenkenden gefragt, was man dem “anderen Teil der Wahrheit” schuldig ist. Die “geschlossene” Position des Fundamentalisten verschließt sich der “Wahrheit des Ganzen”, indem ein Teil der Wahrheit auf Kosten der anderen Teile absolut gesetzt wird.
Fallen lassen muß man natürlich auch die ärgsten Absurditäten, die einer vernünftigen Prüfung in Rede und Gegenrede (also einer Prüfung der eigenen Position anhand der anderen) nicht standhalten, wobei man wie gesagt in der Argumentation redlich und gewaltfrei vorzugehen hat. Natürlich führt die unreflektierte Zusammenfügung aller möglichen Gegensätze, die auf absurden Standpunkten beruhen, wie z.B. “ein Ochse fliegt nach Süden mit Flügeln, ein Ochse fliegt nach Norden ohne Flügel” nicht zur “Wahrheit des Ganzen”. Aber für die Ausscheidung der in jeder Position vorhandenen Irrtümer ist eben auch der Dialog (der Diskurs) notwendig, in den man einzutreten bereit sein muß und in dem man auf das Gemeinsame, nicht auf das Trennende, reflektieren sollte.
Ich möchte Gabriels in seiner eigenen schriftlichen Formulierung oft schwer verständlichen Standpunkt durch ein Gleichnis aus meiner Feder veranschaulichen: Alle Formen von Ideologien, Weltanschauungen, Überzeugungen sind wie größere oder kleinere Diamantensplitter, eingebettet in Dreckklumpen. Um die zahllosen Diamantensplitter, die Teile eines großen, zerbrochenen Diamanten sind, herauszuarbeiten, muß man die Klumpen aneinanderschlagen, bis der Schmutz von ihnen abfällt. Aus den übrigbleibenden, wertvollen Splittern kann man dann versuchen, den großen Diamanten wieder zusammenzusetzen, was wahrscheinlich niemals ganz gelingen wird. Die Splitter sind Teile der umfassenden Wahrheit, die in jeder Meinung auf irgendeine Art vorhanden sind, der Schmutz ist der mit jeder, auch der eigenen Ansicht verbundene Irrtum. Das Aneinanderschlagen der Klumpen ist der Diskurs, in dem die gegensätzlichen Meinungen aufeinanderprallen; er hat, redlich geführt, eine reinigende Wirkung. Und der große Edelstein ist die “Wahrheit des Ganzen”, die der Wahrheitsstrebende aus den verschiedenen “Teilwahrheiten” zusammenfügt.
Ein anderes Wort für die Tätigkeit dieses Zusammenfügens ist das “Integrieren” in dem Sinne, daß man etwas “ganz macht”. Entsprechend nennt Gabriel sein Konzept von der “Wahrheit des Ganzen” in einer vollkommen gleichwertigen, alternativen Bezeichnung auch “Integrale Logik”. Mit diesem Namen ist auch eines von Gabriels Büchern betitelt, das er selbst immer als sein Hauptwerk bezeichnet hat, nach meinem Eindruck aber sehr unzugänglich ist und seine Philosophie eher verdunkelt als erhellt. Gabriels schriftliche Werke sind leider überhaupt nicht so mitreißend und allgemein verständlich wie seine Vorlesungen und Vorträge es nach Aussage von Zeitzeugen offenbar gewesen sein müssen; und ich meine, dieser Umstand erschwert die Rezeption von Gabriels Werk auf nicht unbeträchtliche Weise. Ich möchte an dieser Stelle nochmals betonen, daß die Bezeichnung “Integrale Logik” tatsächlich von der im obigen Sinne beschriebenen Tätigkeit des “Integrierens” kommt - wie mir auch Leo Gabriels Philosophie lehrender Sohn auf Anfrage hin ausdrücklich versichert hat - und z.B. nicht von der Integralrechnung der Mathematik oder sonstigen mathematisch-logischen Fachausdrücken. Es scheint mir persönlich ein schwerer Fehler zu sein, das eigene Hauptwerk mit dem Namen “Integrale Logik” zu betiteln und so das allgemeine Mißverständnis zu erwecken, man wolle etwas zur mathematischen Fachliteratur beitragen, deren potentielles Publikum wohl noch wesentlich kleiner ist als das der philosophischen Fachliteratur. Leo Gabriel hätte eigentlich einen guten P.R.-Berater gebraucht, um seine im Kern hervorragenden Ideen besser zur Geltung bringen zu können.
Ich halte Gabriels Wahrheitsbegriff nicht zuletzt deshalb für bedeutend für die abendländische Philosophiegeschichte, weil er ein uraltes Dilemma mit einem Schlag löst: An den historischen Figuren eines Platon sowie der Sophisten sind die beiden unhaltbaren Gegenpositionen exemplifiziert. Platon nimmt die Existenz einer umfassenden Wahrheit an und erklärt das Streben nach ihr zu einer der obersten Pflichten. Gleichzeitig geht er davon aus, daß diese absolute Wahrheit (in seinem Fall die der “Ideen”) zumindest durch einige Weise endgültig erkennbar ist. Angesichts der absoluten Wahrheit, welche diese weisen Philosophenherrscher angeblich gepachtet haben, darf es in seinem sogenannten idealen Staat entsprechend keine abweichende Meinung mehr geben; und in den “Nomoi” ist seine Forderung nach einer inquistionsähnlichen Behörde, welche die dogmatischen, scheinbar ewig-gültigen platonischen Lehren u.a. mit Gewalt durchsetzt, auf die Spitze getrieben, wodurch Platons Wahrheitsbegriff zu Intoleranz und Unterdrückung neigt.
Die ebenfalls unhaltbare Gegenposition dazu nehmen die Sophisten oder in neuester Zeit Paul Feyerabend ein, der übrigens ein Schüler Gabriels gewesen ist, ohne offensichtlich viel von ihm gelernt zu haben. Hier wird die Existenz einer Wahrheit genauso geleugnet wie ihre Erkennbarkeit; es gibt keine Verbindlichkeit, keine Methode, nur mehr Willkür. Die einzig positive Seite dieses Relativismus ist die aus ihm resultierende Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Jedoch ist alleine die Leugnung der Existenz der Wahrheit beinahe eine Absurdität: Wer sagt, es gäbe keine Wahrheit, sagt nichts anderes als: “Es ist eine Wahrheit, daß es keine Wahrheit gibt” - ein offensichtlicher Selbstwiderspruch nach dem Muster des Paradoxons des Kreters Epimenides (“Alle Kreter lügen”). Es ist zwar philosophisch problematisch, aus dem Begriff einer Sache auf ihre Existenz zu schließen, aber daß ein Wahrheitsbegriff unbedingt mit dem menschlichen Denken verknüpft ist, hat auch schon der Skeptiker David Hume herausgearbeitet: Zumindest im Alltag muß man doch gewisse Dinge für wahr halten und andere für falsch, z.B. muß man doch annehmen, daß Putzmittel giftig ist und sich nicht zum Trinken eignet, sonst ist man überlebensunfähig. Wir können gar nicht nichts für wahr halten.
Ein von der Frage nach der Existenz der Wahrheit zu trennendes Problem ist - auch nach Popper - jenes der Frage nach der Erkennbarkeit der Wahrheit. (Beide Fragen werden oftmals in einen Topf geworfen). Ist es dem Menschen möglich, so etwas wie Wahrheit zu erkennen? Oben wurde gezeigt, welche negativen Konsequenzen die einseitige Beantwortungen dieser Frage haben können: Eine simple Bejahung der Möglichkeit einer absoluten Wahrheitserkenntnis führt leicht zu Intoleranz. Wenn man selbst die absolute Wahrheit zu besitzen vermeint, wieso sollte man in Andersdenkenden mehr sehen als Ketzer, die es zu vernichten, oder Irrende, die es ohne wirkliches Eingehen auf ihre Argumente zu “bekehren” gilt? Und was wird ein solches intolerantes Denken anderes hervorbringen als Versuche, die politische Freiheit zu zerstören? Und welche Gegenreaktionen wird es bei den Unterdrückten sonst auslösen als Gewalt?
Aber andererseits: Was passiert, wenn man jegliche Wahrheitserkenntnis schlechterdings für unmöglich hält? Warum sollte man dann z.B. noch wissenschaftlich forschen - außer aus eitler Geltungssucht? Warum sollte man sich bemühen, seinen Mitmenschen z.B. nach bestem Wissen und Gewissen die Wahrheit zu sagen, wenn unser angebliches Wissen von dieser doch sowieso nur Schall und Rauch ist? Und warum sollte man dann noch zu seinen eigenen Überzeugungen auch gegen den starken Druck z.B. eines tyrannischen Regimes stehen, anstatt die eigene Gesinnung an den Meistbietenden feilzubieten, wie es jene Sophisten ja auch letztendlich taten, die bereit waren, jede Position vor Gericht oder der Volksversammlung mit rhetorischer Stärke zu vertreten, sofern man sie gut für ihre Rednergabe bezahlte?
Leo Gabriels Wahrheitsbegriff geht von der Existenz einer umfassenden Wahrheit aus und vermeidet so die Absurditäten, die aus der kategorischen Leugnung einer solchen Existenz entstehen. Davon unterschieden wird die Erkennbarkeit der Wahrheit. Diese wird bei Gabriel nicht prinzipiell ausgeschlossen, aber - das ist eine Synthese aus den Stärken und Schwächen früherer Ansätze - als ständiger und niemals abgeschlossener Prozeß angesehen, wodurch sowohl ein aufrichtiges Wahrheitsstreben, Gesinnungstreue, als auch eine prinzipielle Offenheit und Toleranz gegenüber Andersdenkenden und damit politische Freiheit möglich wird. Durch die elegante Lösung der Probleme traditioneller Wahrheitsbegriffe empfiehlt sich Gabriels Ansatz also besonders.
Gabriels Konzept der “Wahrheit des Ganzen” ist, wie bereits festgestellt, auch von einer politischen Situation der Intoleranz inspiriert, deren geschichtliche Wiederholung vermieden werden sollte. Entsprechend anwendbar in Politik und Diplomatie ist seine Philosophie auch. Mit Gabriels Wahrheitsbegriff im Hinterkopf kann man versuchen, zwischen zwei Seiten zu mediieren und eine Synthese zweier scheinbar unterschiedlicher Verhandlungspositionen zu finden. Genau dies ist aber nach dem “Harvard-Konzept”, einem Standardlehrbuch zur Verhandlungsführung, ein wichtiges Ziel einer sachgerechten, erfolgreichen diplomatischen Verhandlung. Gabriels Wahrheitsbegriff dient, weil er zur Einbindung aller führt, auch dem politischen und sozialen Frieden. Das Streben nach Wahrheit ist für Leo Gabriel daher gleichzeitig ein Streben nach Frieden.
Bei allem Lob für die Bedeutung des Ganzen betonte Gabriel aber auch die größtmögliche Selbstständigkeit der Teile. “Das Ganze darf den Teil nicht unterdrücken”, wiederholte er nach Berichten seines Sohnes fast gebetsmühlenartig. Das totalitär verstandene “Gesamtinteresse”, das jede Freiheit des Individuellen aufhebt, war ihm also völlig fremd. Andererseits hob er hervor, daß der Teil aus der Perspektive des Ganzen beurteilt werden müsse: “Erst vom Ganzen her wird entscheidbar, was wahr ist oder falsch sein muß”. Diese beiden Aussagen erscheinen mir allerdings insoferne als schwer miteinander vereinbar, weil im Prinzip eine vom Ganzen her getroffene Entscheidung über Zulässigkeit oder Unzulässigkeit einer “Teilwahrheit” immer eine gewisse Unterdrückung derselben beinhaltet. Aber vielleicht könnte man bei einigem Nachdenken hier ebenfalls eine Synthese finden?
Gabriels Konzept ermangelt oft der Konkretisierung und entbehrt keinesfalls einer gewissen Widersprüchlichkeit. Dennoch hat seine Philosophie einige Grundproblematiken der menschlichen Existenz deutlich gemacht und mögliche Lösungswege aufgezeigt - und darin liegt ihre Bedeutung.
1.8. Philosophische Einflüsse auf Leo Gabriel, insbesonders die des russischen Mystikers Wladimir Solowjew
Einige philosophische Einflüsse auf Leo Gabriels Konzept der “Wahrheit des Ganzen” sind im bisherigen Text schon genannt worden: Die ihm in Innsbruck vermittelte mittelalterliche Philosophie, insbesonders die scholastische Diskussionsführung; die Fragestellungen Ludwig Wittgensteins und des an ihn anknüpfenden “Wiener Kreises”, v.a. repräsentiert durch Gabriels Lehrer Moritz Schlick; die radikale Gegenposition zu diesem Ansatz, die Phänomenologie, insbesonders in der von seinem persönlichen Freund und Professorenkollegen Martin Heidegger vertretenen Ausprägung.
Leo Gabriels Sohn, Prof.Werner Gabriel, mutmaßt auch einen Einfluß der indischen Philosophie, über die sein Vater einige Zeit lang geforscht hat. In ihr finden sich Konzepte, die dem der “Wahrheit des Ganzen” durchaus ähnlich sind. Wichtig waren seiner Meinung nach ebenfalls die beiden v.a. in Österreich wirkenden Denker Ferdinand Ebner und Rudolf Kassner - Leo Gabriel war u.a. auch Präsident einer philosophischen Gesellschaft zur Verbreitung des Werks des letzteren. Möglicherweise war Leo Gabriel auch von einem von Hegel geäußerten Satz inspiriert, welcher lautet: “Die Wahrheit ist das Ganze”.
Prof.Erwin Bader nennt in seinem Artikel über Leo Gabriels Philosophie als mögliche Vordenker auch Thomas von Aquin, Nicolaus Cusanus, Wilhelm Dilthey und Max Scheler, die alle auf ihre Art über das “Ganze” nachgedacht haben. Zudem erscheint ihm die Gestaltphilosophie bedeutsam, die u.a. von Christian von Ehrenfels vertreten worden ist (auf diesen Einfluß wurde er nach seinem Bericht von Leo Gabriel einst in einem persönlichen Gespräch verwiesen). Außerdem haben nach Baders Einschätzung die beiden politisch so unterschiedlichen Denker Alfred Adler und Othmar Spann einen Einfluß ausgeübt, wobei aber nach Meinung Prof.Werner Gabriels das “totalitäre Ganze” Spanns ausdrücklich nicht die Zustimmung seines Vaters gefunden hat.
Einer ehemaligen Dissertantin Leo Gabriels verdanke ich den wertvollen Hinweis, daß ihr früherer Mentor ebenfalls von den Ideen des russischen Mystikers Wladimir Solowjew maßgeblich geprägt worden ist. Diese Prägung erscheint mir aufgrund der augenfälligen Parallelität von Solowjews “All-Einheit” und Gabriels “Wahrheit des Ganzen” dermaßen plausibel, daß ich in diesem Abschnitt auch einige Bemerkungen über die Philosophie Solowjews niederlegen möchte, ohne aber den Anspruch zu erheben, alle Facetten dieses Denkers auch nur annähernd würdigen zu können.
Wladimir Solowjew (1853-1900), in Europa wenig bekannt, ist der wichtigste und zudem einer der ersten Vertreter einer eigenständigen russischen Philosophie überhaupt - war das russische Geistesleben doch vor dem Ende des 19.Jahrhunderts, wenn es nicht von der orthodoxen Kirche beherrscht wurde, weitgehend von europäischen Einflüssen abhängig, in deren Schatten es stand. Durch Studien verschiedenster Fächer an den Universitäten Moskau und St.Petersburg erwarb sich Solowjew ein nahezu universales Wissen, das ihm u.a. auch als Rüstzeug für das von ihm angestrebte Projekt einer Synthese zwischen Wissenschaft, Philosophie und Religion nützlich sein sollte. Eine vielversprechende akademische Karriere mußte er aufgeben, weil er politisch in Ungnade fiel: Als prinzipieller Gegner der Todesstrafe trat er öffentlich für die Begnadigung der Mörder des 1881 getöteten Zaren Alexander II. ein, was ihn beim Kaiserhof natürlich diskreditierte.
Der zentrale Gedanke seiner von christlicher Religiösität und neuplatonischem Mystizismus geprägten Philosophie ist der Gedanke der “All-Einheit”. Es handelt sich dabei um eine Art den Kosmos und sämtliche darin vorhandenen Dinge durchwaltendes, durchdringendes, erfüllendes Weltprinzip, das allem Existierenden gemeinsam ist und alles mit allem vereint und verbindet. Aus seiner Metaphysik der All-Einheit leitet Solowjew eine Erkenntnistheorie ab, in der verschiedene wissenschaftliche Systeme miteinander verbunden eine umfassende Wahrheit ergeben (mit Gabriels Worten eine Art “Wahrheit des Ganzen”).
Aus der Metaphysik der All-Einheit folgen aber auch wichtige ethische Lehren: Wenn es ein alle Menschen verbindenes Prinzip gibt, liegt die Forderung nach einer Achtung des jeweils anderen nahe. Dies hat auch der Friedensforscher Johan Galtung erkannt, wenn er betont, daß die Annahme eines allen Menschen verbindenden Prinzips wichtig ist, um begründen zu können, warum man sich selbst schadet, wenn man anderen schadet, ihnen also z.B. Gewalt antut. Die Annahme der radikalen Verschiedenheit und Unverbundenheit der Menschen führt zu einer Form der Entfremdung, die z.B. faschistische Grundeinstellungen begünstigt. Entsprechend kommt Solowjew, freilich auf anderem, weniger abstrakt-philosophischem Weg als Kant, zu einer ethischen Grundeinstellung, die einer der Ausformulierungen des Kategorischen Imperativs ähnlich ist: “Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst”. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch betonen, daß sich Gabriels Konzept der “Wahrheit des Ganzen” u.a. aus dem Grund empfiehlt, weil in ihm ein alle Menschen verbindendes Prinzip angenommen wird; dies wiederum führt zu einer Ethik der Menschlichkeit.
Wladimir Solowjews mystisches Denken der All-Einheit hatte aber auch insoferne einen Bezug zur praktischen Friedensarbeit, als es ein Streben nach Versöhnung von Menschen oder nach (Wieder-) Vereinigung etwa von Institutionen oder Weltanschauungen nahelegt. Solowjew selbst plädierte z.B. sehr stark für eine Wiedervereinigung der christlichen Religionen, also des Katholizismus, des Protestantismus und der Orthodoxie, was nach seiner christlich-eschantologischen Geschichtsauffassung auch dem göttlichen Heilsplan zuträglich wäre. Entsprechend versuchte er als eine Art Botschafter seiner eigenen Lehre hochrangige Vertretern aller Religionen von diesem Projekt zu überzeugen - freilich letztendlich erfolglos.
Auch zwischen Europa und Rußland versuchte er Brücken zu schlagen; und es ist durchaus möglich, daß Leo Gabriel zum “Friedensdialog zwischen Christen und Marxisten” von Solowjews freilich in einer völlig anderen historischen Situation getätigten Initiativen, eine Entspannung zwischen Ost und West herbeizuführen, inspiriert wurde.
Gegen Ende seines kurzen Lebens - Solowjew starb bereits mit 48 Jahren völlig mittellos - nahmen pessimistische, von apokalyptischen Visionen geprägte Gedanken in seinem Werk überhand, in denen er die bevorstehende Ankunft des Antichristen verkündete, der das Böse auf der Welt entfesseln und den großen letzten Endkampf zwischen Licht und Finsternis einleiten würde. Man kann Solowjews Befürchtungen interpretieren als dichterische Vorahnungen der bevorstehenden Weltkriege, die sich, zumindest für einen hochsensiblen Menschen, bereits am Horizont abzuzeichnen begannen.
1.9. Was bleibt? Zur Wirkungsgeschichte Leo Gabriels
Anfang der 70er-Jahre wurde Leo Gabriel als ordentlicher Professor der Universität Wien emeritiert. Auch danach war er noch wissenschaftlich aktiv - Präsident des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) blieb er z.B. bis zu seinem Tod. Er starb - im Alter von 84 Jahren - am 19.2.1987 in Wien an einem Herzinfarkt.
Von seinem damals hohen Bekanntheitsgrad v.a. im Wiener Raum zeugen die zahlreichen ihm verliehenen staatlichen Auszeichnungen, z.B. das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst der Republik Österreich, die Ehrenmedaille der Stadt Wien in Gold etc. Daß die heutige “Human- und Sozialwissenschaftliche Fakultät” der Universität Wien bis vor kurzem noch “Grund- und Integrativwissenschaftliche Fakultät” hieß, ging auf sein Konzept der “Integralen Logik” zurück. Nach Erwin Bader haben dann auch noch einige weniger bekannte Denker wie Herbert Christof Günzl Gabriels Konzept v.a. in Hinblick auf seine Anwendung auf dem Gebiet der Friedensforschung weiterentwickelt.
Die wichtigste institutionelle Hinterlassenschaft Leo Gabriels, die Organisation, die er gründete, damit seine Philosophie der Toleranz und des Dialogs fortleben und praktische Umsetzung finden sollte, ist aber ohne Zweifel das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF).
1.10. Wider das Vergessen
Eine Besinnung auf die gemeinsame Geschichte und die gemeinsamen Werte kann - wie bereits festgestellt - die Corporate Identity einer Organisation fördern und ist nicht zuletzt auch für die interne Kommunikation wichtig. Jubiläen sind außerdem immer willkommene Ereignisse, mit denen man Aufmerksamkeit in den Medien erregen kann, berichten doch die Medien selbst über strukturelle Veränderungen und langfristige Transformationsprozesse in erster Linie ereignis- und personenbezogen. Meiner Meinung nach ist das Bewußtsein im UZF für die eigene Tradition noch steigerungsfähig. Ich hoffe, man wird sich z.B. 2003 an das 30-jährige Bestehen der Organisation und 2004 an den ebenfalls 30-jährigen Geburtstag der vom UZF herausgegebenen wissenschaftlichen Fachzeitschrift gebührend erinnern.
Im Jahr 2002 steht aber der 100.Geburtstag des Gründers Leo Gabriel bevor. Meines Wissens sind noch keine Vorbereitungen für eine angemessene Würdigung dieses einmaligen Jubiläums getroffen worden - welch eine Verschwendung von Gelegenheiten für die interne und externe Public Relations! Ich plädiere dafür, dieses für die Corporate Identity wichtige Jahr nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Man sollte dem “Gründungsheros” der Organisation doch wenigstens eine Veranstaltung (am besten aber eine ganze Veranstaltungsreihe) widmen und in der Zeitschrift auch einen Schwerpunktsartikel zu seinem Leben und Werk publizieren.
Eine solche Vorgangsweise der umfassenden Würdigung verlangt nicht nur die P.R., sondern auch der Respekt vor den zeitlosen Leistungen eines schon lange verstorbenen, von Vergessenheit bedrohten, aber nichtsdestoweniger großen Denkers.
2. Geschichte des UZF von der Gründung bis zur Gegenwart
2.1. Vorgeschichte: Das Institut für Friedensforschung an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien
Im Jahre 1965 ging das zweite Vatikanische Konzil zuende. Das dort ausgearbeitete Dokument “gaudium et spes” beinhaltete die Forderung, es müsse “auf die Bildung neuer Organe für die Förderung des Friedens unermüdlich hingearbeitet werden.”
Während man der Katholischen Kirche heute vielfach zu Recht oder Unrecht vorwirft, in zahlreichen Fällen den Anschluß an die gesellschaftliche Realität verloren zu haben, war sie mit der oben genannten Forderung sicherlich am Puls der Zeit. Die Friedensbewegung - auch von nicht-christlich motivierten Gruppen der Gesellschaft getragen - stand gerade auf dem Höhepunkt ihrer Wirksamkeit und war zu einer echten Massenbewegung angewachsen. Außerdem befand sich die Weltpolitik in der beängstigenden Situation des Kalten Krieges, eines “Gleichgewichts des Schreckens”, das jederzeit in einen globalen Atomkrieg zwischen den damaligen Supermächten USA und Sowjetunion umschlagen hätte können - drei Jahre vor Ende des Konzils wäre dies auch in der sogenannten “Kuba-Krise” fast passiert, hätten die Sowjets nicht überraschend im Konflikt rund um die Stationierung von Mittelstreckenraketen auf besagter Karibikinsel eingelenkt.
Die Ergebnisse des zweiten Vatikanischen Konzils inspirierten zwei Theologie-Professoren an der Universität Wien, Rudolf Weiler und Karl Hörmann, die Gründung eines “Instituts für Friedensforschung” an der katholisch-theologischen Fakultät ihrer Alma Mater zu betreiben. Damit wurde in Wien endlich eine in anderen Ländern zuvor bereits lang vollzogene Entwicklung nachgeholt, hatte dort doch die von der Friedensbewegung inspirierte Friedensforschung oft eine beachtliche Entwicklung genommen.
Nachdem die Zustimmung des Fakultätskollegiums für dieses Projekt erreicht war, bewilligte das Unterrichtsministerium 1967 tatsächlich das neue Institut, allerdings zunächst mit der Auflage, daß der Republik in den ersten Jahren keine Kosten daraus erwachsen dürften. Daß dadurch der Aufbau eines Instituts nicht gerade erleichtert wurde, liegt auf der Hand. Weiler und Hörmann wurden zu Institutsvorständen bestellt.
So gut es ging, wurde das neue Institut von den Stamminstituten der beiden (Ethik und Sozialwissenschaft bzw. Moraltheologie) mitbetreut. 1971 wurde vom Ministerium dann doch ein erster Assistent bewilligt, 1972 stieß der Politikwissenschaftler Prof.Heinrich Schneider zum Team und wurde Mitvorstand des Instituts. Man begann, eine eigene Fachbibliothek und ein Angebot von einschlägigen Lehrveranstaltungen aufzubauen. Der Erfolg des Instituts für Friedensforschung war mit der Zeit beachtlich. Im Wintersemester 73 / 74 konnten z.B. bereits zehn Lehrveranstaltungen zur Friedensforschung angeboten werden. Man gewann dazu zahlreiche Lektoren und einmal sogar zwei Gastprofessoren, den Sowjetrussen Jan Vogeler und den U.S.-Amerikaner Eric Voegelin, die trotz der Ähnlichkeit ihrer Namen grundverschiedene, durch den Eisernen Vorhang getrennte politische Systeme repräsentierten. Man bemühte sich aber eben um Vermittlung zwischen Ost und West und ließ beide Seiten zu Wort kommen. Die zentrale Lage Wiens zwischen den beiden Machtblöcken wirkte sich dabei sehr positiv auf die Arbeit des Instituts aus. Mit der Zeit konnte man auch prominente Gastvortragende der “Friedensszene” aus aller Welt aufweisen, wie z.B. Johan Galtung, Dieter Senghaas oder Otto Kimminich.
2.2. Die Gründung des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) im Jahre 1973
Die oben besprochene beachtliche Entfaltung des Instituts für Friedensforschung, das am Anfang gar kein und auch später nicht sonderlich viel Geld vom Staat bekam, war nicht zuletzt durch das große Talent Weilers zum Fund Raising möglich geworden, das ihm heute noch attestiert wird. Unterstützt wurde er dabei von seinem Professorenkollegen Leo Gabriel, dem die Friedensforschung - wie oben besprochen - aufgrund seines philosophischen Ansatzes der “Wahrheit des Ganzen” ein großes Anliegen war.
Gabriel gründete gemeinsam mit Weiler und anderen im Jahre 1973 das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF). Der Name geht auf den Vorschlag Leo Gabriels zurück. Das UZF ist juristisch betrachtet ein privater Verein auf Basis des österreichischen Vereinsgesetzes. Die ursprüngliche Intention der Vereinsgründung lag darin, Fund Raising für das Institut für Friedensforschung an der Katholisch-Theologischen Fakultät zu betreiben; das UZF war also ursprünglich zunächst nur eine Art Förderverein.
Man wollte viele an Friedensforschung Interessierte und ganz besonders Prominente als “Freunde der Friedensforschung” gewinnen und Mitgliedsbeiträge, Spenden und eventuelle Subventionen an besagtes Universitätsinstitut weiterleiten. Das Netzwerk der Mitglieder u.a. auch des Ehrensenats des Vereins (dem in der Folge z.B. die damalige sozialistische Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg angehörte) sollte auch aufgrund der persönlichen Kontakte dem Institut nützen - heute nennt man diese Vorgehensweise “Networking”. Außerdem konnte man über den Verein, v.a. über den Wissenschaftlichen Beirat, auch Know-How bereitstellen.
Leo Gabriel meinte auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Vereinigung darüberhinaus, es ginge v.a. auch darum, über die Plattform des UZF Public Relations für die Friedensforschung zu betreiben, indem man z.B. ihre Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit vermittelt - wobei er das heute gängige Wort “Public Relations” vor ca.30 Jahren natürlich noch nicht verwendete; sinngemäß kann man aber das von ihm Gemeinte unter diesem Begriff zusammenfassen. P.R. war schon von Anfang an ein Hauptanliegen des Universitätszentrums. Auch die internationale Kooperation wurde von Gabriel ausdrücklich hervorgehoben.
Die Führung des Vereins war in der Praxis folgendermaßen organisiert: Leo Gabriel wurde Präsident, die drei Vorstände des Instituts für Friedensforschung (Weiler, Hörmann, Schneider) übernahmen die drei in den Statuten vorgesehenen Vorsitzendenposten. Die Arbeitsteilung sah de facto so aus: Gabriel hatte als Präsident formal die ranghöchste Funktion inne, war eine Art Integrationsfigur nach innen und - aufgrund seiner damaligen Prominenz in Wien - auch ein Aushängeschild nach außen. Er fungierte als Fürsprecher der Organisation und lukrierte über seine Kontakte u.a. Subventionen und andere Ressourcen. Die Leitung des “Tagesgeschäfts” in Wissenschaft und Management oblag hingegen den drei Vorsitzenden und hierbei v.a. Prof.Weiler.
Man stellte dem Verein auch Strukturen der Universität Wien zur Verfügung, was aufgrund seines hohen ideellen und materiellen Beitrags zur Förderung des Wissenschaftsbetriebs auch unbedingt Sinn machte. Das UZF wurde in Räumlichkeiten der Katholisch-Theologischen Fakultät am Wiener Schottenring untergebracht. Später sollte das UZF aufgrund von Platzproblemen an eine Dépendance der Fakultät in die Berggasse übersiedeln. Gabriel hat eine Zeit lang auch versucht, sein geliebtes Universitätszentrum im Wittgenstein-Haus in der Kundmanngasse unterzubringen. Dieses von seiner Bewunderung für besagten Philosophen inspirierte Projekt ist aber letztendlich aus finanziellen Gründen gescheitert.
2.3. Die Auflösung des Instituts für Friedensforschung
Nachdem das Institut für Friedensforschung - nicht zuletzt unter tatkräftiger Mithilfe seines Fördervereins - zu einer beachtlichen Größe angewachsen war, wurde es 1981, im 15.Jahr seines Bestehens, von der Politik aufgelöst. Zuvor hatte man es zu einem Senatsinstitut befördert, d.h. aufgrund seiner wachsenden Wichtigkeit und Interdisziplinarität direkt der Universitätsleitung unterstellt. Rückblickend betrachtet war die Umwandlung in ein Senatsinstitut nur ein erster Schritt, um die Institution abzuschaffen. Die scheinbare “Aufwertung” machte eine solche Abschaffung leichter, weil das Institut aus seiner Fakultät gelöst wurde und so in gewisser Weise eine Lobby verlor.
Prof.Weiler führt die Auflösung des Instituts für Friedensforschung auf drei Faktoren zurück. Einer dieser Gründe ist nach seiner Darstellung folgender: In der ersten Hälfte der 80er-Jahre brach ein heftiger Streit in der burgenländischen Landesregierung zwischen dem damaligen Landeshauptmann Theodor Kery und seinem Parteikollegen, dem Kulturlandesrat Gerald Mader aus (beide SPÖ). Ihre Meinungsverschiedenheiten machten eine weitere Zusammenarbeit der beiden Politiker praktisch unmöglich, einer mußte die Landesregierung verlassen. Schließlich fand man einen Kompromiß: Landesrat Mader sollte zurücktreten, dafür wurde ihm zugesichert, daß ihn der Staat durch großzügige finanzielle Zuwendungen bei der Erfüllung seines Lebenstraumes unterstützen würde, der darin bestand, in Stadtschlaining, einem kleinen Ort im südlichen Burgenland, ein internationales Friedensinstitut zu errichten.
Dieses sollte in der Burg des Ortes angesiedelt werden, die auch nicht zuletzt aus kommunalpolitischen Gründen einer Revitalisierung und Renovierung bedurfte, die der öffentlichen Hand eine beträchtliche Summe Steuermittel kostete. Weiler deutete mir gegenüber an, daß ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Untergang des Instituts für Friedensforschung an der Universität Wien und dem Aufbau des Zentrums in Stadtschlaining bestehen könnte, weil man eben vom damaligen Zeitpunkt an fast alles in Österreich für Friedensforschung zur Verfügung stehende Geld in die neue Organisation “pumpte”. Auf jeden Fall gibt es ein nachweisbares zeitliches Zusammenfallen zwischen der Auflösung des Instituts für Friedensforschung der Universität Wien und dem Aufbau des besagten Friedenszentrums im südlichen Burgenland.
Der zweite Faktor für die Auflösung des Instituts für Friedensforschung war nach Weiler, daß die Katholisch-Theologische Fakultät den Bestrebungen, das Institut zuerst aus der Fakultät herauszu- und dann aufzulösen, wenig bis gar nichts entgegensetzte. Einen der Gründe dafür sieht er im allgemeinen Neid auf die Größe und Blüte des von ihm in kurzer Zeit aufgebauten Instituts und darauf, daß er mit vier Assistenten über mehr Personal und damit Prestige verfügte als die meisten anderen seiner Professorenkollegen. Eben diese Kollegen hofften nach seinen Angaben zudem insgeheim, daß das ansonsten für das Institut für Friedensforschung budgetierte Geld an die übrigen, das heißt ihre eigenen katholisch-theologischen Universitätsinstitute fließen würde, was sich als eine falsche Erwartung herausstellte - von den freiwerdenden Ressourcen profitierte wie gesagt in erster Linie Stadtschlaining. Dazu kam, daß viele Funktionäre innerhalb der Kirche nicht glücklich darüber waren, daß man mit den verfemten Kommunisten Friedensgespräche führte. Daß die Alternative zu Friedensdialogen mit diesen “Ketzern” ein Atomkrieg mit ihnen gewesen wäre, leuchtete manchen dieser Kreise offenbar nicht ohne weiteres ein.
Der dritte Faktor war, daß sich aufgrund der wachsenden Interdisziplinarität des Instituts die Unkenrufe mehrten, man würde “zuwenig Theologie” lehren. Tatsächlich ist die Friedensforschung ein interdisziplinäres Fach, dem man sich von einer Vielzahl von Wissenschaften aus nähern kann, ja muß; was ich persönlich immer als Stärke des Faches erlebte, schien damals aber auch Ressentiments geweckt zu haben.
Wie die Verhaltensweise der Fakultät auch immer zu bewerten ist: Nach der Auflösung des Instituts für Friedensforschung blieb das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) zurück, zunächst als ein an der Katholisch-Theologischen Fakultät räumlich untergebrachter, in ganz Österreich und auch international aktiver Förderverein ohne entsprechendes Universitätsinstitut, das man fördern konnte. Weil viele der am Aufbau des Instituts für Friedensforschung Beteiligten nun ihr zerstörtes Lebenswerk nicht vollständig aufgeben wollten, weil sie über ein fundiertes Know-How im Universitätsmanagement und langjährige wissenschaftliche Erfahrung verfügten und weil sie verhindern wollten, daß die Friedensforschung an der Universität Wien vollständig unterging, begannen sie, das UZF zu einer Art Nachfolgeorganisation des aufgelösten Universitätsinstituts aufzubauen. Sie taten dies, indem sie die Aufgaben und Strukturen des alten Instituts so gut es ging in das UZF übernahmen und weiterführten, was natürlich nur mit massiven Einschränkungen möglich war.
Folgende Aktivitäten bzw. Strukturen des ehemaligen Instituts für Friedensforschung konnten übernommen werden:
Die Herausgabe der wissenschaftlichen Fachzeitschrift “Wiener Blätter zur Friedensforschung” (die auch zuvor schon mit Unterstützung des UZF publiziert worden war)
Der bereits aufgebaute Grundstock der wissenschaftlichen Fachbibliothek
Die Abhaltung einzelner Lehrveranstaltungen
Einer der vier Assistenten, den man durch eine spezielle Konstruktion ebenfalls “retten” konnte: Es wurde ihm ein Posten an der Akademie der Wissenschaft vermittelt, die ihn wiederum ihrerseits als “lebende Subvention” dem UZF zuteilte
Die Fortsetzung des vom Institut für Friedensforschung initiierten “Friedensdialoges zwischen Christen und Marxisten”, der im nächsten Abschnitt näher beschrieben werden soll
Noch eine Bemerkung zur gegenwärtigen Situation: Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) ist niemals wieder so groß geworden wie das Institut für Friedensforschung es dereinst gewesen ist. Von drei Professoren als Institutsvorständen, zwei Gastprofessoren, vier Assistentenposten und einer ganzen Reihe externer Lektoren kann man am Universitätszentrum heute noch höchstens träumen.
Auch ist das UZF gegenwärtig aufgrund seiner geringen budgetären Ausstattung nicht in der Lage, z.B. zehn Lehrveranstaltungen pro Semester abzuhalten - wie etwa das Institut für Friedensforschung dereinst vor ca. dreißig Jahren. Es wird unter Federführung des UZF, um einen Vergleich des damaligen mit dem momentanen Stand der Dinge anzustellen, jedes Semester am Institut für Philosophie der Universität Wien eine Basislehrveranstaltung, die “Arbeitsgemeinschaft Friedensforschung”, und (fast) jedes Wintersemester eine Vorlesung zur “Geschichte der Friedenstheorien” angeboten. Dann und wann ist es vielleicht noch möglich, einen zusätzlichen Lehrauftrag zu diesem Thema lukrieren zu können, viel mehr geht aber momentan nicht.
Als de facto Nachfolgeorganisation des Instituts für Friedensforschung hat das UZF aber das Verdienst, daß es nicht zuließ, daß die Friedensforschung an der Universität Wien ganz unterging. Bis heute - allerdings notgedrungen in einem kleineren Rahmen - wird das Werk von einst auf hohem wissenschaftlichen Niveau und mit großem persönlichen Einsatz fortsetzt. Das Bildungsangebot der Universität Wien wäre zweifellos ärmer ohne diese Bemühungen.
2.4. Der Friedensdialog zwischen Christen und Marxisten
Die Meinung des UZF-Gründers Leo Gabriel zum Ost-West-Konflikt und zu einem Dialog mit den damaligen kommunistischen Staaten läßt sich nach Aussage von Zeitzeugen wie folgt rekonstruieren:
Gabriel war der festen Überzeugung, daß auch die Wissenschaft nach Kräften einen Beitrag zur Entspannung des Kalten Krieges und damit zur Verhinderung der damals realen Bedrohung eines atomaren Weltkrieges leisten muß. Die Wissenschaft und insbesonders die Friedensforschung ist in der Lage dazu, weil sie einerseits an die Vernunft der Menschen appelliert, andererseits durch internationale Kontaktnahmen und Kooperationen alte Feindbilder abbauen helfen kann.
Im Sinne seines Ansatzes der “Wahrheit des Ganzen” meinte Gabriel ebenfalls, daß auch die Kommunisten einen Teil der umfassenden Wahrheit besäßen, sich also ein Dialog in jedem Falle auszahlt; und tatsächlich ist der Kommunismus, bei all seinen späteren Verbrechen, historisch eine Reaktion gegen die empörende soziale Situation im Europa des 19. und auch 20.Jahrhunderts und ein Versuch, die vielfach vorhandene Not und Unterdrückung der Arbeitnehmer zu lindern. Und auch aus heutiger Sicht, lange nach dem Zusammenbrechen der Sowjetunion, kann man legitimerweise die Frage stellen, ob ein rein auf Gewinnmaximierung und Konsum aufgebautes Wirtschaftssystem wie der Kapitalismus nicht Defizite aufweist. Gabriel hat diese Defizite ebenfalls gesehen, selbstredend ohne Kommunist gewesen zu sein oder die augenfälligen negativen Seiten der östlichen Systeme zu verleugnen. Auch die Christen, zu denen er sich immer selbst rechnete, sollten sich seiner Meinung nach mit den Kommunisten verständigen, um bei aller weltanschaulicher Verschiedenheit zu einem besseren Zusammenleben mit ihnen zu gelangen. Leo Gabriel machte sich mit seiner Aussage, daß auch die Kommunisten einen Teil der umfassenden Wahrheit besäßen, in der Katholischen Kirche übrigens nicht gerade beliebt.
Gabriel war sich über die Risken eines Dialoges mit den Kommunisten bewußt, hatten diese doch mehr als einmal versucht, vergleichbare Initiativen wie auch die gesamte Friedensbewegung für die Verbreitung ihrer Ideologie zu instrumentalisieren. Dennoch sah er keine andere Alternative zum Dialog als einen Atomkrieg. Er war darüberhinaus der Ansicht, daß man niemals derjenige sein dürfe, der den Dialog verweigert, denn neben allen Risken enthält jeder Dialog auch Chancen.
Man kann davon ausgehen, daß der “Friedensdialog zwischen Christen und Marxisten” wesentlich von Leo Gabriel initiiert und durch seine über die Präsidentschaft des philosophischen Weltkongresses geknüpften Kontakte erst ermöglicht wurde. Inspiriert war diese Initiative u.a. auch von den Erfolgen des KSZE/OSZE-Prozesses. Die Leitung des Dialoges hatte Prof.Weiler inne, der zu diesem Zweck sogar Russisch lernte.
Große Verdienste um die Organisation der Symposien des “Friedensdialoges zwischen Christen und Marxisten” hat sich auch Frau Dr.Pöllinger erworben, damals wie heute Generalsekretärin des UZF. Ihr oblag zum größten Teil das Management dieser historisch erfolgreichsten Veranstaltung der Vereinigung. Man kann davon ausgehen, daß die Betreuung dieses Friedensdialoges, z.B. der Aufbau und die Pflege der Kontakte, die Publikation der Ergebnisse, das Finden von passenden Räumlichkeiten im fernen Ausland, die Sicherstellung der Finanzierung etc. ein ganzjähriger Full-Time-Job gewesen ist.
Der “Friedensdialog zwischen Christen und Marxisten” sah in seinem Ablauf etwa folgendermaßen aus: Jedes Jahr gab es ein großes wissenschaftliches Symposium zu einem jährlich wechselnden Thema an einem jährlich wechselnden Ort. Dieser Ort lag einmal im Osten, einmal im Westen und jedes Jahr in einem anderen Land (z.B. 1977 in Philadelphia, USA oder 1978 in Kischinew, der Hauptstadt der Moldawischen Sowjetrepublik, UdSSR). Im übrigen Jahr wurde das “alte” Symposium durch Publikationstätigkeit aufgearbeitet und das “neue” intensiv vorbereitet.
Man stellte gemeinsam mit dem Kooperationspartner bei der Durchführung der Symposien, dem Internationalen Institut für den Frieden (Wien), Grundsätze auf, nach denen der Friedensdialog geführt werden sollte. Diese - ich nenne sie so nach der zufällig bestehenden Zahl - “Sieben Regeln des Friedensdialoges” hatten den Zweck, ein Klima der wissenschaftlichen Sachlichkeit und des gegenseitigen Vertrauens zu schaffen.
Die “Sieben Regeln” wollten aber auch mit den Problemen fertig werden, die sich bei Führung jedes Friedensdialoges ergeben und insbesonders beim Friedensdialog mit den Kommunisten sehr stark vorhanden gewesen sind: Es bestand wie gesagt die Gefahr, daß eine Seite versuchte, Friedensgespräche für sich zu benutzen, z.B. um Propaganda zu verbreiten, ihr problematisches System zu beschönigen und Mißstände zu verharmlosen etc. Das Regelwerk war ein Instrumentarium, um diese Schwierigkeiten unter Kontrolle zu bringen bzw. einzudämmen und so eine unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Mediation. Jeder Referent bzw. Teilnehmer mußte sich auf die Regeln verpflichten bzw. nach ihnen handeln. Außerdem gaben sie ebenfalls dem Veranstalter selbst, also dem UZF, gewisse Handlungsweisen vor.
Die “Sieben Regeln des Friedensdialoges” sind:
Strenge Wissenschaftlichkeit
Freie, aber respektvolle Rede und Gegenrede
Möglichst unmittelbare Diskussion, ausgehend von zwei Einleitungsreferaten
Keine Propaganda nach außen, d.h. von Veranstalterseite nur sachliche Informationen über das Symposium an die Öffentlichkeit
Freie Berichterstattung jedes Teilnehmers im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber in seiner eigenen Verantwortung
Begrenzte Teilnehmerzahl
Viel Zeit für informelle Gespräche neben dem wissenschaftlichen Programm
Von jedem Teilnehmer wurde also verlangt, gewisse Grundsätze der Wissenschaftlichkeit und Objektivität einzuhalten, auch Argumenten zugänglich zu sein, was eine Voraussetzung für den Dialog ist. Es herrschte allgemein Redefreiheit, aber grundsätzlicher Respekt gegenüber dem jeweils anderen wurde als unabdingbar erachtet. Es wurde viel Wert auf Diskussion während der Veranstaltung und informelle Gespräche neben dem wissenschaftlichen Programm gelegt; so konnte man einerseits Probleme ausdiskutieren, die man miteinander hatte, sich andererseits aber auch näherkommen.
Das Problem der Instrumentalisierung der Dialoge für Propagandazwecke versuchte man in den Griff zu bekommen, indem es eine streng begrenzte Teilnehmerzahl eines wissenschaftlichen Publikums gab. Wer in einem solchen Rahmen z.B. Propagandasprüche brüllt, macht sich höchstens lächerlich, was bei riesigen Massenveranstaltungen nicht unbedingt der Fall ist. Eine eigene, freie Berichterstattung war den Teilnehmern grundsätzlich erlaubt, man hätte sie auch kaum verhindern können, man lehnte aber konsequenterweise die Verantwortung dafür ab. Von Veranstalterseite wurden an die Öffentlichkeit ausschließlich sachliche Informationen über die Veranstaltung weitergegeben (dies kann wohl plausiblerweise nur auf zwei Arten geschehen: 1.es kann einen nüchterner Bericht eines der Objektivität verpflichteten UZF-Mitarbeiter über den Ablauf des Symposiums mit Zusammenfassung der Standpunkte und Nennung von Einigkeit und Differenzen in der Diskussion geben oder 2.man läßt alle gegensätzlichen Standpunkte zu Wort kommen, sodaß sie sich in gewisser Weise gegenseitig “neutralisieren”). Auf diese Art wurde auch verhindert, daß jemand die Publikationen als Forum für einseitige Propaganda instrumentalisieren konnte - zumindest wurde diese Schwierigkeit stark eingedämmt. Eventuelle Beschönigungen des eigenen Systems und Verharmlosungen aller Art konnten wiederum in besagter kritischer, wissenschaftlicher Diskussion aufgedeckt werden, die unmittelbar auf zwei Einleitungsreferate erfolgte.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob Regelverstöße geahndet werden konnten. Natürlich ging das nicht in dem Sinn, daß das UZF Geld- oder Gefängnisstrafen bei Zuwiderhandeln verhängen konnte. Dennoch konnte man im Großen und Ganzen eine Einhaltung der Regeln bewirken: Jene, die dem UZF selbst Handlungsweisen vorgaben, waren auf jeden Fall exekutierbar. Und für die anderen hatte man z.B. einen Mediator (Gesprächsleitung), der sehr wohl in der Lage, effizient moralischen Druck ausüben, um eine Einhaltung der Regeln zu erwirken. Wichtig war natürlich, daß dieser Vermittler wirklich unparteiisch war und allseitiges Vertrauen genoß; d.h. wichtig war die Neutralität seines Urteils und daß er gegen Regelverstöße aller Gruppen gleichermaßen auftrat. Die Aufgabe des UZF war es, solche unparteiischen und bei allen Gruppen anerkannte Vermittler bereitzustellen - Leo Gabriel ist ein solcher gewesen.
Außerdem kann ich mir vorstellen, daß man einen Referenten, der ständig gegen die Regeln verstoßen hatte, irgendwann nicht mehr einlud, d.h. es ging auch darum, vernünftige Gesprächspartner auf beiden Seiten zu finden. Die “Sieben Regeln des Friedensdialoges” haben sich auf jeden Fall in der Praxis als Voraussetzung der Mediation in der schwierigen Situation der Vermittlung zwischen Christen und Kommunisten bewährt.
Neben diesen “Sieben Regeln” gab es noch eine weitere, unausgesprochene und nie ausformulierte Regel, die aber nach meiner Interpretation der publizierten Vortragstexte zumindest praktiziert wurde. Sie lautete, daß jeder Teilnehmer in erster Linie auf das Gemeinsame und Verbindende, nicht auf das Unterschiedliche und Trennende reflektieren sollte. Alle wurden angehalten - und dies wurde ohne Zweifel auch von der Gesprächsleitung eingemahnt - dazu Stellung zu nehmen, worin sie mögliche Gemeinsamkeiten des Standpunktes beider Seiten zu einem bestimmten Thema sehen (jedes Symposium stand ja wie gesagt unter einem Spezialthema, z.B. “Abrüstung”). Von diesem Bestreben zeugt z.B. die Tatsache, daß man versuchte, Papiere zu verfassen, die dann von beiden Seiten unterschrieben wurden, in denen eine gemeinsame Linie zum Thema des Symposiums artikuliert wurde. So führten die Symposien im Endergebnis oft zu einer Art “joint statement”, in dem man gemeinsame Forderungen aufstellte, z.B. konnte man tatsächlich zu einem gemeinsamen Aufruf zur Abrüstung finden. Aber auch viele Referenten riefen zur Suche nach dem Gemeinsamen beider Seiten auf - und spiegelten durch ihre Plädoyers den Geist der umfassenden Versöhnung wider, der dieser Veranstaltung innewohnte.
Ich plädiere dafür, dieser unausgesprochenen, aber aus den historischen Quellen meiner Ansicht nach ableitbaren Regel, daß jeder Referent auf das Gemeinsame, nicht auf das Trennende der beiden Seiten reflektieren sollte, zur zukünftigen besseren Handhabung einen Namen zu geben; und ich schlage den Namen “Goldene Regel” oder “Regel der Gemeinsamkeit” vor. Man sollte sich vielleicht wieder stärker auf die damals angewandten Methoden der Friedensdialoge besinnen, die nach meinem Eindruck UZF-intern ein wenig in Vergessenheit zu geraten scheinen.
Die Vortragenden und das wissenschaftliche Publikum des “Friedensdialoges zwischen Christen und Marxisten” wechselten natürlich von Jahr zu Jahr, dennoch bildete sich auch so etwas wie ein “harter Kern” an hochrangigen Teilnehmern aus Wissenschaft und Politik heraus.
Eine mir vorliegende Teilnehmerliste der Symposien von 1975, 1977 und 1978 demonstriert den Erfolg: Man versammelte z.B. auf kommunistischer Seite Professoren der Universitäten Moskau und Sofia, hochrangige Mitarbeiter der sowjetischen Akademie der Wissenschaften, Abgeordnete der Volkskammer der DDR und Funktionäre der Kommunistischen Partei Italiens. Auf christlicher Seite waren z.B. im Ostblock wirkende Erzbischöfe, etwa der von Kischinew oder jener von Sagorsk, Professoren der renommierten deutschen Universität Fulda, der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und des Theologischen Seminars der U.S.-amerikanischen University of Princeton vertreten.
Der “Friedensdialog zwischen Christen und Marxisten” konnte sich schließlich einer beträchtlichen Akzeptanz innerhalb der internationalen “science community” erfreuen und trug durch die von ihm aufgebauten Kontakte und die internationale Kooperation seinen Teil zur Entspannung des Kalten Krieges in Europa bei. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 führte man den Dialog noch unter den stark veränderten Bedingungen eine Zeitlang mit den Reformländern fort; dann gab es allerdings aufgrund der neuen weltpolitischen Lage dringlichere Probleme (z.B. die Balkankriege). Daher erfolgte eine massive thematische Umorientierung. 1993 fand der endgültige letzte “Friedensdialog zwischen Christen und Marxisten” statt.
2.5. 1995 - Das Jahr der Katastrophe
Das Jahr 1995 wird zweifellos als “annus horribilis” in die Geschichte des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) eingehen. In diesem Jahr wurde es nämlich durch einen internen Streit über seine künftige Ausrichtung gespalten und erschüttert. Der Streit wurde mit großer, vorher und nachher nie dagewesener Heftigkeit geführt und endete mit massiven personellen Änderungen und einer damit verbundenen inhaltlichen Umorientierung der ganzen Organisation. Es ist gegenwärtig sehr schwer, mit Zeitzeugen der Krise über die damaligen Ereignisse zu sprechen; es scheinen persönliche Gefühle verletzt und tiefe Wunden geschlagen worden zu sein, die bis heute nicht ganz verheilt sind. Naturgemäß existieren zwei unterschiedliche Versionen der Geschichte, zwei oft miteinander nur schwer zu vereinbarende Sichtweisen. Da ich damals persönlich nicht dabei gewesen bin, kann ich nur versuchen, aus den von mir in den Expertengesprächen gewonnenen Daten die Ereignisse nach den manchmal lückenhaften oder stark persönlich gefärbten Aussagen und unter möglichster Bemühung um Objektivität ungefähr zu rekonstruieren.
Unbestritten ist, daß der damalige 1.Vorsitzende Herr Prof.Rudolf Weiler eine Idee hatte, an der sich der ganze Streit entzündete. Das von ihm mit großer Vehemenz betriebene Projekt bestand darin, eine Übersiedelung des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) weg von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien in Räumlichkeiten des “Instituts für Religion und Frieden” (IRF) durchzusetzen. Das “Institut für Religion und Frieden” ist eine Forschungseinrichtung des Militärbischofsamtes. Weiler wäre es über persönliche Kontakte möglich gewesen, Strukturen dieses Instituts für das UZF nutzen zu können. Eine Übersiedelung des UZF dorthin, das ist ebenfalls unbestritten, wäre mit nicht unbedeutenden materiellen Zuwendung verknüpft gewesen, also z.B. besseren Räumlichkeiten, einer großzügigeren budgetären Ausstattung etc. Weiler war damals und ist bis heute fest davon überzeugt, daß sein Projekt die Zukunft des UZF für alle Zeiten sichergestellt hätte.
Gegen Weilers Pläne bildeten sich allerdings massive Widerstände, die von einer bedeutenden Gruppe innerhalb der Organisation getragen wurden, die ich in Anlehnung an den Jargon der Innenpolitik als “Opposition” bezeichnen möchte. Der Wortführer der damaligen Opposition, die sich letztendlich mit ihrer Kritik durchsetzen konnte und deren Angehörige heute die maßgeblichen Führungspositionen innerhalb der Organisation bekleiden, war u.a. der heutige Präsident des UZF, Herr Prof.Norbert Leser, der neben vielen anderen auch von der damaligen wie heutigen Generalsekretärin Frau Hofrat Sigrid Pöllinger unterstützt wurde.
Der Konflikt Weiler - Leser drehte sich (soweit für mich aus den mir zur Verfügung stehenden Aussagen rekonstruierbar ) vor allem um zwei inhaltliche Fragen:
Zunächst ging es um die Bedeutung des Namens der Organisation: “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF). Die Opposition vertrat die Meinung, daß durch den Namen die enge Bindung der Vereinigung an die Universität impliziert ist. Es erschien der Opposition nicht tragbar, daß das UZF von der Universität weggehen sollte, um stattdessen Teil einer nicht-universitären Forschungsinstitution zu werden. Weiler hielt diesen Bedenken vor allem drei Argumente entgegen (zumindest nannte er diese mir gegenüber):
Erstens meinte er, das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) hätte schon zu allen Zeiten Ressourcen außeruniversitärer Forschungseinrichtungen genützt, so es diese zur Verfügung gestellt bekam, z.B. Strukturen der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, die dem UZF ja z.B. einen Beamten als “lebende Subvention” zugeteilt hatte. Warum sollte man nun nicht Strukturen des “Instituts für Religion und Frieden” nützen, wenn sich die Möglichkeit dazu ergab? Dem könnte man freilich wiederum entgegenhalten, daß es möglicherweise einen gewaltigen Unterschied macht, ob man bloß Strukturen einer anderen Institution benützt oder gleich ganz dorthin übersiedelt und die Universität verläßt.
Weilers zweites Argument war, daß das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) eigentlich gar keine wirkliche Universitätsinstitution ist, sondern rechtlich betrachtet eben ein Verein. Daher erkennt er bis heute auch keine ausschließliche Bindung an die Universität an. Diesem Argument könnte man allerdings entgegenhalten, daß das UZF zwar tatsächlich (wie oben besprochen) ein Verein ist, das Vereinsziel aber eben u.a. in der engen Kooperation mit der Universität bestehen könnte, der Verein also eine Art Plattform für die Koordinierung und Bündelung der Arbeit von Universitätsmitarbeitern darstellt sowie der Gewinnung von externen Ressourcen für den universitären Wissenschaftsbetrieb dient. Wenn die Organisation diese Zwecke nicht mehr erfüllen kann (weil sie z.B. von der Universität weggeht), hat sie möglicherweise ihre Existenzberechtigung verloren.
Das dritte Argument Weilers lautete, daß die Bezeichnung “Universitätszentrum für Friedensforschung” ein bloßer Name sei, der eigentlich nichts bedeute; man hätte bei der Gründung auch jede andere Bezeichnung wählen können. Der Name sage auf jeden Fall nichts über die eigentlichen Ziele der Organisation aus. Obwohl die Statuten über die Vereinsziele tatsächlich wenig konkret sind, läßt sich diese Ansicht meiner Meinung nach allerdings objektiv widerlegen. Denn im damals wie heute gültigen österreichischen Vereinsgesetz §4 (2) heißt es diesbezüglich:
“Der Vereinsname bildet einen wesentlichen Bestandteil der Statuten. Der Name muß so beschaffen sein, daß er einen Schluß auf den Vereinszweck zuläßt...”
Die österreichische Rechtslage, über die sich auch Weiler nicht hinwegsetzen kann, ist also eindeutig: Der Name drückt den Vereinszweck aus. Natürlich hätte in der Zeit der Gründung ein anderer Name festgelegt werden können, aber dann hätte man eben auch einen anderen Vereinszweck festgelegt. Sein drittes Argument ist also in jedem Fall widerlegbar.
Es gab in der damaligen Diskussion aber noch einen zweiten Aspekt, und zwar die Angst um den Verlust der wissenschaftlichen Unabhängigkeit und Integrität. Eine Ansiedelung des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) am Militärbischofsamt und eine Inanspruchnahme seiner Ressourcen hätte auch zu einer starken Abhängigkeit von dieser Institution geführt. Zudem wären nach meinen Informationen auch Verknüpfungen mit der Landesverteidigungsakademie (LAVAK) des Österreichischen Bundesheeres geplant gewesen. Die Frage war nun, ob eine solche Verknüpfungen mit LAVAK und Militärseelsorge nicht auch zu einer strukturellen Abhängigkeit des UZF vom Österreichischen Bundesheer geführt hätte und ob wissenschaftliche Unabhängigkeit dann noch möglich gewesen wäre. Weiler bejahte die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Unabhängigkeit in dieser Situation, die Opposition hatte daran allerdings Zweifel. Leser sprach sogar von einem “Militärputsch”.
Ich möchte in diesem Zusammenhang klar stellen, daß mir bei meinen zahlreichen Expertengesprächen mit praktisch allen führenden UZF-Mitarbeitern kein einziger “Radikalpazifist” begegnet ist, der z.B. eine Meinung vertreten würde wie jene, daß alle Soldaten ohne Unterschied Mörder seien und das Militär ersatzlos abgeschafft werden müsse - oder ähnliche überzogene Absurditäten. Vielmehr werden in regelmäßigen Abständen sogar hohe Offiziere dazu eingeladen, für die “hauseigene” Fachzeitschrift zu schreiben und ihre Meinung wird als Bereicherung empfunden. Dennoch begreift sich das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) in erster Linie als zivile Einrichtung, die nicht nur einen militärischen, sondern einen umfassenden Begriff von Sicherheit vertritt, der neben bloß militärischen auch politische, ökologische etc. Dimensionen umfaßt. Das Heer beurteilt vielfach aus Perspektive eines rein militärischen Sicherheitsbegriffs und neigt daher manchmal zu Fehleinschätzungen in der Sicherheitspolitik, die unbedingt korrekturbedürftig erscheinen.
Außerdem muß doch, meinte die Opposition, zumindest theoretisch die Möglichkeit bestehen, Mißstände beim Militär zu kritisieren! Wie soll man als Friedensinstitution mögliche Mißbräuche militärischer Macht anprangern können, wenn man selbst Teil des Militärs oder indirekt von ihm abhängig ist? Das heute von der damaligen Opposition geführte UZF ist, so mein Eindruck, keineswegs militärfeindlich; aber der Wunsch, sich dem Militär institutionell auszuliefern, hält sich in sehr engen Grenzen. Vielmehr wird auf Unabhängigkeit von allen Interessensgruppen größtmöglicher Wert gelegt; und Weiler wird vorgeworfen, damals bereit gewesen zu sein, eben diese Integrität zu “verkaufen”. Die damals offenbar verbreitete Angst bestand darin, daß es zur neuen Aufgabe eines mit LAVAK und Militärseelsorge verknüpften UZF geworden wäre, den Streitkräften bei festlichen Anlässen ein christliches Friedensmäntelchen umzuhängen, indem es jede militärische Aktion im Namen des Friedens rechtfertigen hätte müssen, im Recht und vielleicht manchmal auch im Unrecht.
Herr Prof.Weiler schien mir, das war mein persönlicher Eindruck im Expertengespräch mit ihm, vom Militär sehr begeistert zu sein. Ich war z.B. äußerst erstaunt, als mir der ehemalige Vorsitzende einer Friedensorganisation, der für diese viel geleistet hatte, plötzlich in einem anderen Gesprächszusammenhang erzählte, es gäbe doch “nichts Schöneres” als eine Parade von Soldaten aus verschiedenen Ländern, die dann anschließend gemeinsam eine Messe feiern. Ich möchte mir die persönliche und in diesem Fall natürlich völlig subjektive Bemerkung erlauben, daß ich mir sehr wohl Schöneres vorstellen kann, als mehrere Stunden lang stramm stehen, exerzieren, marschieren und anschließend einer Feldmesse beiwohnen zu müssen; und ich mutmaße, daß dies bei den nicht selten gegen ihren Willen zum Wehrdienst gezwungenen Soldaten normalerweise auch der Fall ist.
Auf eine andere meiner Fragen, was er zu Bertha von Suttners Kritik an der Militärgeistlichkeit sage, diese hätte sich schon sehr oft der religiösen Verherrlichung des Militarismus schuldig gemacht, entgegnete Weiler lediglich, dies hätte Suttner alles “zusammengeschmiert” und sie sei überhaupt eine “Freimaurerin” gewesen. Inhaltliche Gegenargumente nannte er ansonsten keine. Langsam begann ich zu verstehen, warum sich das UZF, trotz seines allseits anerkannten Organisationstalents, letztendlich von ihm getrennt hat; es ist aus meiner Sicht sogar ein Wunder, daß solche und ähnliche Ansichten nicht schon viel früher mit denen der übrigen “Friedensbewegten” massiv kollidiert und zum Bruch geführt haben.
Wie man auch immer zur Schönheit von Militärparaden mit anschließenden Feldmessen und zur wirklichen oder angeblichen Verwerflichkeit der Weltanschauung der Gründerin der Friedensbewegung im deutschsprachigen Raum stehen mag, Faktum ist, daß der Streit um Weilers Projekt (wobei sich beide Seiten bis heute gegenseitig neben den inhaltlichen auch niedrige persönliche Beweggründe unterstellen, auf die ich aber nicht näher eingehen will) zu einem für eine Friedensorganisation mit ungewöhnlicher Härte geführten Machtkampf ausartete. Weiler beklagt z.B. glaubhaft folgendes:
Nach seiner Darstellung gab es eine Generalversammlung, in der über seinen Vorschlag abgestimmt wurde. Die Abstimmung ging knapp gegen ihn aus, wobei die entscheidenden Stimmen schriftlich übertragen waren, also in Abwesenheit der Stimmberechtigten erfolgten. Es entstand die Streitfrage, ob Abwesende eigentlich mitstimmen dürfen, wobei die Statuten in dieser Hinsicht - wie so oft - uneindeutig sind.
Der damalige Präsident, Ignaz Seidl-Hohenveldern, ein bekannter Völkerrechtsprofessor, der nach einer zweijährigen Vakanz nach Leo Gabriels Tod die Präsidentschaft des UZF übernommen hatte und nach Weilers Angaben ebenfalls auf der Seite der Opposition stand, ließ die fraglichen Stimmen gelten. Weiler verlangte eine Wiederholung der Abstimmung, zumal er mitten in der Diskussion zum Telefon gerufen worden war und man die Gelegenheit seiner kurzen Abwesenheit sofort zur Vorbereitung eines negativen Votums genützt hatte. Die Versammlung löste sich allerdings im Tumult auf, sodaß keine Wiederholung möglich war.
Auf eine zweite Generalversammlung zum selben Thema war Weiler besser vorbereitet: Er ließ sich von einer ganzen Reihe von Mitgliedern Stimmen schriftlich übertragen, sodaß er nun eine sichere Mehrheit hinter sich wußte. Bei der zweiten Abstimmung ließ Seidl-Hohenveldern die auf diese Art gewonnenen Stimmen allerdings nicht mehr gelten, weil er meinte, er wolle “keinen Usus begründen”. Nach Weilers Darstellung - es ist, wie gesagt, seine Sichtweise - wurde hier also mit doppeltem Maß gemessen. Und tatsächlich scheint sich die Opposition, um es drastisch zu sagen, mit “Zähnen und Klauen” und wirklich allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen eine Ansiedelung des UZF am Militärbischofsamt gewehrt zu haben.
Von einigen Mitgliedern der ehemaligen Opposition (deren Namen ich in diesem Fall auf ihre Bitten hin nicht nennen möchte, um ihnen eventuelle Schwierigkeiten zu ersparen) wird Weiler aber auch einiges vorgeworfen, z.B. daß er als “dogmatischer Moraltheologe, der eine plötzliche Vorliebe für das Militär entdeckt hatte”, unfähig war, auf die berechtigten Gegenargumente einer großen Gruppe innerhalb des UZF angemessen einzugehen. Kritisiert wird auch, daß er bereit gewesen war, sein letztendlich entgegen seiner eigenen Einschätzung “durchaus entbehrliches Projekt” kompromißlos und auch um den Preis des Zerbrechens der Organisation und der menschlichen Entfremdung von vielen seiner langjährigen Mitarbeiter durchzusetzen, was ihn - trotz seiner unbestrittenen Verdienste während der Jahre des Aufbaus, die Respekt verdienen - als Leiter einer extern wie intern auf Dialog und Verständigung ausgerichteten Friedensorganisation eigentlich disqualifizierte.
Wie weit diese letztgenannten gegenseitigen Vorwürfe berechtigt sind, kann ich als damals Abwesender - wie bereits festgestellt - nicht beurteilen. Die beiden faktischen Ergebnisse dieses Prozesses, nämlich die beiden Grundsatzentscheidungen, daß das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) an der Universität angesiedelt bleibt und sich zudem von keiner militärischen Institution abhängig macht (weder direkt noch indirekt), halte ich aber persönlich für richtig; und ich kann auch nicht leugnen, daß mich die inhaltlichen Argumente der damaligen Opposition stärker überzeugen als jene Weilers. Im Sinne der P.R. ist zudem, wie in der Einleitung (“Was ist Public Relations”) skizziert, die Autonomie einer Organisation zu jeder Zeit sicherzustellen.
Nach der zweiten Abstimmungsniederlage zog Prof.Weiler die Konsequenzen und legte sein Amt als 1.Vorsitzender nieder. Nach dem Verlust seiner schützenden Hand mußte das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) seine bisherigen Räumlichkeiten an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien verlassen. Der bereits hochbetagte Präsident Seidl-Hohenveldern trat unter diesen Bedingungen ebenfalls zurück.
Das Jahr 1995 war also insoferne ein Jahr der Katastrophen für das UZF, weil es schlagartig seinen 1.Vorsitzenden, seinen Präsidenten und seine bisherigen Räumlichkeiten verloren hatte. Die Organisation stand knapp vor ihrem Untergang.
2.6. Die Entwicklung bis zur Gegenwart
Obwohl intern nicht gerne über die damaligen Ereignisse gesprochen wird, kann man anhand einiger Indizien schließen, wie schwer die Konsolidierung nach diesem Einschnitt gewesen sein muß. 1995 war z.B. das einzige Jahr, in dem die “Wiener Blätter zur Friedensforschung”, deren viermalige Publikation pro Jahr sonst so zuverlässig funktionierte wie ein Uhrwerk - diese Regelmäßigkeit steht übrigens im Widerspruch zu den Problemen sonstiger Zeitschriften und stellt eine erstaunliche Leistung der Verantwortlichen dar -, nur dreimal erschienen. Bei meinen Recherchen im Archiv des UZF fand ich eine bestimmte Sache nicht, worauf man mir quasi nebenbei mitteilte, daß dies u.a. daran liegen könnte, weil “wir einmal Hals über Kopf unsere Unterkunft verlassen mußten und bei diesem plötzlichen Umzug vieles aus dem Archiv verloren ging.” Man scheint das UZF wirklich mehr oder weniger brutal aus der Katholisch-Theologischen Fakultät hinausgeworfen zu haben.
Daß die Konsolidierung der Vereinigung schließlich doch noch erfolgte, ist v.a. dem Einsatz Prof.Lesers zu verdanken, der sich während einer stürmischen Sitzung im “Café Schottenring” bereiterklärte, die Präsidentschaft zu übernehmen. Seine Bemühungen führten dazu, daß das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) am Institut für Philosophie der Universität Wien untergebracht werden konnte, zuerst kurz in der Währingerstraße, und später - das ist auch die gegenwärtige Adresse - im Neuen Institutsgebäude der Universität Wien, Universitätsstraße 7, 3.Stock, 1010 Wien. Herr Prof.Erwin Bader wurde als Nachfolger Weilers 1.Vorsitzender.
Der gegenwärtige Präsident betont den christlichen Werthintergrund der Organisation. Da er befugt ist, für das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) nach außen zu sprechen, ist seine Einschätzung in jedem Fall richtig. Man muß aber aus sozialwissenschaftlicher Perspektive dahingehend einschränken, daß sich das UZF, was die soziale Realität seiner personellen Zusammensetzung und die Wahl seiner Forschungsinteressen betrifft, immer mehr von seiner einstigen fachtheologischen Ausrichtung gelöst hat. Die führenden Funktionäre kommen hinsichtlich ihrer universitären Ausbildung nicht mehr hauptsächlich von der Theologie, sondern eher von den Fächern Philosophie oder Politikwissenschaft. (Der 1.Vorsitzende Prof.Bader, obwohl lange Zeit als Religionslehrer tätig, ist eigentlich promovierter Politologe und heute Professor für Philosophie; der Präsident Prof.Leser studierte Jus, promovierte in Rechtsphilosophie, wirkte u.a. als Professor für Politikwissenschaft und unterrichtet nunmehr ebenfalls Philosophie; die Generalsekretärin ist promovierte Philosophin und diplomierte Dolmetscherin). Entsprechend sehen die wissenschaftlichen Fragestellungen aus. Das UZF ist außerdem eben nicht mehr an der Katholisch-Theologischen, sondern an der Human- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät untergebracht. Auch die Generalsekretärin diagnostiziert einen faktischen Wandel der Organisation von einer einstigen theologischen zu einer eher human- und sozialwissenschaftlichen Ausrichtung. Sie betont außerdem, daß niemand, der sich um eine Mitgliedschaft bewirbt, wegen seiner Zugehörigkeit zu einer anderen Religion als der römisch-katholischen abgelehnt würde.
Seit der damaligen Zeit legt man auf internen Konsens größten Wert. Bei der letzten Generalversammlung am 22.5.01 lehnte man es z.B. ab, über ein kontroversielles Thema abzustimmen, ohne daß vorher ein Konsens gefunden worden war. Man will offenbar nicht mehr, daß sich die Ereignisse von damals wiederholen.
Man war seit 1995 in der Lage, zahlreiche faszinierende Persönlichkeiten für die Organisation zu gewinnen und sie zu integrieren. Jeder dieser Menschen leistet einen einzigartigen und unverzichtbaren Beitrag zur Arbeit des UZF und trägt mit seiner Sichtweise etwas zur oben bereits ausführlich besprochenen “Wahrheit des Ganzen” bei.
Einen im Jahre 1997 für den zweiten Vorsitz des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) gewonnenen Spitzendiplomaten möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich nennen, weil seine Mitgliedschaft eine nicht unbedeutende strukturelle Änderung für die ganze Organisation mit sich brachte, die sich positiv auf ihre praktische Friedensarbeit auswirkte. Es gibt überhaupt kaum ein UZF-Mitglied, das so viel für seine Vereinigung tut und leistet: Er nützt seine zahlreichen persönlichen Kontakte zu verschiedensten Institutionen, um die Universität Wien bei ihrer Forschungsarbeit zum Frieden zu unterstützen; er beteiligt sich an wissenschaftlichen Aktivitäten, indem er z.B. blendende Vorträge hält, wissenschaftliche Artikel schreibt und sich auch im Bereich des Fund Raising engagiert; er vergrößert damit die Handlungsfähigkeit des UZF wesentlich.
Dr.Helmut Liedermann hatte in seinem Leben zahllose hochrangige Funktionen inne: Er war z.B. als Generalkonsul Chef der österreichischen Delegation in West-Berlin, danach Leiter der österreichischen KSZE-Delegation in Genf, später Botschafter der Republik Österreich in Belgrad und Moskau und schließlich sogar Generalsekretär des Wiener Treffens der KSZE/OSZE und weiterer Folgeverhandlungen im Rahmen dieser Internationalen Organisation. Anfang der 90er war er als Beauftragter der Österreichischen Bundesregierung für die Organisation der Weltkonferenz der Vereinten Nationen über Menschenrechte in Wien verantwortlich - insgesamt liegt also ein beeindruckender Lebenslauf und eine Unmenge praktischer Erfahrungen vor; und das UZF kann froh sein, einen solch bedeutenden Diplomaten in seinen Reihen zu wissen..
Seine wahrscheinlich größte historische Leistung besteht aber darin, am Zustandekommen der KSZE-Schlußakte von Helsinki 1975 maßgeblich mitgewirkt zu haben, die eines der wichtigsten Völkerrechtsdokumente überhaupt darstellt. Z.B. war er auch Koordinator der 1974/75 im Sitzungssaal der Österreichischen Mission bei den Vereinten Nationen in Genf täglich stattgefundenden informellen Verhandlungen, die das wichtige dritte Kapitel der Schlußakte (“3.Korb”) betrafen, in dem u.a. Fragen der Familienzusammenführung behandelt wurden. Von ihm gingen auch wichtige Anregungen aus, die eine Einigung bezüglich der Schlußakte erst ermöglichten; was ich im noch folgenden Abschnitt über die OSZE ebenfalls würdigen werde.
Heute ist Dr.Liedermann Botschafter des Souveränen Malteser Ritter-Ordens in Bratislava / Preßburg (Slowakei). Die bisherigen Haupterfolge seiner Tätigkeit in dieser Funktion liegen in der Schaffung einer repräsentativen Botschaft im Herzen Bratislavas sowie im erfolgreichen Engagement für den “Malteser Hilfsdiensts” in der Slowakei, der bereits jetzt zu einem der größten Hilfsdienste des Ordens in Europa angewachsen ist.
Als er bemerkte, daß sein Orden noch über keine Vertretung bei den Vereinten Nationen in Wien verfügte - ein gravierendes Defizit, wenn man bedenkt, welche Bedeutung gerade Wien als 3.Hauptstadt der UNO im Bereich der Diplomatie besitzt -, machte er auf diesen Mißstand aufmerksam. Daraufhin ernannte man ihn zum Beobachter des Souveränen Malteser Ritter-Ordens bei der UNO in Wien.
Zur Erfüllung dieser Aufgabe baute er eine diplomatische Delegation unter seiner Leitung auf. Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF), für das er als 2.Vorsitzender tätig war und ist, erwies sich dabei für ihn als ideale Rekrutierungsbasis seiner Mitarbeiter - und er berief die Generalsekretärin und den Schriftführer des UZF in besagte Delegation. Die Folge von all dem ist, daß drei Funktionäre des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) in Personalunion die diplomatische Vertretung des Souveränen Malteser Ritter-Ordens bei der UNO in Wien stellen und so eine Möglichkeit mehr besteht, wissenschaftliche Erkenntnisse in praktische Friedensarbeit umzusetzen, was äußerst positiv ist. Auch der Malteser Orden gewinnt auf diese Art eine diplomatische Vertretung mit Know-How im Bereich Friedensforschung und Internationaler Politik, die seine Interessen und humanitären Ziele mit Vehemenz einfordert.
Dazu sind folgende Erläuterungen notwendig: Der vor Jahrhunderten militärisch gegen den Islam aktive, heute aber stattdessen mit großem Einsatz in Sozialarbeit, Krankenpflege und Rettungsdienst tätige Orden hat seit dem Verlust seines damaligen Staates auf Malta durch die napoleonische Expansionspolitik im 19.Jahrhundert kein Staatsgebiet mehr; aber als Relikt seiner einstigen Staatlichkeit ist ihm die Souveränität, sonst nur Eigenschaft eines Staates, geblieben. Er ist ein Völkerrechtssubjekt sui generis und hat als solches auch bis heute das aktive und passive Gesandtschaftsrecht, d.h. der Orden darf Diplomaten in alle Länder schicken und von allen Ländern empfangen.
Die Souveränität des Ordens ist natürlich, wie auch eine Aide mémoire der diplomatischen Delegation des Souveränen Malteser Ritter-Ordens bei der UNO feststellt, kein Selbstzweck, sondern man hat sie als Instrument zur Umsetzung anderer Zielsetzungen mit neuem Sinn erfüllt, weswegen sie auch in der Gegenwart unterstützenswert erscheint. Gegenwärtig hat der Souveräne Malteser Ritter-Orden diplomatische Beziehungen mit ungefähr 90 Ländern sowie mit den Internationalen Organisationen in New York, Genf, Wien, Brüssel, Straßburg etc. Die Diplomaten des Ordens vertreten v.a. humanitäre Anliegen.
Eines der wichtigsten Tätigkeitsfelder ist dabei die Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts, wobei es v.a. um die Schaffung von Mechanismen der Implementierung desselbigen in der Praxis geht. Vertreter des Souveränen Malteser Ritter-Ordens spielten auch eine aktive Rolle in den internationalen Konferenzen, die letztendlich das Verbot von Landminen ausverhandeln und durchsetzen konnten. Die diplomatischen Korps des Ordens setzen sich aber innerhalb der Internationalen Organisationen z.B. auch für die Verbesserung der Situation der Flüchtlinge ein, insbesonders der Kriegsflüchtlinge.
3. Organisationsstruktur des UZF
Der allgemeine Rahmen der Organisationsstruktur des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) wird von seinen Statuten festgelegt. Man muß allerdings zu den Statuten zweierlei bemerken: Erstens geben sie nur einen ungefähren Rahmen vor, sind oft sehr knapp, wenig konkret und fast immer mehrdeutig formuliert - Beispiele werden noch folgen. Wer nur die Statuten kennt, weiß sehr wenig über die soziale Realität der Organisation, obwohl das Dokument intern natürlich respektiert und eingehalten wird. Zweitens ist zumindest ein Teil der Statuten meiner Meinung nach veraltet - und zwar der wichtigste, nämlich die Zieldefinition. Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, daß die Statuten noch aus der Zeit stammen, in der das UZF lediglich eine Art Förderverein gewesen ist. Entsprechend wird als das Ziel der Institution auch die “ideelle und materielle Förderung der Friedensforschung” definiert. Das ist insoferne noch immer korrekt, als das UZF die Friedensforschung ideell und materiell fördert, indem es unter eigener Verantwortung z.B. Veranstaltungen organisiert und für diese natürlich auch Geld und Arbeitszeit investiert werden. Das ursprünglich damit Gemeinte, daß man andere Friedensinstitutionen subventioniert, stimmt mit der heutigen Realität aber natürlich nicht mehr überein.
Die Mittel, um dieses Ziel umzusetzen, sind in den Statuten ebenfalls nur sehr kurz und vage definiert. Im Prinzip könnten sie unter dem Begriff Public Relations für die Friedensforschung zusammengefaßt werden (z.B. Veranstaltungstätigkeit).
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) hat seinen Sitz in Wien, seine Tätigkeit erstreckt sich auf die nationale und die internationale Ebene. Ordentliches Mitglied kann jeder österreichische Staatsbürger werden, der sich für die Ziele des Vereins interessiert. Die Aufnahme muß durch den Vorstand genehmigt werden, wobei in der Praxis ein bereits Etablierter das neue Mitglied dort vorschlägt und empfiehlt. Wenn die Person nicht österreichischer Staatsbürger ist, kann ihm die ordentliche Mitgliedschaft durch den Vorstand dennoch zugestanden werden. In der Praxis wird man dies nicht verweigern, da man ständig auf der Suche nach Mitgliedern aus anderen Ländern ist, was auch dem in den Statuten festgelegten Streben nach internationaler Kontaktnahme entspricht.
Nach den Statuten gibt es ordentliche, außerordentliche und fördernde Mitglieder. In der Praxis gibt es nur ordentliche Mitglieder. Dieses Faktum liegt unzweifelhaft darin begründet, daß es eigentlich völlig unattraktiv ist, außerordentliches Mitglied der Vereinigung zu werden - muß man doch nach Auskunft des Kassiers Prof.Kaiser genau denselben Mitgliedsbeitrag entrichten wie ein ordentliches Mitglied (24,71 Euro pro Jahr), um gleichzeitig allerdings wesentlich weniger Rechte zu besitzen. Die Möglichkeit einer außerordentlichen Mitgliedschaft ist also in gewisser Weise “totes Recht”, was meiner Meinung nach auch gut ist, weil ich die strukturelle Gewalt einer Zwei-Klassen-Gesellschaften auch im Sinne der Friedensforschung ablehne.
Firmen und Privatpersonen als fördernde Mitglieder wären äußerst willkommen, sie zu finden ist allerdings schwer. Der Kassier ist der Meinung, daß diese pro Jahr 10.000 Schilling (=726,73 Euro) spenden sollten, um freilich einzuschränken, daß der genaue Beitrag verhandelbar wäre. Nach den Statuten besteht die Möglichkeit, den auf diese Art gewonnenen Sponsoren den Ehrentitel eines “Stifters” oder “Gründers” der Vereinigung durch Vorstandsbeschluß zu verleihen. Möglicherweise bestünde hier noch ein Potential für Fund Raising-Aktivitäten.
Ordentliche Mitglieder haben drei Rechte und eine Pflicht. Die Pflicht besteht in der Bezahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrags von 24,71 Euro.
Dafür wird ihnen erstens gestattet, an den Veranstaltungen und Aktivitäten des Vereins teilzunehmen (über die sie natürlich auch in Kenntnis gesetzt werden) sowie seine Einrichtungen zu benutzen. Dieses Recht wird eingeschränkt durch die kryptische Formulierung “im Rahmen der Möglichkeiten”, was immer das auch heißen mag.
Zweitens darf ein ordentliches Mitglied an der Generalversammlung teilnehmen, die das “höchste Organ des Vereins” ist. Dort hat es Sitz und Stimme sowie das aktive und passive Wahlrecht. Die ordentliche Mitgliedschaft ist - das geht aus diesem Zusammenhang hervor - selbstredend Voraussetzung für die Übernahme “höherer” Aufgaben im Verein.
Drittens bekommen Mitglieder als zusätzliche Vergünstigung die viermal jährlich erscheinende wissenschaftliche Fachzeitschrift des Universitätszentrums zugeschickt (“Wiener Blätter zur Friedensforschung”).
Eine Mitgliedschaft kann einerseits durch freiwilligen Austritt beendet werden, wobei eine vierwöchige Frist nach Einlangen der schriftlichen Kündigung gilt, anderseits durch Vorstandsbeschluß, der allerdings an gewisse Bedingungen geknüpft ist und Einschränkungen unterliegt. Er kann einerseits gefaßt werden, wenn ein Mitglied seinen Beitrag für “mehrere aufeinanderfolgende Jahre” nicht bezahlt, wobei nicht klar ist, wieviele Jahre konkret gemeint sind. Bevor ein Ausschluß aus diesem Grund erfolgen kann, muß eine schriftliche Aufforderung an das Mitglied ergehen, den Beitrag innerhalb zweier Monate zu entrichten. Es kann eine Ratenzahlung genehmigt werden, eine Regelung, die mir bei der durchaus moderaten Höhe des Beitrags von 24,71 Euro pro Jahr sehr entgegenkommend erscheint.
Andererseits kann der Vorstand ein Mitglied ausschließen, das “den Vereinszielen oder dem Verein selbst in Schrift, Wort oder Tat geschadet hat”, was immer das wieder konkret heißen mag; eigentlich kann man das immer behaupten. Ein solcher Beschluß muß daher auch durch ein unparteiisches Schiedsgericht bestätigt werden. Da die Organisation aber auf Dialog, Frieden und Verständigung ausgerichtet ist und allgemein abweichenden Meinungen und sogar heftiger Kritik eine große Toleranz entgegenbringt, hat es eigentlich noch nie einen Fall gegeben, in dem man ein Schiedgericht einberufen mußte.
Wie bereits festgestellt, ist die Generalversammlung das höchste Organ der Vereinigung. Jedes ordentliche Mitglied hat dort Sitz und Stimme sowie das aktive und passive Wahlrecht. Eine ordentliche Generalversammlung muß mindestens alle zwei Jahre einberufen werden - und zwar auf Beschluß des Vorstands. Sie ist vom 1.Vorsitzenden mindestens vier Wochen nach Beschlußfassung anzuberaumen, wobei dieser alle ordentlichen Mitglieder mindestens 10 Tage zuvor schriftlich über Zeit, Ort und Tagesordnung der Versammlung zu unterrichten hat. Eine außerordentliche Generalversammlung kann jederzeit stattfinden. Sie erfolgt auf Vorstandsbeschluß oder, wenn ein Drittel der ordentlichen Mitglieder dies beantragt. Normale Beschlüsse bei der Generalversammlung erfolgen mit einfacher Mehrheit, Statutenänderungen mit 2/3-Mehrheit. Tatsächlich legt man aber auf umfassenden Konsens, praktisch sogar auf Einstimmigkeit wert. Die Generalversammlung ist beschlußfähig, wenn ein Drittel der ordentlichen Mitglieder anwesend ist; wenn man weniger Teilnehmer verzeichnet, kann der Präsident eine halbe Stunde nach dem ursprünglichen Termin die Generalversammlung nochmals eröffnen, die dann unabhängig von der Teilnehmerzahl gültige Beschlüsse fassen kann.
Das in der Praxis wichtigste Organ des Vereins ist der Vorstand, dessen Mitglieder von der Generalversammlung gewählt werden. Ihm “obliegt die Leitung des Vereins in all seinen Tätigkeitsbereichen”. Der Vorstand tritt in unregelmäßigen Abständen zusammen, wann immer eben seine Beschlüsse gebraucht werden, in der Praxis aber sicherlich “mehrmals im Jahr”. Momentan besteht er aus 13 Mitgliedern: Dem Präsidenten, dem 1. und 2.Vorsitzenden, der Generalsekretärin, dem Kassier, dem Schriftführer, dem Rechnungsprüfer und sechs Beisitzern, wobei eigentlich zehn erlaubt wären.
Der Vorstand ist international zusammengesetzt, was auch die Statuten vorschreiben. Dort heißt es, daß entsprechend der UNESCO-Richtlinien für internationale NGOs mindestens vier Nationen vertreten sein müssen. (Das UZF ist übrigens bei der UNO als Non-Governmental Organization, also NGO anerkannt). Daher gibt es im Vorstand auch gegenwärtig - neben der österreichischen Mehrheit - drei ausländische Forscher: Prof.Gary Bittner aus den USA, Prof.Leo Fretz aus den Niederlanden und Prof.Jürgen Schwarz aus Deutschland. Mitarbeiter aus dem Ausland zu finden ist allerdings schwierig, v.a. weil man intern Wert darauf legt, daß diese auch (so wie die drei Genannten) wirklich aktiv engagiert sind und nicht bloß auf dem Papier aufscheinen. Daß ein solches Engagement tatsächlich vorliegt, kann man z.B. daran ersehen, daß Prof.Bittner sich extra die Mühe gemacht hat, auf eigene Kosten von Pennsylvania nach Wien zu kommen, um beim Internationalen Symposium über Minderheiten im Mai 2001 einen (im übrigen ausgezeichneten) Vortrag zu halten, der übrigens im noch folgenden Bericht über das Symposium zusammengefaßt widergegeben ist.
Die beiden höchsten Funktionen sind die des Präsidenten und des 1.Vorsitzenden. Der Präsident leitet die Generalversammlung sowie den Wissenschaftlichen Beirat und den Ehrensenat - Gremien mit beratender Funktion. Der 1.Vorsitzende leitet die Vorstandssitzungen. Über die Zusammenarbeit der beiden heißt es in den Statuten:
“Der Präsident vertritt nach Absprache mit dem ersten Vorsitzenden den Verein nach außen...”
“Zur Vertretung des Vereins nach außen sind der Präsident und der erste Vorsitzende nach vorheriger Absprache befugt.”
Diese beiden Formulierungen sind uneindeutig und lassen einen weiten Spielraum für Interpretationen offen, vor allem hinsichtlich der Frage, wer von beiden im Zweifelsfall den Vorrang in der Vertretung nach außen hat. Die erste Formulierung legt eher einen Vorrang des Präsidenten nahe, die zweite eine Gleichberechtigung. Außerdem stellt sich die Frage, was “Absprache” bedeutet. Bedeutet das, daß man den anderen lediglich in Kenntnis darüber setzen muß, was man tut? Oder heißt es, daß z.B. dem 1.Vorsitzenden gegenüber dem Präsidenten ein Veto zukommt und umgekehrt (der Ausdruck “Absprache” könnte ja auch einen verpflichtend zu erreichenden Konsens implizieren)?
Ich könnte mir vorstellen, daß aus diesen Unklarheiten in ferner Zukunft und bei anderer Besetzung der Ämter einmal ein Kompetenzstreit entstehen könnte. Momentan ist dies allerdings nicht das Problem. Sowohl der 1.Vorsitzende als auch der Präsident sind um Konsens miteinander bemüht und darauf bedacht, aufeinander weitestgehend Rücksicht zu nehmen. Seit Leo Gabriels Zeiten ist es üblich, daß der Präsident als allseits anerkannte Integrationsfigur nach innen und Fürsprecher nach außen mit einer gewissen Prominenz und guten Kontakten zu Wissenschaft und Politik fungiert, während der 1.Vorsitzende stärker im “Tagesgeschäft” engagiert ist. Diese Arbeitsaufteilung hat man bis heute beibehalten.
In der Praxis kommt dem Amt des Generalsekretärs ebenfalls eine große Bedeutung zu. In den Statuten ist diese Funktion hinsichtlich ihrer Kompetenzen nur sehr vage bis überhaupt nicht definiert. Dort ist nämlich lediglich vermerkt, daß es 1.) ein solches Amt gibt und dieses mit Sitz und Stimme im Vorstand verbunden ist und 2.) der Generalsekretär - neben anderen - auch zeichnungsberechtigt ist. (Offizielle Schriftstücke im Namen des UZF müssen von zwei Funktionären unterzeichnet werden. Einer der beiden im Namen des UZF Unterzeichnenden muß immer Präsident oder 1.Vorsitzender sein. Der zweite Unterzeichnende kann u.a. auch der Generalsekretär sein.)
Tatsächlich investiert die Generalsekretärin den größten Teil ihrer Arbeitszeit in das Management und die Forschungsarbeit der Organisation, was ihr nicht zuletzt deshalb möglich ist, weil sie einen Dienstposten an der Akademie der Wissenschaft hält und von dieser dem UZF zugeteilt worden ist. Da sie eben einen großen Beitrag leistet und ihr Amt mit Sinn erfüllt, nimmt sie im UZF de facto eine Schlüsselposition ein. Wenn jemand anderer diese Aufgabe übernehmen und weniger Arbeitskraft investieren würde, wäre die Bedeutung des Postens des Generalsekretärs aber wohl weitaus geringer. Dies ist meiner Meinung nach überhaupt ein Charakteristikum der Organisation: Da die Statuten vielfach einem dehnbaren Gummiband ähneln und nur sehr allgemein und vage einen Rahmen definieren, wird dem Individuum viel Freiraum gelassen, sich selbst einzubringen. Wenn man bereit ist, Arbeitskraft zu investieren und einen substantiellen Beitrag zu leisten, kann man fast jede Position zu einer zentralen in der Organisation aufbauen. Dieser Hinweis mag allen Mitarbeitern des UZF als Ansporn zu stärkerem Engagement dienen.
Bedeutung haben noch der Wissenschaftliche Beirat bzw. der Ehrensenat. Sie haben beratende Funktion. Die Gremien haben den Sinn, daß Wissenschaftler aus ganz Österreich und auch international als Mitglieder dem Verein wissenschaftliches Know-How zur Verfügung stellen sollen, auch soll ein Netzwerk von persönlichen Kontakten zu Politikern, Prominenten etc. entstehen. Der Präsident übermittelt die Vorschläge der Gremien dem Vorstand. Dem Wissenschaftlichen Beirat kommt insoferne eine besondere Bedeutung zu, weil er auch als internes Kommunikationsforum dient. In seinem Rahmen finden zahlreiche außerordentliche Forschungsgespräche und Referate mit anschließender Diskussion zu verschiedensten Themen statt. Die interne Kommunikation der UZF-Mitglieder, das ist für die Public Relations wichtig, wird durch solche Aktivitäten ebenfalls verbessert.
4. Finanzierung des UZF
Der finanzielle Rahmen einer Organisation legt zugleich die Möglichkeit und Grenzen ihrer Public Relations fest.
Die Finanzierung des Vereins erfolgt über vier Quellen:
Subventionen
Inserate für die Zeitschrift
Mitgliedsbeiträge bzw. Abonnements
Freiwillige Spenden
Die Gesamteinnahmen betrugen im Jahr 2000 ca. 12.000 Euro. Der größte Teil wurde über Subventionen eingenommen (ca.8.000 Euro), wobei die Gemeinde Wien sowie das Wissenschaftsministerium die beiden Fund Giver waren. Die Einnahmen aus Spenden waren mit ca.180 Euro praktisch vernachlässigbar, nicht so die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und bezahlten Abos der Zeitschrift (ca.1.400 Euro) sowie aus Inseraten (ca.2.500 Euro). Von den Inserate wird bei der Analyse der “hauseigenen” wissenschaftlichen Fachzeitschrift “Wiener Blätter zur Friedensforschung” noch genauer die Rede sein. Die Gesamtausgaben lagen bei ca.10.500 Euro. Der größte “Brocken” waren dabei die Druckkosten für die Zeitschrift mit ca. 6.400 Euro. Es fielen ca.700 Euro Postgebühren an sowie ca.860 Euro diverse Ausgaben, v.a. für Bürobedarf. Ca. 2.600 Euro wurden für wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungsarbeiten verwendet. Man muß berücksichtigen, daß Referenten in der Regel kein Geld bekommen - es soll eine Ehre sein, an der Universität vortragen zu dürfen. Der größte Teil dieser Gelder wurde entsprechend für die publizistische Aufarbeitung der Kongresse u.a. ebenfalls in der Fachzeitschrift verwendet.
Gehälter bezahlt das UZF keine. Der Nucleus der Mitarbeitern besteht v.a. aus Professoren der Universität Wien bzw. Personal der Akademie der Wissenschaft, die von diesen Institutionen ihr Gehalt beziehen. Das UZF ist für sie eine Plattform zur Bündelung und Verstärkung ihrer im Rahmen der wissenschaftlichen Funktion ohnehin vorhandenen Forschungsaktivitäten zum Frieden und zur Internationalen Politik. Zahlreiche andere Mitarbeiter, die meist hochrangige Funktionen bei anderen Institutionen innehaben (z.B. Bundeskanzleramt, Wirtschaftskammer, Botschaften etc.), sind für das UZF ehrenamtlich tätig.
Das UZF bilanzierte im Jahr 2000 positiv, wobei allfällige Überschüsse, weil es sich ja um eine Non-Profit-Organisation handelt, bei nächster Gelegenheit in das Vereinsziel reinvestiert werden. Schulden hat das UZF keine. Es gibt einen kleinen finanziellen Polster, der beim Eintritt eines Wegfalls der gegenwärtigen Subventionen die Weiterführung der Geschäfte wenigstens für einen gewissen Zeitraum sicherstellen soll (man käme im absoluten Notfall vielleicht ein knappes Jahr aus), um nach einer Zeit der Überbrückung möglicherweise andere Subventionen lukrieren zu können; würde man dies in einem solchen Fall nicht schaffen, hätte man ein Problem.
Allgemein kann man eine gewisse Abhängigkeit von Subventionen feststellen, was für Non-Profit-Organisationen aber nicht untypisch ist. Obwohl ein im Vergleich mit anderen Organisationen erstaunlich großer Teil des Geldes über Mitgliedsbeiträge und Inserate für die Zeitschrift erwirtschaftet wird, wären die Aktivitäten im gegenwärtigen Umfang ohne staatliche Zuwendungen kaum denkbar.
Dennoch würde ich die finanzielle Situation des UZF und seiner Zeitschrift als gesund bezeichnen (keine Verluste, keine Schulden, gewisse Rücklagen für den Notfall, nicht unbeträchtliche Teilabdeckung der Ausgaben aus eigener Kraft). Der Kassier Prof.Kaiser hat mir glaubhaft versichert, daß sein Hauptanliegen in der Wachung über den möglichst sparsamen Einsatz der Mittel besteht.
Ich bin allerdings der Ansicht, daß die künftige Public Relations des UZF auf Aktivitäten des Fund Raising noch größeres Augenmerk zu legen hat; die Vergrößerung des budgetären Rahmens ist für effiziente P.R. unabdingbar - 12.000 Euro operatives Budget pro Jahr ist meiner Meinung nach zuwenig; ich plädiere tendentiell für die Expansion.
5. Gegenwärtige Forschungsfelder des UZF
Jeder Mitarbeiter des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) hat seine eigenen Interessen und seinen individuellen Zugang zur Wissenschaft - eine faszinierende Vielfalt, die uneingeschränkt positiv zu sehen ist. Manche Themen werden nur von einzelnen bearbeitet.
Erwähnenswert erscheint mir in diesem Zusammenhang der Kassier Prof.Kaiser, ein emeritierter Universitätsprofessor für medizinische Chemie, der auf den ersten Blick als “fachfremd” in der von Philosophen, Politikwissenschaftlern, Völkerrechtlern etc. dominierten Friedensforschungs-Institution erscheint. Sein Spezialgebiet ist allerdings die biologische und chemische Kriegsführung, ein Forschungsfeld, das hohe Kompetenzen in seinem nur schwer zugänglichen Fach erfordert und aufgrund der zunehmenden Terrorakte durch islamistische Fanatiker an Bedeutung gewinnt, existiert doch das längst nicht mehr unrealistische Alptraum-Szenario des fanatischen Attentäters mit biologischen und chemischen Waffen. Man wird in Österreich nur mit großen Schwierigkeiten einen Mann finden, der einerseits über hervorragende Kenntnisse in der medizinischen Chemie verfügt, andererseits bereits jahrelang für den Frieden aktiv ist und sich in die wissenschaftliche Literatur über internationale und innerstaatliche Konflikte eingearbeitet hat. Hier besteht möglicherweise eine Chance für das UZF, sich mangels Konkurrenz als vorrangige Informationsquelle der Medien zu diesem Thema zu profilieren. Andere UZF-Mitglieder können sich aber leider - mangels Wissens aus Medizin und Chemie - an seiner Forschung zu diesem Thema nur sehr eingeschränkt bis überhaupt nicht beteiligen. Die Zahl weiterer Themen, die eben einzelne für eine gewisse Zeit lang interessieren, ist Legion; es ist mir unmöglich, alle zu nennen.
Über manche Themen besteht wiederum kein Konsens, sondern es wird um eine klare Linie gerungen. U.a. im Expertengespräch mit dem Präsidenten erfuhr ich, daß es innerhalb des UZF zwei Gruppen gibt: Die erste, kleinere plädiert für die Beibehaltung der Neutralität und ist strikt gegen den Beitritt zu einem internationalen Verteidigungsbündnis wie der NATO, aber auch gegen ein europäisches Sicherheitsbündnis z.B. im Rahmen der EU. Die meisten übrigen Funktionäre hingegen stehen dem Beitritt zu einem internationalen Bündnis entweder positiv gegenüber oder halten diesen zumindest für überlegenswert. Wie die gesamte österreichische Gesellschaft ist das UZF über diese Frage also gespalten. Entsprechend meint auch der Präsident, er selbst und alle übrigen Mitarbeiter des Universitätszentrums könnten sich zu diesem Thema höchstens als Privatperson, aber nicht im Namen des UZF öffentlich äußern, weil zu dieser Frage intern einfach keine Einigung über eine gemeinsame Linie besteht.
In diesem Kapitel möchte ich in weiterer Folge nur jene Forschungsschwerpunkte anführen, die im Konsens und der praktischen Mitarbeit von allen oder zumindest fast allen Funktionären mitgetragen und die bereits über einen längeren Zeitraum hinweg und nicht nur in einer Einzelveranstaltung behandelt wurden. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll nur einen gewissen Eindruck von der Organisation vermitteln.
Es muß hervorgehoben werden, daß es innerhalb des UZF natürlich keinen von oben bestimmten, unveränderlichen Themenkatalog der Forschungsfelder gibt. So etwas wäre auch gar nicht sinnvoll, weil man dadurch sehr unflexibel würde. Die weltpolitische Lage ändert sich dauernd, eine Wissenschaft mit Praxisbezug wie die Friedensforschung muß immer aktuell und am Puls der Zeit sein. Außerdem würde eine Vereinigung für die Mitglieder schnell unattraktiv, wenn sie ihnen nicht erlauben würde, ihre individuellen Interessen einzubringen. Es ist also durchaus möglich und wahrscheinlich, daß sich die Themenstellung im Laufe der Zeit ändern wird. Man hat mir aber versichert, in absehbarer Zeit bei den in der Folge genannten Forschungsfeldern bleiben zu wollen.
Wie flexibel und aktuell das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) in der Regel arbeitet, sieht man aber z.B. allein daran, daß ich kurzfristig vor der Einreichung der Diplomarbeit erfahren habe, daß angesichts des aktuellen Flüchtlingselends in Afghanistan schon fieberhaft an der Vorbereitung eines Symposiums zum Thema “Flüchtlinge” gearbeitet wird. Anhand dieses durch die genannte Vorgangsweise zum Ausdruck kommenden Bestrebens, immer “am Puls der Zeit” zu sein, erkennt man die hohe Qualität, um die man hinsichtlich der eigenen Forschung in der Organisation bemüht ist. Daher sind auch die Forschungsfelder und Fragestellungen im ständigen Wandel begriffen; die folgende Aufzählung ist also lediglich ein Querschnitt zum Zeitpunkt meiner Recherchen.
5.1. Aktuelle Themen
LANDMINEN
Eine Landmine oder Anti-Personen-Mine ist eine Vorrichtungen, “die dazu bestimmt ist, durch die Gegenwart, Nähe oder Berührung einer Person zu Explosion gebracht zu werden, und die eine oder mehrere Personen kampfunfähig macht, verletzt oder tötet...” Dies ist die offizielle Definition aus dem Vertrag von Ottawa, um die lange gerungen wurde und die vorhergehende zweideutigere Definitionen ablöste. Nach Helmut Liedermann gibt es zahlreiche Gründe, warum Landminen moralisch abzulehnen sind:
Weltweit sind mehr als 100 Mio.Landminen in mehr als 60 Ländern aktiv. Im Schnitt gibt es täglich ca.30 Minentote und noch mehr Verletzte und Verstümmelte. Weltweit leben ca. 25.000 meist schwer geschädigte Landminenopfer.
Landminen sind “blinde” Waffen, d.h. sie unterscheiden nicht zwischen Soldaten und Zivilisten; auch Kinder sind Opfer.
Dem dauerhaften Frieden steht diese Waffe ebenfalls im Weg, weil sie noch lange nach Beilegung der Streitigkeiten Menschen töten und verstümmeln. Der Krieg, der eigentlich schon vorbei ist, wird durch die Landminen weitergeführt.
Diese Minen behindern die Landwirtschaft, die humanitäre Hilfe und richten - trotz der Tatsache, daß ihr Ankauf äußerst billig ist - immense wirtschaftliche Schäden an, v.a. durch die Kosten der Räumung einerseits sowie die medizinische Behandlung der Opfer andererseits. Die medizinische Behandlung ihrem Wesen nach immer beschränkt, weil die durch Minen verursachten gesundheitlichen Schäden (verlorene Gliedmaßen) meist irreversibel sind.
Einen völkerrechtlicher Fortschritt, der in diesem Ausmaß auf diesem Gebiet vorher von kaum jemandem für möglich gehalten worden war, stellte der Vertrag von Ottawa dar, der 1997 in besagter kanadischer Stadt von 97 Staaten unterzeichnet wurde (englische Bezeichnung: Treaty Banning Anti-personnel Mines). Später kamen weitere Staaten mit ihren Unterzeichnungen und anschließenden Ratifizierungen hinzu. Die 1999 in Kraft getretene Konvention beinhaltet folgende Verpflichtungen für die einzelnen Staaten:
Verbot der Herstellung, der Lagerung, des Einsatzes und der Weitergabe von Anti-Personen-Minen
Vernichtung aller bestehenden Lagerbestände innerhalb von vier Jahren nach dem Inkrafttreten der Konvention
Jährliche Berichte an die Vereinten Nationen über die zur Umsetzung der Konvention ergriffenen Maßnahmen und Vorlage von detaillierten Informationen über Art und Eigenschaft der Landminen, ihre Lagerung und ihre Vernichtung
Schnellstmögliche Vernichtung aller Anti-Personen-Minen in verminten Gebieten innerhalb des Hoheitsbereiches, auf jeden Fall aber innerhalb von 10 Jahren
Hilfe gegenüber anderen Ländern bei der Räumung der Minen sowie der medizinischen Versorgung und sozialen Wiedereingliederung der Landminenopfer; solche Solidarität darf von Staaten gesucht und in Anspruch genommen werden.
Besonders betroffen von Landminen sind weltweit folgende Länder: Angola, Äthiopien, Eritreia, Mocambique, Somalia, Sudan, Kambodscha, Irak (v.a. Kurdistan). In Europa sind v.a Bosnien und der Kosovo minenverseucht. In letzteren Gebieten wurden auch zivile Einrichtungen entgegen den Bestimmungen des humanitären Völkerrechts vermint. Die ursprünglich zu militärischen Zwecken vorhandenen Verminungen (z.B. entlang der Frontlinien) werden zunehmend auch eine Gefahr für Zivilisten, weil diese in besagte Gebiete, aus denen sie fliehen mußten oder vertrieben wurden, wieder zurückkehren; entsprechend stieg nach Kriegsende in Jugoslawien die Zahl der zivilen Minenopfer beträchtlich.
Organisationen, die sich um die Ächtung von Landminen besonders verdient gemacht haben, sind u.a. UNO, OSZE, aber auch insbesonders das Roten Kreuz. Letzteres kann sich zwar an der Räumung der Landminen aufgrund mangelnder Kapazitäten nicht beteiligen - das müssen letztlich Privatfirmen oder militärische Institutionen mit entsprechendem Know-How tun -, war aber im Vorfeld an der Vorbereitung der völkerrechtlichen Verbote durch Lobbying in Internationalen Organisationen und Sensibilisierung der Fachwelt beteiligt, hat seinen Schwerpunkt in der medizinischen Nachbetreuung der Opfer, eignet sich aufgrund seiner auf lokaler Ebene verankerten Strukturen auch zur Setzung von Maßnahmen zur “mine awareness”, d.h. es werden etwa Schüler in betroffenen Gebieten über die Problematik aufgeklärt.
KRISENHERD BALKAN
Aufgrund seiner ethnischen und religiösen Gegensätze galt der Balkan seit jeher als das “Pulverfaß Europas”. Der 1.Weltkrieg entzündete sich am Anlaß der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajewo. Der nach dem 1.Weltkrieg entstehenden Bundesrepublik Jugoslawien, von Tito nach 1945 als Volksrepublik neu geordnet, gelang es, die rivalisierenden Völker zu einem Staat zusammenzuschließen. Nach dem Niedergang des kommunistischen Ostblockes brach Jugoslawien zusammen; in Südosteuropa eskalierten daraufhin blutige und grausame Bürgerkriege, unter deren Eindruck wir noch heute stehen; und längst ist nicht gewiß, ob nach der von der von Serbien dominierten Bundesarmee heftig bekämpften Sezession Sloweniens und Kroatiens, dem durch Massenvergewaltigungen und sogenannten “ethnischen Säuberungen” gekennzeichneten Bosnienkrieg und dem Kosovo-Krieg, in dem sich die NATO genötigt sah, durch eine humanitäre Intervention zur Stabilisierung der Region und dem Schutz der Menschenrechte der Albaner einzugreifen, nicht der Ausbruch neuer Konflikte bevorsteht: In Makedonien gab es jüngst albanische Unruhen und in Montenegro gibt es auch eine starke Sezessionsbewegung von Rest-Jugoslawien, das durch die vielen Kriege verarmt und wirtschaftlich zerstört ist. Die Europäische Union versucht, diese durch die Auseinandersetzungen ruinierte Wirtschaft durch einen “Stabilitätspakt” wieder aufzubauen, der im Prinzip nach folgendem Muster funktioniert: Die Union zahlt Hilfsgelder an die Teilnehmer an dem Pakt, die dafür Verpflichtungen in Hinblick auf Demokratisierung und Menschenrechte erfüllen müssen. Es bleibt zu hoffen, daß das Projekt “Stabilitätspakt” erfolgreich ist und nicht durch neue Krisen erschüttert wird; die Auslieferung des ehemaligen Präsidenten der Serben Slobodan Milosevic, eines der Hauptschuldigen an der besonders brutalen Kriegsführung, an das Haager Kriegsverbrechertribunal, ist aber ohne Zweifel auch ein Zeichen in Richtung Normalisierung. Die Auslieferung kann aber nicht über noch immer vorhandene strukturelle Probleme hinwegtäuschen kann, die noch einer Lösung harren.
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) veranstaltete im Jahre 1996 ein Symposium mit dem Titel “Bosnien-Herzegowina - quo vadis? Entwicklung nach dem Friedensabschluß nach Dayton”. Es versuchte die Entwicklung abzuschätzen, welche Bosnien nach dem Dayton-Vertrag 1995 nehmen würde: Diesem auf internationalen Druck hin zustandegekommenen Vertrag gelang es, die Gewalt in Bosnien zu stoppen; der Vertrag hinterließ aber ein relativ kompliziertes und einigermaßen künstliches Staatengebilde und eine ganze Reihe von Problemen. Das Symposium wurde im November 2000 fortgesetzt durch eine Veranstaltung mit dem Titel: “Stabilisierung des Balkans: Fünf Jahre nach Dayton”, das eine Art Bestandsaufnahme beinhaltet. An dieser Themenwahl kann demostriert werden, mit welch großem Interesse das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) die Ereignisse und Entwicklungen am Balkan verfolgt.
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN (v.a. OSZE)
Gerade im Bereich Kenntnis von Internationalen Organisationen findet man im “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) große Kompetenzen, wobei v.a. die “Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa” (OSZE) eine Rolle spielt. Internationale Organisation sind Hauptakteure in der Friedensarbeit und leisten einen nicht unbeträchtlichen Beitrag zur Umsetzung der Menschenrechte.
Die aus der KSZE hervorgegangene OSZE war ursprünglich ein Instrument zum Abbau der Spannungen des Kalten Krieges und ein Forum für den Dialog zwischen Ost und West; auch heute, nach Fall des Eisernen Vorhangs, ist ihr Beitrag zum Frieden in Europa und der Welt unverzichtbar, zumal sie sich dadurch auszeichnet, 55 Staaten in den europäischen Sicherheitsdialog einzubinden - von den USA und Kanada über Rußland bis zu den kaukasischen Staaten. Dadurch erhält sie als Forum Möglichkeiten, die anderen Organisationen nicht zur Verfügung stehen. Die OSZE besitzt zahlreiche Organe mit verschiedenen Schwerpunkten; immer größerer Bedeutung kommt dem Ständigen Rat zu, der seinen Sitz in Wien hat; mit ihm steht ein handlungsfähiges und permanent einsatzfähiges Gremium zur Verfügung. Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges wurde - als Antwort auf die zunehmenden ethnischen Konflikte - das Amt eines Hohen Kommissars für nationale Minderheiten installiert, der als u.a. eine Art Frühwarnsystem funktioniert und Strategien zur friedlichen Konfliktbeilegung entwickelt.
Das wichtigste Dokument in der Geschichte der KSZE / OSZE ist ohne Zweifel die Schlußakte von Helsinki 1975, eines der wesentlichsten Völkerrechtsdokumente überhaupt. Es handelt sich dabei eine Konvention, die richtungsweisenden Charakter für die weitere Völkerrechtsentwicklungen hatte und stellt alleine dadurch, daß es im Konsens zwischen den beiden verfeindeten Blöcken stattfand, eine epochale Leistung auf dem Gebiet internationaler Vermittlungsbemühungen dar.
Die Schlußakte besteht im aus drei Kapitel, auch “Körben” genannt. Die Bezeichnung “Körbe” erklärt sich aus einem Kompromißvorschlag, der im Zuge der Verhandlungen entstand. Zwischen Ost und West gab es einen Streit um die Tagesordnung, auf die man sich nicht einigen konnte; jeder wünschte andere Themen. Der Streit, an dem die Verhandlungen durchaus scheitern hätte können, wurde durch einen gleichsam versöhnlichen, kreativen und durch seine Einfachheit bestechenden Kompromißvorschlag der österreichischen Delegation der OSZE unter der Leitung Helmut Liedermanns, heute 2.Vorsitzender des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF), gelöst. Dieser Vorschlag sah vor, daß drei Körbe zu verschiedenen großen Themen aufgestellt werden sollten; jede Delegation sollte ihre Wünsche dort quasi “einwerfen”, die dann allesamt in irgendeiner Form berücksichtigt werden sollten. Die Oberbegriffe, die eine Unzahl detaillierter Regelungen enthalten, sind folgende:
KORB 1: Fragen der Sicherheit in Europa
KORB 2: Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Umwelt
KORB 3: Zusammenarbeit in humanitären und anderen Bereichen
Ein Grundpfeiler der Schlußakte sind - neben anderen Kapiteln - die “zehn Prinzipien” aus Korb 1. Es ist aus Platzgründen unmöglich, an dieser Stelle eine umfassende Würdigung und Kommentierung dieser zu geben, noch dazu, wenn dies an anderer Stelle bereits viel besser geschehen ist; Interessierten sei für weitere Informationen diesbezüglich das Buch von Sigrid Pöllinger “Der KSZE / OSZE-Prozeß” empfohlen. Die zehn Prinzipien aufzählen möchte ich aber wenigstens:
1.) Souveräne Gleichheit, Achtung der der Souveränität innewohnenden Rechte
2.) Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von Gewalt
3.) Unverletzlichkeit der Grenzen
4.) Territoriale Integrität der Staaten
5.) Friedliche Regelung von Streitfällen
6.) Nichteinmischung in innere Angelegenheiten
7.) Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-,
Religions- und Überzeugungsfreiheit
8.) Gleichberechtigung und Selbstbestimmungsrecht der Völker
9.) Zusammenarbeit zwischen den Staaten
10.) Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen nach Treu und Glauben
Die Hauptaufgaben der OSZE sind seit der Unterzeichnung des Vertrags von Helsinki folgende:
Schutz der Menschenrechte und der ethnischen Minderheiten
Frühwarnung und Krisenmanagement
Überwachung und Durchführung demokratischer Wahlen
Hilfestellung bei der Demokratisierung ehemals autoriär regierter Länder (z.B. Reformländer im ehemaligen Ostblock)
Um diese und darauf abgeleitete Aufgaben erfüllen zu können, entsendet die OSZE Missionen in aller Herren Länder, v.a. in die Länder der ehemaligen Sowjetunion sowie auf den Balkan. Diese leisten einen Beitrag zur friedlichen Stabilisierung Europas tragen dazu bei, daß wir uns zwischen Atlantik und Ural auch in Zukunft des hohen Gutes des Friedens erfreuen können.
MINDERHEITENKONFLIKTE
Die vorliegende Arbeit beinhaltet Berichte über die beiden Veranstaltungen des UZF im Sommersemester 2001. Eine der beiden Veranstaltungen drehte sich um das Thema Minderheiten, daher möchte ich an dieser Stelle zu diesem Punkt wenig sagen.
Soviel sei aber vorweg festgestellt: Nach Einschätzung der Generalsekretärin des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) wird es in absehbarer Zeit keinen Krieg mehr in Europa geben, der nicht direkt oder indirekt etwas mit ethnischen Minderheiten zu tun hat. Gegenwärtig zeigt sich, daß Europa trotz Einigungsbemühungen auf internationaler Ebene in seinen einzelnen Regionen von starken ethnischen Separationsbewegungen geprägt ist. Von Nordirland bis Korsika, vom Baskenland bis Kurdistan und vor allem in der Krisenregion Balkan sieht man ethnische Minderheiten im Konflikt, oft sogar im offenen Krieg mit einer Mehrheit.
Auch in der zunehmend multikulturellen Gesellschaft Österreichs, das im Vergleich mit den angesprochenen Regionen natürlich sehr stabil und friedlich ist, zeigen sich entsprechende Konfliktlinien zwischen Mehrheit und Minderheiten. Ein Beispiel aus der kommunalen Politik, das einiges Aufsehen erregt hat, kann dies illustriert werden; es handelt sich um den Streit um die “Trauner Moschee”.
Es ging dabei um folgendes: Vom Bürgermeister der Gemeinde Traun (Dr.Peter Schlögl, SPÖ) erging am 18.9.1998 ein Abbruchbescheid gegen eine Moschee im Zentrum der kleinen oberösterreichischen Industriestadt. Als Grund dafür gab er in einem Rundschreiben an Parteimitglieder vom 24.3.2001 baupolizeiliche Mängel des Gebäudes an. Die moslemische Gemeinde war hingegen der Meinung, daß die baupolizeilichen Gründe nur vorgeschoben wären und Vorschriften auf dermaßen schikanöse Weise ausgelegt würden, wie es, so meinte man, gegenüber Österreichern niemals in dieser Form passieren hätte können.
Als besonders skandalös wurde bei dem ganzen Vorfall empfunden, daß nur kurz vor dem ersten größeren amtlichen Schritt gegen das Gebetshaus, der Untersagung der Benutzung des Gebetshauses am 29.6.1998 (das war ein paar Monate vor dem Abbruchbescheid), der Vizebürgermeister Ing.Herwig Mahr, FPÖ, einen Artikel im Organ seiner Partei, dem “FPÖ-Dialog” veröffentlicht hatte. In diesem stand u.a. unter der Zwischenüberschrift “Turban und Pluderhosen”, daß sich durch die Ansammlung von Moslems in der Fußgängerzone der Eindruck verstärke, daß in Traun ohnehin nur mehr Ausländer leben. Dies wiederum gefährde nach seiner Meinung die Anrainergeschäfte. Im Artikel kamen anonyme Trauner zu Wort, die beklagten, daß sie sich in der Bahnhofstraße (wo sich das Gebetshaus befand) wie am Balkan vorkämen, dort einfach nicht mehr wohlfühlten und daher ihre Einkäufe künftig woanders erledigen würden. Vizebürgermeister Mahr verlieh auch seiner Befürchtung Ausdruck, daß “wir Österreicher dort bald verjagt werden” oder “einen Passierschein brauchen”. Er meinte im oben zitierten Artikel außerdem wörtlich folgendes: “Die Freiheitlichen fordern die Behörden nun auf, die Mittel der Bauordnung und Gewerbeordnung auszuschöpfen, um die existenzbedrohenden Zustände zu beenden. Für uns Freiheitlichen kommen eben die Österreicher zuerst.”
U.a. aufgrund dieses tatsächlich nicht unbedenklichen Artikels entstand die richtige oder falsche Optik in der Öffentlichkeit, die Gemeinde wäre bei Vollstreckung ihrer Befugnisse diesem Aufruf gefolgt. NGOs wie z.B. der oberösterreichische Verein SOS Menschenrechte schlugen Alarm, es gab von moslemischer Seite - im übrigen gewaltlose - Demonstrationen und Hausbesetzungen, die Medien berichteten österreichweit. Im Zuge der Aktionen der islamischen Gemeinde wurde u.a. unter freiem Himmel gebetet, was die Anrainer als Provokation betrachteten. Hierbei zeigt sich meiner Meinung nach auf schockierende Weise, wie wenig die meisten Österreicher von anderen Kulturen wissen, wenn sie das Gebet der monotheistischen Religion des Islam, für das sogar der Papst lobende Worte findet, lediglich als eine Art Lärmbelästigung empfinden. Hier sind ohne Zweifel Defizite hinsichtlich der Aufklärung vorhanden.
Von anderen SPÖ-Politikern, z.B. Leonhard Dobusch, dem Sohn des Linzer Bürgermeisters und damals hochrangiger Funktionär der Sozialistischen Jugend, wurde an der Vorgehensweise der Gemeinde Traun und sinngemäß auch an seinem Parteikollegen, dem Bürgermeister Peter Schlögl, heftige Kritik geübt: “Man stelle sich vor, eine katholische Kirche würde abgerissen, bevor ein angemessener Ersatz verfügbar wäre. Die Aufregung wäre unglaublich.” Es muß in diesem Zusammenhang festgestellt werden, daß es Versuche seitens der Gemeinde gegeben hatte, solchen Ersatz zu finden. All diese Versuche scheiterten aber letztlich - teils, weil österreichische Hausbesitzer nicht an Moslems vermieten wollten, teils, weil die islamische Gemeinde Angebote von außerhalb der Stadt gelegenen Objekten als diskrimierend empfand und fürchtete, damit lediglich aus der Stadt verbannt zu werden. Letztlich wurde die Moschee nach jahrelangem Streit ohne entsprechenden Ersatz abgerissen.
Worum es mir in meiner Arbeit geht ist nicht, zu beweisen, wer damals im Recht oder im Unrecht gewesen ist, sondern nur, daß es Spannungen zwischen Mehrheit und Minderheiten in Österreich gibt; es ist mir im Grunde nicht wichtig, wer im konkreten Fall die Schuld daran getragen haben mag.
Es tun sich allerdings Abgründe auf, was - gelinde gesagt - unsensible Artikel in Parteizeitungen sowie Uninformiertheit hinsichtlich der Gebräuche von Minderheiten betrifft, egal, ob diese Faktoren nun für den Abriß der Trauner Moschee entscheidend gewesen sein mögen oder nicht. Wenn man nicht zu einem langfristigen Ausgleich und mehr gegenseitigem Verständnis findet, könnten ähnliche Konflikte in anderen österreichischen Gemeinden eines Tages mit Gewalt ausgetragen werden.
Die einzige Chance auf Friede mit ethnischen und religiösen Minderheiten, so die Überzeugung des UZF, scheint im Schutz ihres Kulturgutes und ihrer Partizipation zu liegen. Nur unter Beschreitung dieses Weges kann eine ausreichende Identifikation der ethnischen Minderheiten mit dem von einer anderen Mehrheit bewohnten multikulturellen Gesamtstaat entstehen - und es ist ein Faktum, daß praktisch jeder Staat in Europa multikulturell ist. Gewaltsame Unterdrückung einer Minderheit heizt die Konflikte nur zusätzlich an, bietet keine langfristige Lösung und vergrößert nur eine bereits bestehende Kluft.
FRIEDENSDIALOG DER WELTRELIGIONEN
Allgemeines
In Europa und weltweit gibt es zahlreiche religiöse bzw. kulturelle Konflikte, wobei diese nicht immer, aber sehr oft nur ein anderer Ausdruck der ethnischen Konflikte sind. Am Balkan sieht man dies sehr deutlich, wo die Ethnie auch in der Regel mit der religiösen Ausrichtung zusammenfällt (die Serben sind orthodox, die Bosnier Moslems, die Kroaten katholisch). Religiöse Differenzen können oftmals bereits vorhandene Konflikte anheizen und zusätzlich verstärken. Dabei liegt allerdings oft auch ein Mißbrauch der Religion und eine Verkennung der ursprünglichen Anliegen vor. Als Beispiel möge das Christentum dienen: Es gibt wohl auf diesem Planeten keine Religion, die einen genauso oder annähernd so friedfertigen und duldsamen Gründer wie Jesus Christus hat, sieht man vielleicht von einigen hinduistischen Lehrern ab, die ebenfalls moralische Größe in der Gewaltlosigkeit erlangen konnten. Dennoch wurden die Worte Christi in der Zeit der Kreuzzüge dahingehend ausgelegt, daß sie eine militärische Verbreitung des Glaubens erlauben sollten - eine grobe Verkennung ihrer wahren Absicht, wie nicht nur die heutige öffentliche Meinung, sondern u.a. der Papst feststellt, wenn er in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 1999 “In der Wahrung der Menschenrechte liegt das Geheimnis des wahren Friedens” meint:
“Gewaltanwendung im Namen des eigenen Glaubensbekenntnisses ist eine Verzerrung dessen, was die großen Religionen lehren. Wie verschiedene Religionsführer oft betont haben, so bekräftige auch ich, daß die Gewaltanwendung niemals eine begründete religiöse Rechtfertigung finden noch das Wachstum der wahren Religiosität fördern kann.”
Dem 1.Vorsitzenden des UZF Herrn Prof.Bader kommt das Verdienst zu, sich schon seit Jahren für einen “Friedensdialog mit dem Islam” eingesetzt zu haben, wobei sein Urteil, das sage ich vorweg, seit den Attentaten von New York aus heutiger Sicht fast schon prophetisch wirkt; er hat das Konfliktpotential zwischen Westen und islamischer Welt bereits lange vor seiner jüngsten Eskalation erkannt und sich für den Abbau der bestehenden Spannungen durch Dialoginitiativen eingesetzt.
Zweifellos war für seine Urteilsfindung hilfreich, daß er über eine in Österreich einzigartige Kompetenz im Bereich Religionskonflikte bzw. interreligiöse Vermittlung verfügt. Als Doktor der Politikwissenschaft ist er mit politischen Auseinandersetzungen vertraut; er war zudem ca. zwei Jahrzehnte lang als katholischer Religionslehrer an Gymnasien tätig, kennt also auch die verschiedenen Religionen gut; heute ist er Professor für Philosophie an der Univeristät Wien, wobei er sich v.a. mit Religionsphilosophie einerseits und Friedensforschung andererseits beschäftigt; auch sozialphilosophische Fragestellungen (z.B. Demokratietheorie) sind für ihn ein Thema. Er organisierte bereits mit Erfolg Friedensdialoge zwischen Christen und Hinduisten sowie zwischen Christen und Buddhisten an der Universität Wien. Auf diese Kompetenzen sollte das UZF in Zukunft keineswegs verzichten; sie sind bei anderen Organisationen nicht in diesem Ausmaß zu finden, in ihnen steckt also eine Chance zur öffentlichen Profilierung auf diesem Gebiet. Auch das UZF-Vorstandsmitglied Prof.Gary Bittner (USA), dessen Urteil als anerkannter Friedensforscher sehr wohl ins Gewicht fällt, hat in der Vergangenheit prinzipiell und mit guten Argumenten für einen “Friedensdialog mit dem Islam” plädiert hat.
Spätestens seit den Attentaten von New York ist klar, daß ein Konfliktpotential zwischen Westen und islamlischer Welt besteht und jede Friedensorganisation wohl das ihre beitragen muß, um deeskalierend zu wirken; vor dem 11.September 2001 war die Sinnhaftigkeit eines “Friedensdialoges mit dem Islam” UZF-intern aber leider dennoch nicht unumstritten, dazu später mehr. Ich denke, hier wird sich in Zukunft einiges ändern müssen, denn was muß nicht noch passieren, daß eine Friedensorganisation die bestehenden Probleme sowie Handlungsbedarf erkennt?
Betrachtet man die Geschichte des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) stellt man auf jeden Fall folgendes fest: Ein “Friedensdialog der Weltreligionen” war auch das Anliegen des Gründers des UZF Leo Gabriel. Wie im Kapitel über ihn entsprechend nachzulesen, hat er z.B. Initiativen gesetzt, zwischen Katholiken und Orthodoxen zu vermitteln.
Außerdem leitete Leo Gabriel einen “Friedensdialog zwischen Christen und Marxisten” ein, der über viele Jahre hinweg vom “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) weitergepflegt wurde. Man könnte diesen in gewisser Weise interpretieren als einen Dialog zwischen einer Religion und - mit Einschränkungen - einer Ersatzreligion. Es ist seit damals klargestellt, daß das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) auch Friedensdialoge mit Gesprächspartnern führt, die bedenklich sind, die Dialoge möglicherweise mißbrauchen können etc., weil eben in jedem Dialog auch Chancen stecken, ein mutiger Vermittler ein gewisses Risiko zu tragen hat und es außerdem überhaupt unmittelbar einleuchtend ist, daß man keine Vermittlungsbemühungen zwischen in Harmonie lebenden Freunden braucht, sondern daß ein Vermittler natürlich nur dann gebraucht wird, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist und es heftige Probleme und Vorbehalte gibt. Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) war damals aber nicht völlig blauäugig, naiv und unrealistisch, sondern versuchte, alle möglichen Probleme nach Kräften in den Griff zubekommen, daher entwickelte es anläßlich der Friedensgespräche mit den Marxisten ein oben dargestelltes Mediationsverfahren, die “Sieben Regeln des Friedensdialoges”, mit deren Hilfe man in der Lage war, z.B. Mißbräuche eines Friedensdialoges erfolgreich einzudämmen.
Ich möchte nun den theoretischen Hintergrund des “Friedensdialoges der Weltreligionen” erläutern, die v.a. in einer UZF-internen Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Politikwissenschaftlers Samuel Huntington beruht. Seine Grundgedanken und die Bedeutung dieser für einen “Friedensdialog der Weltreligionen” sollen hier dargestellt werden.
Die Weltkulturen
Samuel Huntington stellt sich die Welt der Gegenwart aufgeteilt in acht große Weltkulturen vor, die in einem komplexen, teilweise spannungsgeladenen Verhältnis zueinander stehen. Zunächst sollen diese Kulturkreise nur ganz kurz (unter bewußter Auslassung vieler Fakten) genannt werden, bevor in späteren Kapiteln näher auf einzelne Aspekte eingegangen wird.
Folgende Kulturkreise existieren nach Huntington:
Der hinduistische. Im Prinzip wird das Gebiet Indiens von diesem Kulturkreis umfaßt. Die lange Herrschaft des Westens (Indien war ja englische Kolonie) ändert nichts daran, daß auch dieser Kulturkreis überlebt hat; man sieht, wie widerstandsfähig Kulturen sind. Das Verhältnis des Westens gestaltet sich mit ihm noch relativ problemlos.
Der westliche. Es ist der Kulturkreis, dem wir nach Huntington angehören. Er besitzt im Prinzip drei territoriale Schwerpunkte: Europa (bis zur Trennlinie West- und Ostkirche), Nordamerika und Australien. Über diesen Kulturkreis wird in einem eigenen Kapitel noch ausführlich die Rede sein.
Der lateinamerikanische. Huntington ist sich nicht ganz sicher, ob man den lateinamerikanischen Kulturkreis als eigenen zählen kann oder ob er einen Teil des Westens darstellt. Auch die Lateinamerikaner sind über diese Frage gespalten; und vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte. Historisch gab es vor der europäischen Kolonisation indianische Hochkulturen, die vollkommen unabhängig von Europa bestanden. Die heutigen Lateinamerikaner stammen teilweise von diesen Indianern ab, teilweise von den europäischen Eroberern. Von Europa stammen wesentliche Kulturmerkmale, wie z.B. die beiden in Lateinamerika gesprochenen Hauptsprachen (Spanisch und Portugiesisch), sowie die Religion (Katholizismus, bei gegenwärtigem Vormarsch des Protestantismus). Auf der in Huntingtons Buch abgebildeten Karte wurde Lateinamerika aber letztlich als eigener Kulturkreis eingezeichnet.
Der orthodoxe. Für Huntington war die Spaltung von West- und Ostkirche in der Antike so fundamental, daß sie zur Begründung von zwei verschiedenen Kulturkreisen ausreichte. Der wichtigste, führende Staat (“Kernstaat”) der Orthodoxie ist Rußland, aber auch Länder wie Serbien, Bulgarien, Rumänien oder Griechenland sind diesem Kulturkreis zuzurechen. Die gegenwärtige Anlehnung Griechenlands an den Westen (Griechenland ist ja Mitglied der beiden den Westen dominierenden Bündnisse EU und NATO) kann nach Huntington an dieser kulturellen Verschiedenartigkeit nichts oder nur wenig ändern; er würde letzteres als eine Art Anomalie ansehen.
Der islamische. Historisch der hartnäckigste Gegner des Westens, der als einziger das Überleben des Abendlandes mehrmals in Frage gestellt hat, ist der auf der von Mohammed gestifteten Religion beruhende islamische Kulturkreis, der sich von Nordafrika bis ins vordere Asien erstreckt. Das Aufleben von dortigen fundamentalistischen Tendenzen, von denen später noch die Rede sein wird, kann den Westen nach Huntington vor ernsthafte Probleme stellen.
Der sinische. Dieser Kulturkreis hat den Weg zu einem Universalreich nahezu gefunden und wird im Prinzip nur von einem Staat umfaßt: von China. Auch dieser Kulturkreis, das wiedererstarkende “Reich der Mitte”, gehört nach Huntington zu den künftigen Herausforderern westlicher Macht.
Der japanische. Hier setzt Huntington ein Fragezeichen. Manche Autoren nehmen an, daß Japan ein Teil des chinesischen Kulturkreises ist. Huntington folgt allerdings den Autoren, die Japan als Kulturkreis Eigenständigkeit einräumen.
Der afrikanische. Huntington ist sich auch nicht sicher, ob es so etwas wie einen afrikanischen Kulturkreis gibt, nimmt letztlich daber doch einen an.
Was macht eine “Kultur” aus?
Bei der Definition von Kulturkreisen zitiert Huntington eine Stelle aus Herodots Historien, in der die Athener den Spartanern versichern, sie würden sie nicht an die Perser verraten und dies folgendermaßen begründeten:
“Vieles und Großes verbietet uns das, selbst wenn wir es tun wollten; erstens und hauptsächlich die niedergebrannten und zerstörten Götterbilder und Tempel, für die wir blutigste Rache üben müssen, ehe wir uns mit dem Manne, der das getan, versöhnen können; ferner die Bluts- und Sprachgemeinschaft mit den anderen Hellenen, die Gemeinsamkeit der Heiligtümer, der Opferfeste und Lebensweise. Es stünde den Athenern schlecht an, wenn sie an dem allen Verrat üben wollten”.
All diese genannten Faktoren spielen also eine Rolle. Als den wichtigsten Faktor betrachtet Huntington allerdings die gemeinsamen Wertvorstellungen, und hier ist vor allem die Religion entscheidend. Die gemeinsamen Werte, aus denen letztlich auch politische Institutionen entspringen, sind für Huntington sogar entscheidender als alle biologischen und rassischen Überlegungen. “Die wesentlichsten Unterschiede zwischen Menschengruppen betreffen ihre Überzeugungen, Werte, Institutionen und Gesellschaftsstrukturen, nicht ihre Körpergröße, Kopfform und Hautfarbe”, schreibt er.
Der “Kampf der Kulturen”
Wichtig in den Überlegungen Huntingtons ist sein Begriff des Bruchlinienkriegs. Eine Bruchlinie liegt vereinfacht gesagt dort, wo zwei Kulturkreise aneinanderstoßen. An dieser Bruchlinie kann es zu allerlei Formen von Konflikten und Grenzstreitigkeiten kommen. Neben internationalen Bruchlinienkriegen kann es auch innerstaatliche geben: Diese können dan entstehen, wenn ein Staat das Gebiet von zwei oder mehreren Kulturkreisen umfaßt. Diesem Staat droht Spaltung und Bürgerkrieg. Eines von dutzenden möglichen Beispiel für einen typischen innerstaatlichen Bruchlinienkrieg wäre Tschetschenien. Die Russische Föderation wird von einer großen Mehrheit von Menschen bewohnt, die zum orthodoxen Kulturkreis gehören. Der Staat umfaßt aber auch Gebiete des islamischen Kulturkreises. Ein islamisches Gebiet im Süden, Tschetschenien, wollte sich nun von Rußland abspalten; russische Truppen beanspruchten dieses Gebiet aber und führten einen brutalen, von Menschenrechtsverletzungen und Genozid begleiteten Krieg, in dem sie Tschetschenien mittlerweile wieder zurückeroberten.
Auch der Jugoslawienkrieg kann als Bruchlinienkrieg aufgefaßt werden. Es scheint mir aufgrund seiner umfangreichen Besprechung des Jugoslawienkriegs, daß dieser Huntington sehr stark bewegt und ihn möglicherweise zur Niederschrift des “Kampfs der Kulturen” inspiriert hat - ähnlich wie Thomas Hobbes einst den “Leviathan” als Antwort auf den Bürgerkrieg in seiner Heimat England verfaßt hat. Im ehemaligen Bundesstaat Jugoslawien lebten Angehörige dreier Kulturkreise friedlich miteinander vereint: Slowenen und Kroaten, die eher dem Westen zuzurechnen sind, Serben, die man zum orthodoxen Kulturkreis zählen kann und moslemische Bosnier und Albaner, die dem islamischen Kulturkreis angehören. Nach vielen Jahrzehnten der friedlichen, multikulturellen Koexistenz in einem Bundesstaat brachen nach dem Niedergang des Kommunismus die alten kulturellen Identifikationsmuster wieder hervor und ein grausamer, blutiger Krieg zwischen den einzelnen Gruppen nahm seinen Lauf.
Huntington meint nun weltweit folgende Tendenz zu beobachten: “Eine auf kulturellen basierende Weltordnung ist im Entstehen begriffen: Gesellschaften, die durch kulturelle Affinitäten verbunden sind, kooperieren miteinander”. Er beobachtet einen “Schulterschluß” kulturell verwandter Länder. Besonders auffallend ist dieser in Europa, wo sich kulturell verwandte Staaten zu einer großen Union zusammenzuschließen beginnen. Aber auch chinesisches und islamisches Selbstwertgefühl erwacht (davon wird später die Rede sein). Huntington befürchtet nun für die Zukunft, daß diese Weltkulturkreise, deren Staaten untereinander immer enger miteinander kooperieren, eines Tages zusammenprallen könnten und ein Krieg zwischen ihnen eskaliert, daß also im großen Stil das passiert, was im kleineren Maßstab in Jugoslawien vorgemacht wurde. Besonders wahrscheinlich scheint es ihm, daß ein solcher möglicher globaler Kulturkampf durch universalistische Ansprüche des Westens ausgelöst werden könnte - eines Kulturkreises, der nach Huntigtons Meinung schon jetzt im potentiellen Konflikt mit China und dem islamischen Kulturkreis steht. Darauf soll im nächsten Kapitel eingegangen werden.
Der Westen und seine Herausforderer
Der Begriff “Westen” stammt aus dem Kalten Krieg, der nach 1945 einsetzte und bis zum Fall der Berliner Mauer 1989 bzw. bis zur Auflösung der Sowjetunion 1991 andauerte. Das Wort “Westen” bezeichnet jenen Machtblock, dem der von der Sowjetunion dominierte “Osten” feindselig gegenüberstand. Die Bedrohung durch den Osten ist nun vorbei, wie ein historisches Relikt ist das Wort “Westen” geblieben. Huntington verwendet jenes Wort zur Bezeichnung des Kulturkreises, in dem wir leben. Er verwendet dieses Wort allerdings nur, weil es heutzutage geläufig ist. Das, was Huntington mit dem “Westen” meint, ist in Wahrheit aber viel älter als die nach 1945 entstandene Bezeichnung. Genauer gesagt, entstand dieser heute als “Westen” bezeichnete Kulturkreis im frühen Mittelalter auf den Trümmern des von Germanen überrannten römischen Imperiums. Spengler, dessen Einfluß auf Huntington unübersehbar ist, würde die ältere Bezeichnung “Abendland” verwenden.
Ich möchte nun in eigenen Worten Huntingtons Ansicht über die Geschichte des Westens darlegen. Ursprünglich in Gebieten von Kunst, Wissenschaft und Technologie den anderen Kulturen weit unterlegen (die Chinesen entdeckten z.B. Schießpulver oder Prozellan Jahrhunderte bevor es in Europa Verwendung fand), änderte sich dies schlagartig zu Beginn der Neuzeit. Der Westen baute ca. ab der Frühen Neuzeit eine den anderen Kulturen in vielerlei Hinsicht überlegene Technologie auf. Spätestens seit dem 19.Jahrhundert, eigentlich schon viel früher, machte er sich diese Überlegenheit zunutze und schuf gewaltige Kolonialreiche, die den größten Teil der Erdoberfläche umfaßten, u.a. fast ganz Afrika, Indien sowie Gebiete des Nahen Osten, Südostasiens, Südamerikas etc. In der Zwischenzeit konnte der Westen auch zwei weitere Kontinente besiedeln, nämlich Nordamerika und Australien, die neben Europa bis heute zu den “Hauptstützpunkten” der westlichen Kultur gehören.
Bis heute kann man eine Hegemonie des Westens über die gesamte Welt feststellen. Die USA, der als mächtigster Staat des Westens im 20.Jahrhundert die Nachfolge der ursprünglich übermächtigen Europäer angetreten hatte, sind nach wie vor die einzige Weltmacht. Sie besitzen - ungleich aller anderen Staaten - die Fähigkeit, an jedem Punkt der Welt militärisch zu intervenieren. Das große Verteidigungsbündnis des Westens, die NATO, hat global keinen nur annähernd vergleichbaren Konkurrenten.
Auch in Hinblick auf die Wirtschaft dominiert der Westen. Die sogenannten G7-Staaten, also die sieben größten Wirtschaftsmächte der Welt, sind bis auf eine Ausnahme Staaten, die man dem Westen zurechnen kann. Daß mittlerweile die G7-Gruppe um ein achtes Mitglied, Rußland, erweitert wurde, tut nichts zur Sache, weil diese Erweiterung eigentlich “Höflichkeit” und diplomatischer Schritt zur Versöhnung nach dem Zusammenbruch des Ostblocks war; Rußland ist heute ein wirtschaftlicher Zwerg, in dem Armut, Chaos und Gesetzlosigkeit herrscht. Nach wie vor ist der Westen also die einflußreichste Kultur auf diesem Planeten; auch kulturell gilt er weithin als Vorbild.
Gleichwohl kann ein gewisser Verfall westlicher Macht nicht übersehen werden. Vergleicht man z.B. die Größe der vom Westen errichteten Kolonialreiche des 19.Jahrhunderts mit der heutigen Weltkarte, so entdeckt man den fundamentalen Unterschied, daß der Westen nur mehr Herr über seine “Kerngebiete” ist; seine Herrschaft ist kleiner geworden.
Auch um die militärische Macht ist es nicht so gut bestellt, wie es scheint. Die USA bzw. die NATO führen oftmals Kriege gegen weit unterlegene Staaten und triumphieren meist dabei, etwa gegen den Irak oder zuletzt gegen Serbien. Aber peinliche Niederlagen selbst gegen solche Mini-Staaten (Vietnam!) werfen ein bedenkliches Bild auf die westliche Macht. Ein Krieg des Westens gegen China wird bereits jetzt als fast aussichtslos betrachtet. Und dieselbe westliche Großmacht, Großbritannien, die einst allein China im Opiumkrieg niederzwang, mußte 1997 widerstandslos Hongkong an diese kommunistische Diktatur übergeben. Gleichzeitig pflegen alle kritischen Stimmen zu verstummen, wenn ein chinesischer Staatsmann Europa besucht. Die europäischen Politiker, sonst die größten Moralapostel und Sonntagsredner zum Thema “Menschenrechte”, die ansonsten fleißig chinesische Menschenrechtsverletzungen anprangern, sprechen diensteifrig dieses Thema in Gegenwart eines hochrangigen chinesischen Besuchers nicht einmal an, in der Furcht, widrigenfalls lukrative Wirtschaftsaufträge nicht zugesprochen zu bekommen. Die Mutigsten formulieren unterwürfige Bitten an China - ohne aber bei Nichterfüllung Konsequenzen androhen zu können -, doch möglicherweise daran zu denken, gnädigerweise die Menschenrechte anzuerkennen und einzuhalten, wobei sie vergessen, daß Menschenrechte angeboren sind und es keine Frage von Nettigkeit und Gnade sein darf, ob sie gewährleistet werden oder nicht.
Um dieses typische Vorgehen unserer Politiker zu dokumentieren, möchte ich einen Zeitungsartikel zitieren, betitelt mit der Überschrift “Milliardenaufträge im Walzertakt”.
“Chinas Staatspräsident Jiang Zemin weiß, was seinen Gastgebern gut tut: Gegenüber Frankreichs First Lady Bernadette Chirac erwies er sich als Charmeur und forderte sie beim Besuch des Dorfes Chaumeil spontan zu einem Walzer auf. Ihren Mann, Jacques Chirac, verwöhnte er mit einem Großauftrag über 28 Airbus-Flugzeuge. (...) ‘Das ist gut für Europa, gut für Frankreich, und das ist gut für den Arbeitsmarkt’, verkündete Chirac voll Stolz. In der pragmatischen Reihenfolge zuerst das Geschäft und dann die Moral, sprach der französische Präsident anschließend auch die Menschenrechtssituation in China an und bat um die rasche Ratifizierung der UNO-Vereinbarung über Bürgerrechte.”
Jacques Chirac war dabei noch mutig; das Wort Menschenrechte wäre anderen Europäern in dieser Situation gar nicht in den Mund gekommen, wie die Erfahrung lehrt. Daß sich trotzdem die Menschenrechtssituation in China seither nicht verbessert hat, braucht wohl nicht extra festgestellt werden. Wieso sollte dies auch so sein, wenn unsere demokratischen Staatsoberhäupter asiatische Despoten in einer unverhüllten Weise hofieren, von ihnen in hohem Ausmaß wirtschaftlich abhängig und ihnen zudem auch militärisch nicht gewachsen sind?
Neben dem wiedererstarkten China sieht Huntington vor allem einen großen Herausforderer des Westens: den wiederstarkenden Islam. Ich möchte daher im Anschluß über den islamischen Fundamentalismus sprechen.
In der gesamten arabischen Welt kann man eine Renaissance des Islam feststellen. Diese Entwicklung kann man auch mit empirischen Daten belegen. Huntington berichtet, daß es 1989 in Zentralasien nur 160 funktionierende Moscheen und eine einzige islamische Hochschule gab, bereits 1993 gab es 10.000 Moscheen und zehn Hochschulen. Diese Explosion hängt u.a. mit dem Zusammenbruch des Kommunismus zusammen; in sein Vakuum stoßen in zentralasiatischen Gegenden Religionen wie der Islam. Aber auch in der übrigen islamischen Welt blüht der Islam wieder auf. Man beobachtet bei weiten Bevölkerungskreisen eine verstärkte Beachtung religiöser Praktiken (Moscheebesuch, Fasten, Gebet), zudem verstärkte Versuche, das alte islamische Recht zu reaktivieren. “Den Einfluß der islamischen Resurgenz auf die Politik der östlichen Hemisphäre zu ignorieren, ist gleichbedeutend mit dem Ignorieren des Einflusses der Protestantischen Reformation auf die europäische Politik im ausgehenden 16.Jahrhundert”, meint Huntington. Die Rückbesinnung auf den Islam wird hauptsächlich von jungen Menschen getragen; und aufgrund der Bevölkerungsexplosion in der islamischen Welt entsteht eine zusätzliche Dynamik dieses Phänomens.
Das Wiedererstarken des Islam führt aber auch verstärkt zu fundamentalistischen Bewegungen. Man kann mit Fug und Recht sagen, daß Fundamentalisten in praktisch allen arabischen Staaten der Welt auf dem Vormarsch sind. Durch ihre radikale Koran-Interpretation, ihren oftmals fanatischen Glaubenseifer und ihre anti-westliche Gesinnung gefährden sie die Stabilität zahlreicher Regionen. Es kann nicht Aufgabe der vorliegenden Arbeit sein, eine umfassende Darstellung des islamischen Fundamentalismus in allen Ländern der islamischen Welt zu geben. Anhand eines längeren Zitats über Algerien aus einem religionswissenschaftlichen Buch, das sich u.a. mit dem islamischen Fundamentalismus befaßt, soll gezeigt werden, zu welch empörenden Zuständen dieser führen kann.
“Auch in Algerien verschärfte sich der Druck der Fundamentalisten in der letzten Zeit dauernd. Im Sommer 1989 griff in verschiedenen Gebieten des Landes ein Sitten- und Gesinnungsterror der Moslembrüder um sich. In einzelnen Stadtteilen und Provinzen errichteten fundamentalistische Patrouillen Straßensperren, kontrollierten die Papiere der Passanten und trieben unverheiratete Paare notfalls auch mit Prügeln auseinander. Modern denkende Ehemänner, die ihren Frauen gestatteten, sich außerhalb ihrer Wohnung aufzuhalten, und Bürger, welche ihre Kinder nicht zur Koranschule schickten, wurden denunziert und geächtet. In verschiedenen Universitäten und Fakultäten konfrontierten islamistische Aktivisten die Professoren stundenlang mit Koran-Zitaten. Mehrere Bibliotheken gingen in Flammen auf. In der Universitätsstadt Blida verhinderten mit Knüppeln bewaffnete Integristen vor einiger Zeit gewaltsam eine Demonstration von Studentinnen, die gegen diese ständigen Belästigungen, Kleidervorschriften und Drohungen protestieren wollten. Am 23.November und am 14.Dezember 1989 demonstrierten Frauen, Künstlerinnen und Intellektuelle in Algier gegen die ‘Intoleranz in allen Formen’ und gegen deren Duldung durch den Staat. Kurz zuvor hatte Abassi Madani, einer der fundamentalistischen Führer erklärt, daß Demonstrationen von Frauen ‘eine der größten Gefahren’ für das Schicksal Algeriens darstellten.Er beschimpfte die kämpferischen Frauen als ‘Speerspitze des Neokolonialismus’ und als ‘Avantgarde der kulturellen Aggression’. In der Provinzstadt Ourgla, rund 800 Kilometer südöstlich von Algier, hatten im Juni 1989 rund ein Dutzend Fundamentalisten kaltblütig das Haus einer geschiedenen Frau angezündet, der sie im Rahmen einer Hetzkampagne unmoralischen Lebenswandel vorgeworfen hatten. Durch die Täter aufgehalten, kam die Feuerwehr zu spät an die Brandstelle, weswegen die dreijährige Tochter in den Flammen erstickte. Im Frühjahr 1990 verstärkte sich der Straßenterror der Fundamentalisten weiter. Die Neue Zürcher Zeitung beschrieb die Situation folgendermaßen: ‘Parapolizeiliche Kommandos der Integristen gehen gegen die Besucher von Diskotheken und Restaurants vor und kontrollieren auch die Zugänge der Hochschulareale, um die Studentinnen, wie es heißt, vor ‘unsittlicher männlicher Annäherung’ zu schützen und zu moralischem Verhalten anzuhalten. Ihre Sittenkontrolle konzentriert sich generell auch die Frauen, deren wachsende Emanzipation - wenn nötig mit Gewalt - so rasch als möglich wieder rückgängig gemacht werden müsse.’ ”
Man muß in diesem Zusammenhang natürlich auch feststellen, daß der islamische Fundamentalismus in der arabischen Welt oftmals eine Antwort auf die sozialen Probleme ist (Arbeitslosigkeit, Überbevölkerung), ferner auf Jahrhunderte des westlichen Kolonialismus. Fundamentalismus bei moslemischen Einwanderern ist oft eine Antwort auf Verweigerung von Lebenschancen und Rassismus hierzulande. Trotz all dieser Feststellungen ist die Grundtendenz des islamischen Fundamentalismus bedenklich und abzulehnen (die Ursachen von etwas zu verstehen, heißt ja nicht automatisch, es gutzuheißen); und es ist mit Huntington sicherlich gerechtfertigt, den islamischen Fundamentalismus als eine der großen Herausforderung der westlichen Werte in der Gegenwart zu sehen, die damit, entgegen häufiger abendländischer Illusionen à la Fukuyama, keineswegs den Anspruch erheben können, von allen Menschen dieser Welt akzeptiert zu sein.
Im Sommer 2001 gab es eine Eskalation des Konfliktes zwischen Westen und Islamisten, den außer Huntington und seine Kenner im “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) wohl niemand für möglich gehalten hat. Die Ereignisse von New York sind hinlänglich bekannt; alle Menschen der westlichen Welt stehen noch unter dem Eindruck der schrecklichen Fernsehbilder. Trotzdem eine kurze Rekapitulation:
Am 11.September 2001, um 13 Uhr 58, schlug ein Passagierflugzeug vom Typ Boeing in den südlichen Turm des World Trade Centers in New York ein, das eines der höchsten und bedeutendsten Gebäude der Welt gewesen war. Dicke, schwarze Rauchschwaden quollen aus dem 110 Stockwerke hohen Turm.
Zunächst dachten manche, es läge ein tragischer Unfall vor, aber diese Annahmen wurden einige Minuten später für die letzten Zweifler ersichtlich widerlegt, als um 14 Uhr 05 eine zweite Boeing auch noch in den nördlichen Turm einschlug. Die mit hochexplosiven Kerosin gefüllten Maschinen lösten ein tödliches Feuer aus, das die beiden Türme innerhalb der nächsten eineinhalb Studen zum Einsturz brachte. Zurück blieben Ruinen, ein Chaos in New York, dunkle und einen großen Teil der Stadt bedeckende Staubwolken, eine aus Manhattan in Panik fliehende Masse, zahlreiche Todesopfer und eine zerstörte Skyline. Das Herz der internationalen Finanzwelt, Arbeitsplatz von ca.50.000 Menschen, wurde in den Attentaten vollständig vernichtet; die gesamte Nation war zutiefst geschockt. Präsident Bushs in den Monaten zuvor durch Worte und Taten zum Ausdruck gebrachter Glaube, er könne sein Land von der internationalen Welt und insbesonders vom Nahostfriedensprozeß weitgehend isolieren und es sich in einer globalisierten Welt erlauben, ausschließlich U.S.-amerikanische Innenpolitik zu betreiben, hat sich spätestens zu diesem Zeitpunkt als politische Fehleinschätzung erwiesen.
Es kam noch schlimmer: Kurze Zeit nach den Attentaten auf das World Trade Center, um 14 Uhr 53, schlug ein weiteres Passagierflugzeug in die strategische und militärische Kommandozentrale der USA (das Pentagon in Washington D.C.) ein. Das riesige, charakteristisch fünfeckige Gebäude, in dem ca.23.000 Menschen arbeiten, ist das Hauptquartier des amerikanischen Verteidigungsministeriums; es galt vor dem Sommer 2001 als das sicherste Gebäude der Welt. Es blieb trotz Anschlag weitgehend intakt, aber ein Teil wurde zum Raub der Flammen; wirklich vernichtend war aber weniger der materielle Schaden, sondern die Symbolwirkung, daß die mächtigste Nation der Welt in ihrem Zentrum angreifbar war.
Eine vierte gekaperte Maschine, die vielleicht nach Camp David unterwegs war, um das berühmte Symbol des Nahost-Friedensprozesses zu vernichten (Jimmy Carter hatte an diesem Ort einen Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten vermittelt), erreichte ihr Ziel nicht. Die todgeweihten Passagiere, unschuldige Zivilisten, konnten via Handy erfahren, was die Terroristen wahrscheinlich planten und nahmen - so die ersten Zeitungsmeldungen - einen verzweifelten, aber entschlossenen Kampf mit den Entführern auf. Dieser Kampf führte dazu, daß die Maschine in der Nähe von Pittsburgh niederging, es gab keine Überlebende.
Nachforschungen ergaben, daß diese Entführungen nur durch eine Höchstleistung an Koordination und jahrelanger Vorbereitung möglich gewesen sind; und man kann mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß islamische Fundamentalisten hinter den Attentaten stecken. Als Hauptverdächtiger dabei gilt das Terrornetzwerk Al-Quaida unter seinem Führer Osama bin Laden. Besagter Islamist hat z.B. einige Monate zuvor öffentlich einen heftigen Schlag gegen die USA angekündigt, ist schon in manche andere Attentate verstrickt gewesen und sich in auch in jüngster Zeit durch besonders hetzerische Aussagen gegen die USA, die UNO und den Westen unangenehm hervorgetan.
Der genaue Aufenthaltsort Osama bin Ladens war damals und ist auch zur Zeit unbekannt; man vermutete ihn ursprünglich im von den fundamentalistischen Taliban beherrschten Afghanistan, irgendwo versteckt im unwegsamen Bergland. Die sogenannten Taliban (“Koranschüler”) hatten dort eine international hefitg kritisierte theokratische Diktatur geschaffen, die ihr seit dem Einmarsch sowjetischer Truppen vom Krieg gezeichneten Land - das kann man objektiv sagen, ohne andere Kulturen zu diskriminieren - in einer brutalen Unterdrückung hielt. Besonders unangenehm aufgefallen waren die Taliban der internationalen Gemeinschaft bereits durch die Vernichtung von buddhistischen Kulturgütern sowie der heftigen Unterdrückung der Frauen, die unter Androhung unmenschlicher Strafen gezwungen wurden, Ganzkörperschleier zu tragen, dazu keinen Beruf ausüben, keine Schule besuchen dürfen und vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen waren. Nachdem das Ultimatum der USA an die Taliban verstrichen ist, Osama bin Laden ohne weitere Bedingungen bzw. ohne Vorlage von Beweisen für seine Schuld auszuliefern, was diese verweigerten, begannen Militäroperationen der USA auf afghanischem Gebiet. Unklar bleibt im Zusammenhang mit diesem Krieg die Antwort auf die vom deutschen Nahostexperten Peter Scholl-Latour gestellte Frage, ob ein “klassischer” internationaler, also zwischen zwei Staaten geführter Krieg das adäquate Mittel zur Bekämpfung einer in ca.sechzig Ländern operierenden Geheimorganisation ist, die durch ihre eigentlich schwer angreifbare Struktur (verdeckt arbeitende, vielfältig vernetzte, aber dennoch weitgehend voneinander autonome Zellen) völlig neuartige Sicherheitsprobleme aufwirft, die womöglich auch neuartige Lösungen fordern.
Auf jeden Fall wird der Krisenherd Afghanistan noch einige Zeit nicht zur Ruhe kommen, obwohl nach anfänglichen Pannen (so sprach der außenpolitisch unerfahrene Präsident Bush ungeschickterweise zunächst von einem “Kreuzzug gegen den Terrorismus”, eine Aussage, die er nach empörten Reaktionen seiner islamischen Verbündeten wieder zurückziehen mußte) beträchtliche militärische Erfolge der USA erzielt werden konnten. Man hüte sich, den Propheten über den Kriegsausgang zu spielen, niemand kann diesen zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen wirklich kennen, denn die Kämpfe sind noch im Gang. Wahrscheinlich wird es im Endeffekt tatsächlich, wie manchmal kolportiert und erhofft, ein einfacher Sieg über einen technisch weit unterlegenen Gegner ohne Luftwaffe, Fliegerabwehr oder moderne Kampfausrüstung. Es konnte ja bereits eine international anerkannte Übergangsregierung in Kabul installiert werden. Dennoch sollte man die zahlreichen militärischen Möglichkeiten nicht unterschätzen, die das bergige und zerklüftete Land noch für einzelne Partisanengruppen bereithält, selbst wenn die Taliban bereits aus praktisch allen Städten vertrieben und relevante Teile ihrer Streitkräfte vernichtet sind. Ob der Verbündete der USA, die gegen die Taliban opponierende “Nordallianz”, auch wirklich ein verläßlicher und unbedenklicher Partner für die Gestaltung der Zukunft Afghanistans ist oder ein potentielles neues Problem, ist auch in einer öffentlichen Debatte noch nicht zufriedenstellend geklärt worden.
Friedensstifter Huntington
Samuel Huntington hat einen einigermaßen schlechten Ruf; er gilt bei Befürworter von interkulturellen Dialogen als jemand, der eben solche durch seine die Unterschiede zwischen den Kulturen betonenden Theorie verunmöglichen will. Genau das Gegenteil ist aber der Fall! Eben weil Probleme bestehen, meint Huntington sinngemäß, wird man zu einem friedlichen Verhältnis mit anderen Kulturkreisen und insbesonders dem Islam gelangen müssen. Initiativen sollen seiner Meinung nach ergriffen werden, um die interreligiösen bzw. interkulturellen Konflikte zu entschärfen und den überall aufstrebenden Fanatikern Sympathien der Bevölkerung zu entziehen. Ein geeignetes Mittel dazu könnten nach Huntingtons Meinung “Friedensdialoge der Weltreligionen” darstellen.
“Menschen in allen Kulturen sollten nach Werten, Institutionen und Praktiken suchen und jene auszuweiten trachten, die sie mit Menschen anderer Kulturen gemeinsam haben”.
Die Verschiedenartigkeit von Kulturen ist für Huntington ein Faktum, das man nicht wegdiskutieren kann. Dennoch existieren bei genauerer Betrachtung auch viele Gemeinsamkeiten zwischen ihnen. So unterschiedlich Religionen z.B. auf den ersten Blick sind, im Prinzip gibt es in ihnen allen ähnliche Regeln: Mord oder Lüge werden prinzipiell als verwerflich angesehen, der materielle Anteil des Kulturlebens wird in seiner Bedeutung relativiert, Lebensgemeinschaften zwischen Mann und Frau werden gestiftet, die Menschen werden angesichts des Leids zu trösten versucht etc.
Man kann solche Gemeinsamkeiten aufspüren und auf diese Art zu größerem gegenseitigen Verständnis gelangen. Durch die Entdeckung von Gemeinsamkeiten kann Haß abgebaut und Frieden gestiftet werden. Der Friedensforschung kommt besonders hier eine wichtige Aufgabe zu: Sie kann helfen, solche Gemeinsamkeiten zu entdecken. Solche Maßnahmen könnten nach Huntington dazu beitragen, das ungeheure Konfliktpotential abzubauen, das zwischen westlichem und - zumindest manchen Teilen - des islamischem Kulturkreises besteht. Diese Hinweise sind Herausforderungen für alle Friedensorganisation der Welt, der religiös bemäntelte Gewalt und Eskalation der Gegengewalt entgegenzutreten.
Nach Meinung von Experten muß man folgendes besonders beachten: Nicht jeder Moslem ist ein moslemischer Fundamentalist bzw. Terrorist, genausowenig wie jeder Christ ein Inquisitor. Viele in Österreich lebende Moslems sehen ihre Integration gefährdet, weil sie einen Anstieg diesbezüglicher Vorurteile befürchten. Die österreichischen Moslems identifizieren sich in der Regel nicht mit den Attentaten von New York, es wurde in großen Versammlungen sogar für die Opfer im World Trade Center gebetet und glaubwürdig gegen den Terror Stellung genommen. Das soll aber nicht heißen, daß es gar keine fundamentalistischen Tendenzen unter moslemischen Einwanderern in Europa gibt. Man darf auch nicht vergessen, daß z.B. einige der Attentäter zuvor in Europa, v.a. in Deutschland gelebt haben und es dort mit Sicherheit auch heute noch eine relevante Zahl fundamentalistischer Zellen gibt.
Probleme mit manchen moslemischen Einwanderern, die natürlich nicht sämtlich gewalttätige und barbarische Fanatiker sind, gibt es in Europa schon seit langem; die Attentate von New York brachten manches davon wieder in allgemeine Erinnerung. Wie sich solche Probleme konkret äußern können, soll anhand einiger Beispiele illustriert werden. Die angeführten Beispiele sind Einzelfälle, aber nichtsdestotrotz sehr bedenklich.
1989 ermordeten z.B. in Frankreich zwei marokkanische Brüder ihre Schwester auf einem Schulareal, weil sie ihren französischen Freund nicht verlassen wollte - die Familie, die nach islamischen Vorstellungen über das Schicksal eines Mädchens entscheidet, hatte ihr die Beziehung zuvor verboten.
Im selben Jahr versammelten sich aufgebrachte Muslime auf dem Rathausplatz von Bradford und verbrannten Bücher Salman Rushdies, eines kritischen Intellektuellen, der gewisse Praktiken des Islam öffentlich kritisiert hatte. Im März desselben Jahres hatte die Polizei gegen Demonstranten einschreiten müssen, die versucht hatten, eine Rushdie-Puppe zu verbrennen. Einige Zeit später verweigerte die britische Filmbehörde die Verleihrechte für den pakistanischen Film “International Guerillas”, weil darin offen zum Mord an Rushdie aufgerufen wurde. Für aufgeklärte “Westler” ist es unverständlich und auch in Prinzip unerträglich, daß man einen Intellektuellen umbringen will, nur weil er eine nicht genehme Meinung ausdrückt, und sei es auch über eine Religion. Der prinzipielle Respekt vor dieser, der auch nach unserem Verständnis gewährleistet sein muß, darf nach herrschender Meinung in unserem Kulturkreis trotzdem nicht dazu führen, daß Kritiker - nicht einmal, wenn ihre Kritik wirklich verfehlt sein sollte - einfach zur Zielscheibe von Mordaufrufen werden; ist doch das Leben aus unserer Perspektive heilig, Irren hingegen menschlich. Die fanatischen Reaktionen auf Rushdie zeigen meiner Meinung nach aber auch, daß seine Kritik wahrscheinlich auch nicht gänzlich unberechtigt ist; zumindest irgendetwas kann wohl nicht stimmen in der momentanen islamischen Welt.
Vor einiger Zeit flog auf, daß der aus der Türkei ausgebürgerte islamische Fundamentalist Iman Kaplan in Köln jahrelang - gestützt auf demokratische Freiheitsrechte - eine Internatsschule für türkische Kinder unterhalten hatte, in der die Kinder fundamentalistisch indoktriniert wurden - mit Lehren wie: Die Demokratie ist eine Ideologie des Satans.
Es gab im Zusammenhang mit den Anschlägen von New York 2001 auch noch Eindrücke von der internationalen Bühne, welche die vielgepriesene multikulturelle Harmonie störten, die in der Praxis überhaupt äußerst brüchig erscheint, z.B. die Bilder von tanzenden und jubelnden Palästinensern in den Straßen, welche die USA mitverantwortlich machen für die mehr als bloß kritikwürdige Vorgehensweise des gegenwärtigen israelischen Premierministers Ariel Sharon, der eine kompromißlose Politik der Härte vertritt, und jetzt meinen, daß die gerechte Strafe über die Verbündeten ihre Feindes gekommen sei. Eben dieser Politiker scheint sich nach jüngsten Meldungen im “Windschatten” bzw. unter der unerwünschten Beispielwirkung des U.S.-amerikanischen “Krieges gegen den Terrorismus” in Afghanistan daranzumachen, die bisherigen Früchte des Nahost-Friedensprozesses, insbesonders die palästinensische Autonomiebehörde, möglicherweise zu zerstören versuchen, was wohl einen immensen Rückschritt für dauerhaften Frieden in der Region erahnen läßt.
Die Situation im “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF)
Das UZF hat in der Vergangenheit bereits Dialoge mit Hinduisten sowie mit Buddhisten mit einigem Erfolg veranstaltet. Einen Friedensdialog mit den Orthodoxen, die Huntington ja auch als eigenen Kulturkreis annimmt, gab es noch nicht. Ein solcher wäre meiner Meinung nach v.a. aus zwei Gründen wichtig: Erstens würde man an eine von Leo Gabriel begründete Tradition anknüpfen, der ja wie besprochen ebenfalls versucht hat, mit der Ostkirche in einen Dialog einzutreten; und zweitens ist das Thema aufgrund der letzten Reise des Papstes in die Ukraine wieder sehr aktuell geworden. Das Oberhaupt der Katholischen Kirche versuchte, auf die Ostkirche zuzugehen, mußte aber feststellen, daß auf der anderen Seite noch große Vorbehalte bestehen. Gerade hinsichtlich des Abbaus solcher Vorbehalte könnte ein “Friedensdialog der Weltreligionen” möglicherweise einen wichtigen Beitrag leisten; ich rege ihn daher an dieser Stelle ganz besonders an.
Ein “Friedensdialog mit dem Islam” wäre allerdings aus naheliegenden Gründen für die Friedens- und Konfliktforschung besonders aktuell. Ob und wann man ihn durchführen soll, dazu gab es zum Zeitpunkt meiner Recherchen interne Meinungsverschiedenheiten. Bei der letzten Generalversammlung am 22.5.01, einige Monate vor den Anschlägen von New York, beantragte der 1.Vorsitzende Herr Prof.Bader eine Aufnahme eines Dialoges mit dem Islam, um dazu beizutragen, den von ihm diagnostizierten Anstieg der Spannungen wenigstens teilweise zu entschärfen, was starke Widerstände auslöste.
Die in der Generalversammlung gegen den Dialog mit dem Islam vorgebrachten Argumente waren kurz zusammengefaßt folgende:
Die Moslems könnten den Friedensdialog instrumentalisieren und sowohl in der Veranstaltung selbst, als auch in der Fachzeitschrift, Propaganda (im Sinne von Missionierung) für ihre eigene Religion betreiben. Der Dialog mit ihnen beinhaltet viele Risken.
Vertreter des Islam könnten unehrlich sein und manche Probleme im Zusammenhang mit ihrer Religion zu vertuschen versuchen. Es könnte dabei eine unrealistische mulitikulturelle Harmonie beschworen werden, die so nicht existiert. Dieses Verhaltensmuster wurde anhand von praktischen Beispielen und Erfahrungen belegt.
Auch weitere Probleme im Zusammenhang mit dem Islam erscheinen so schwerwiegend und empörend, hieß es ferner, daß ein Dialog ohnehin abzulehnen sei. In diesem Zusammenhang wurde der islamische Fundamentalismus (z.B. in Afghanistan) sowie die Diskriminierung der Frauen erwähnt, die sowohl in der Praxis vorkommt (was man nicht leugnen kann), als auch im Koran verankert ist, wobei manche Bibelzitate aber keiner “feministischen” Überprüfung unterzogen wurden. Ein weiteres in der Generalversammlung genanntes überlegenswertes Argument, daß eine Friedensforschung, die nur aktiv wird, wenn es keinerlei Probleme gibt, wertlos und unsinnig zugleich ist, wurde in der damaligen Diskussion übergangen; ich halte es für beachtenswert.
Die genannten “Contra”-Standpunkte setzten sich letztlich nach kurzer Diskussion durch. Die Aufnahme eines Dialoges mit dem Islam wurde abgelehnt bzw. auf unbestimmte Zeit verschoben, was letztlich auf dasselbe hinausläuft. Ich war in diesem Zusammenhang in zweifacher Hinsicht über dieses UZF-interne Diskussionsergebnis erstaunt:
1.) Die Befürchtungen der Instrumentalisierung des Dialoges und der Publikationen zu Propagandazwecken sind wahrscheinlich gerechtfertigt, mit ziemlicher Sicherheit auch jene der Verharmlosungen. Man hatte aber doch historisch schon einmal vergleichbare Probleme, und zwar im “Friedensdialog zwischen Christen und Marxisten”; man stand damals eben vor einem ähnlichen Dilemma. Einerseits wollte man mit den Kommunisten einen Dialog führen und hätte ihn auch nur verweigern können, wenn man das unerträgliche Risiko einer Eskalation der Gewalt auf sich genommen hätte. Andererseits befürchtete man aber mit Recht, daß die Kommunisten den Dialog nutzen würden, um ihre Ideologie bei dieser Gelegenheit propagandistisch zu verbreiten oder Mißstände der östlichen Systeme zu verharmlosen. In diesem Zusammenhang traf man eine Grundsatzentscheidung: Man nahm den Dialog auf, entwickelte aber ein Instrumentarium (die oben im Kapitel über den “Friedensdialog zwischen Christen und Marxisten” ausführlich dargestellten “Sieben Regeln des Friedensdialoges”), mit deren Hilfe besagte Schwierigkeiten stark eingedämmt werden konnten. Man ging also nicht völlig naiv und blauäugig an den Dialog heran, sondern sah einerseits durchaus die Risken; aber man wählte andererseits auch nicht den Weg der prinzipiellen Dialogverweigerung, mit der man sich ja um die Chancen eines Dialoges gebracht hätte und der einer Friedensforschungsstelle völlig unangemessen gewesen wäre, sondern schlug einen “dritten Weg” ein: man minimierte das Risiko durch die Entwicklung ausgeklügelter Vermittlungstechniken weitgehend; mögliche Restrisken trug man bewußt, um der Chancen willen und weil die Dialogverweigerung auch Risken beinhaltet (nämlich die gewaltsame Eskalation von Konflikten).
Warum hat man die einst so erfolgreiche und oben dargestellte Methode der Vermittlung vergessen? Warum ist es plötzlich “common sense” im UZF, daß die nicht völlig ohne Berechtigung genannten Probleme nicht anders lösbar wären als durch Verweigerung des Dialoges? An diese historische Erkenntnis knüpft mein an späterer Stelle angeführter Kompromißvorschlag an.
2.) Ich war auch sehr erstaunt, daß die Mehrheit des ansonsten durchaus römisch-katholisch geprägten UZF sich mit der entsprechenden Entscheidung explizit gegen die Meinung des Papstes stellte. Johannes Paul II. schreibt jedenfalls in seinem Buch “Die Schwelle der Hoffnung überschreiten” u.a. folgendes:
“Dank ihres Monotheismus sind uns die, die an Allah glauben, ganz besonders nahe. (...) Das Konzil hat die Kirche auch zum Dialog mit den Anhängern des ‘Propheten’ aufgerufen, und die Kirche folgt diesem Weg. (...) Eine große Rolle haben diesbezüglich, wie ich bereits angedeutet habe, die Gebetstreffen von Assisi (und vor allem 1993 das Gebet für den Frieden in Bosnien) gespielt. Wichtig waren aber auch die Begegnungen mit den Anhängern des Islam auf meinen zahlreichen apostolischen Reisen nach Afrika oder Asien, wo in bestimmten Ländern die Muslime in der Mehrheit sind: Ungeachtet dessen wurde der Papst äußerst gastfreundlich empfangen, und ebenso wohlwollend wurde ihm Gehör geschenkt. (...) Besonders beeindruckend war die Aufgeschlossenheit der Jugendlichen für das Wort des Papstes, als er den Glauben an den Einen Gott veranschaulichte. Dies war gewiß ein noch nie dagewesenes Ereignis. Es mangelt allerdings nicht an sehr konkreten Schwierigkeiten. In den Ländern, wo fundamentalistische Strömungen an die Macht kommen, werden die Menschenrechte und das Prinzip der religiösen Freiheit leider sehr einseitig ausgelegt (...) Solcherart fundamentalistische Einstellungen gestalten die gegenseitigen Kontakte außerordentlich schwierig. Dennoch bleibt die Kirche unverändert offen für den Dialog und die Zusammenarbeit.”
Der Papst plädiert also trotz aller Schwierigkeiten und Probleme, derer er sich ausdrücklich bewußt ist, eindeutig für einen Dialog mit dem Islam. Die Attentate auf das World Trade Center in New York durch islamistische Fanatiker haben ihn in dieser schon früher geäußerten Ansicht nur bestärkt. Auf seiner jüngsten Reise nach Kasachstan rief er dazu auf, der eskalierenden Gewalt zwischen den Religionen durch einen Friedensdialog mit dem Islam entgegenzutreten. Auch der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, betonte entsprechend im Sinne des Papstes, daß gerade jetzt, nach den Anschlägen auf das World Trade Center, ein Dialog der Weltreligionen - insbesonders mit dem Islam - unbedingt notwendig ist. Wie kann angesichts solch eindeutiger Stellungnahmen jemand den entsprechenden Dialog verweigern und dennoch gleichzeitig für sich in Anspruch nehmen, rechtgläubiger Katholik zu sein?
Bei allen sicherlich mit einem “Friedensdialog mit dem Islam” verknüpften Schwierigkeiten, über die ich mir wohl bewußt bin, stellt sich für mich die Frage, welche Alternative es langfristig zu einem Dialog gibt, sieht man von der Gewalt ab - egal, von welcher Seite sie ausgeht, von Rechtsextremen hierzulande oder von islamistischen Fanatikern im In- und Ausland. Welches Risiko ist angesichts der Terroranschläge in New York größer: jenes des Dialoges oder jenes der Dialogverweigerung? Das soll übrigens nicht so interpretiert werde, daß ich finde, man solle mit fundamentalistischen Terroristen verhandeln; aber nicht jeder Moslem ist ein Fundamentalist oder Terrorist; man könnte fanatischen Gewalttätern Sympathien der “Normalbevölkerung” auf jeden Fall entziehen, wenn man für alle gerechte Lösungen findet und Brücken baut.
Letztendlich werden wir “Abendländer” uns sowohl diesen Planeten, als auch Europa und insbesonders Österreich mit Moslems teilen müssen - es ist eine Tatsache, daß weltweit gegenwärtig ca. eine Milliarde und in Österreich ca. 300.000 Moslems leben (das sind immerhin ungefähr soviele Menschen wie die drittgrößte Stadt des Landes, Linz, Einwohner hat); und aufgrund des stärker anschwellenden Einwanderungsstroms und der höheren Geburtenrate der Bekenner des Islam werden sich diese Zahlen in Zukunft wohl eher noch vergrößern als verkleinern. Es gibt keine Alternative, beide Seiten müssen zu einem friedlichen Zusammenleben finden - oder sie werden sich gegenseitig ermorden, international wie hierzulande.
Ein Ignorieren der Probleme ist auf jeden Fall in einer globalisierten Welt unmöglich; eine Nicht-Auseinandersetzung mit ihnen kann sich in Zukunft vielleicht als verhängnisvoll erweisen. Egal, ob man in der jetzigen Situation glücklich mit Friedensgesprächen mit dem Islam ist oder nicht; und selbst, wenn man die realistische Einschätzung zugrunde legt, daß ein Dialog wahrscheinlich zu überhaupt nichts führt - es stellt sich trotzdem die besagte Frage: Was bleibt uns langfristig außer einem Dialog, sieht man von der Gewalt ab? Es müssen auch nach Meinung ausgewiesener Experten und hochrangiger österreichischer Politiker Kanäle geöffnet werden, die eine friedliche Konfliktaustragung möglich machen. Die friedliebenden Gemäßigten aller Religionen müssen sich verbünden gegen die gewaltbereiten Fanatiker aller Religionen.
Aber ich bin sehr zuversichtlich, daß das UZF nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Ereignisse in New York einen “Friedensdialog mit dem Islam” (zumindest in einer Kompromißversion) mittelfristig initiieren wird. Ich denke auch aus der Sichtweise der P.R., daß Bemühungen um einen “Friedensdialog mit dem Islam” nicht zuletzt aufgrund ihrer brennenden Aktualität gegenüber den Medien gut kommunizierbar wären. Das Gegenteil wäre hingegen schwer überzeugend zu kommunizieren: “Wir sind eine auf den Friedensdialog der Weltreligionen und die Vermittlung zwischen verfeindeten Gruppen ausgerichtete Friedensorganisation, aber mit Moslems reden wir nicht - nur mit Buddhisten, weil mit denen gibt es kaum Probleme.”
Die prinzipielle Frage, ob man mit Moslems reden bzw. in Frieden leben kann (was beides letztlich dasselbe bedeutet), stellt sich übrigens nicht; denn wenn sie sich stellen und negativ beantwortet werden würde, wäre das Projekt “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) gescheitert, weil die Idee des Dialoges, auf dem es seit seiner Gründung durch Leo Gabriel historisch beruht, dann offenbar nicht wirklich in der Lage wäre, politische Probleme zu lösen.
Die Medienreferentin der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Frau Carla Amina Baghajati, äußert sich in der Öffentlichkeit optimistisch (vielleicht viel zu optimistisch?), daß sich Brücken zwischen den Kulturen schlagen lassen. Vielleicht hat aber im Gegensatz dazu der als rechtskonservativ geltende österreichische Philosophieprofessor Rudolf Burger recht, wenn er meint: “Trotz allen Geschwätzes bleibt der Islam eine feindliche Religion.” Ich halte, mit Verlaub, nicht einmal seine “politisch unkorrekte” Diagnose für gänzlich ausgeschlossen, denn perfekte multikulturelle Harmonie erkenne ich jedenfalls keine. Die UZF-Führung sollte dann aber, wenn sie zu einem ähnlichen Ergebnis wie Prof.Burger kommen sollte, das seit seiner Gründung durch Leo Gabriel auf den “Friedendialog der Weltreligionen” ausgerichtete “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) konsequenterweise auflösen und stattdessen eine militärische Kampftruppe aufbauen. Denn nach dem Ergebnis meiner historischen Forschungen ist auf jeden Fall die gegenwärtige Ablehnung eines “Friedensdialoges mit dem Islam” - trotz aller damit verbundener Probleme, die tatsächlich bestehen - mit den ursprünglichen Zielsetzungen des UZF, wie durch den Gründer Leo Gabriel formuliert und im “Friedensdialog zwischen Christen und Marxisten” über Jahrzehnte hinweg praktiziert, unvereinbar.
5.2. Prinzipielles
FRIEDENSTHEORIEN
Seit vielen Jahrhunderten haben große Denker Ideen zum Frieden entfaltet. Der Bogen spannt sich dabei vom Hl.Augustinus (und anderen christlichen Philosophen) über Immanuel Kant bis hin zu Bertha von Suttner oder in neuerer Zeit Johan Galtung. Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) versucht nicht zuletzt auch wegen seiner momentan großen Verbundenheit zur Philosophie an diese Tradition zu erinnern.
GESCHICHTE DER FRIEDENSBEWEGUNG
Ohne die Friedensbewegung gäbe es wahrscheinlich keine Friedensforschung. Insoferne ist es für eine Friedensforschungsinstitution wichtig, sich über die eigenen historischen Wurzeln klar zu werden. Die “Arbeitsgemeinschaft Friedensforschung”, die Hauptlehrveranstaltung des UZF widmete sich im Sommersemester 2001 entsprechend der Geschichte der Friedensbewegung. Zweifellos hat das UZF zu diesem Thema bereits eine hohe Kompetenz erworben. Meiner Meinung nach hat sich die Friedensbewegung der Gegenwart insoferne verändert, weil sie nicht mehr eine Massenbewegung ist (die “Ostermärsche” gegen Aufrüstung, früher zu Zeiten der drohenden Atomkriegsgefahr zwischen Sowjetunion und USA Massendemos, werden heute z.B. nur mehr von ein paar hundert Menschen frequentiert). Dafür sind die Werte der Friedensbewegung “common sense” in der heutigen Gesellschaft geworden. Neben Chancen - man muß in der Regel heute z.B. nicht mehr gegen militaristische Verleumdungen des Pazifismus als Verrat am eigenen Land ankämpfen, weil die Leute doch erkannt haben, daß der Militarismus ein Verrat an der Menschlichkeit ist - birgt dies die Gefahr, daß die hohen Ziele des Friedens, der Menschenrechte und der Demokratie zu alltäglichen Lippenbekenntnissen von Sonntagsrednern verkommen. Heftig diskutiert wird gegenwärtig auch die Praxis der “humanitären Intervention” - ist sie ein legitimes Mittel, den Frieden politisch durchzusetzen oder wird der Friedensgedanke politisch instrumentalisiert, um Bombardierungen anderer Staaten billig rechtfertigen zu können? Die Friedensbewegung selbst ist hinsichtlich dieser Frage gespalten.
FRIEDE UND GERECHTIGKEIT
Die Begriffe des Friedens und der Gerechtigkeit hängen insoferne zusammen, weil eine gerechte, d.h. im heutigen Verständnis demokratische und auf Partizipation der verschiedenen Gruppen ausgerichtete Gesellschaftsordnung der einzige Garant für den inneren Frieden zu sein scheint, während obrigkeitliche Unterdrückung eher Spaltungen vertieft und Gewalttaten noch zusätzlich provoziert. Warum legt ein radikaler Kurde eine Bombe in einem Touristenzentrum? Weil er sein Volk unterdrückt und ungerecht behandelt sieht - eine trotz der Verfehltheit der Methoden seines Kampfes zweifellos richtige Einschätzung. Die Auseinandersetzung mit dem Frieden setzt also voraus, grundlegend darüber zu reflektieren, was eigentlich Gerechtigkeit ist, v.a. darüber, welcher Gerechtigkeitsbegriff dem Frieden dienen kann und welcher nicht. Diese Reflexion ist selbstredend eine sozialphilosophische. Entsprechend veranstaltete das UZF unter der Verantwortung des 1.Vorsitzenden Prof.Bader z.B. ein Symposium zur Bedeutung der katholischen Soziallehre zur Friedenssicherung. Tatsächlich besitzt dieses Thema Relevanz; und darüberhinaus könnten im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Friede und Gerechtigkeit die Gedanken moderner Demokratietheoretiker (z.B. John Rawls oder Hannah Arendt) an Bedeutung gewinnen. Auch die Philosophie des UZF-Gründers Leo Gabriel könnte Hinweise zur Problemlösung geben.
6. Stärken des UZF
Ich habe mich in allen Expertengesprächen und sonstigen Recherchen bemüht, durch entsprechende Fragen die Stärken des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) herauszufinden, weil die Betonung dieser in der Öffentlichkeitsarbeit eine Bedeutung hat. Obwohl das meiste schon gesagt und besprochen wurde, möchte ich nochmals alles kurz nennen:
Das UZF ist die einzige Verankerung der Friedensforschung an einer staatlichen anerkannten österreichischen Universität und damit ohne ebenbürtige Konkurrenz; das wissenschaftliche Niveau ist sehr hoch.
Die Fragestellungen der Friedens- und Konfliktforschung sind, das ist für Journalisten wichtig, offensichtlich im höchsten Maße aktuell.
Das UZF publiziert landesweit die einzige wissenschaftliche Fachzeitschrift zur Friedensforschung.
Es besitzt einen Gründer, der eine faszinierende und bedeutsame Philosophie des Dialoges, der Toleranz und der Demokratie vertrat und knüpft so an eine wichtige geistesgeschichtliche Tradition an.
Die Mitarbeiter versuchen, ihre Forschungsergebnisse ständig in die Praxis umzusetzen, was ihnen durch ihre hochrangigen Funktionen im Bereich Diplomatie auch möglich ist. (Der 2.Vorsitzende ist ehemaliger OSZE-Generalsekretär und Botschafter, die Generalsekretärin ist Mitglied der österreichischen OSZE-Delegation etc., weitere Beispiele wären möglich).
Problemanalyse
1. Strukturelle Defizite
Im gegenwärtigen Vorstand des UZF befinden sich 13 Mitglieder, davon ist eines weiblich. Man muß berücksichtigen, daß besagte Dame als Generalsekretärin eine wichtige Führungsfunktion innehat, die mit anspruchsvollen Aufgaben in wissenschaftlicher Forschung und Universitätsmanagement verbunden ist.
Trotzdem liegt ein Frauenanteil von lediglich ca.7,7% vor. Ich habe Grund zu der Annahme, daß der Frauenanteil innerhalb der Gesamtorganisation, also unter den ordentlichen Mitgliedern, noch wesentlich geringer sein könnte. Denn auf Anfrage konnte mir die Generalsekretärin, die schon seit Jahrzehnten für die Organisation arbeitet und sie entsprechend gut kennt, spontan nur eine einzige weitere Frau nennen, die eine ordentliche Mitgliedschaft innehat, um freilich hinzuzufügen, daß diese schon seit langem nicht mehr wirklich für das UZF aktiv ist.
Dieses Faktum ist natürlich außerordentlich kritikwürdig. Zunächst einmal stellt sich die Frage, ob das UZF in der Öffentlichkeit glaubhaft “strukturelle Gewalt” im Sinne Johan Galtungs bekämpfen kann, wenn sich seine eigenen Strukturen dem Verdacht aussetzen, eine solche zu repräsentieren. Der Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung, der immerhin aufgrund der höheren Lebenserwartung mehr als 50% beträgt, wird nach heutigem Gerechtigkeitsverständnis, das sehr stark auf Partizipation von traditionell benachteiligten Gruppen ausgerichtet ist, auch nicht mehr angemessen repräsentiert.
Außerdem ist es nicht unbedingt so, daß man bei einem so niedrigen Frauenanteil dem traditionell bedeutsamen Beitrag der Frauen zum Frieden in der Welt gerecht wird. Dazu muß man wissen, daß Frauen von Beginn an im Rahmen der Friedensbewegung aktiv waren. Als Beispiel fällt mir spontan Bertha von Suttner ein, die die Friedensbewegung im deutschsprachigen Raum überhaupt erst initiiert hat. Neben theoretischen Beiträgen von Philosophinnen spielen Frauen seit jeher aber eben auch in der praktischen Friedensarbeit eine große Rolle. Ich erinnere mich persönlich daran, daß noch zur Zeit des menschenverachtenden Tschetschenienkrieges die einzige Organisation innerhalb Rußlands, die öffentlich und trotz der allgemeinen Kriegshysterie die Vorgehensweise Präsident Putins kritisierte, die “Vereinigung russischer Soldatenmütter” gewesen ist und führe dies u.a. auch darauf zurück, daß Frauen - alleine aufgrund des Umstandes, daß sie Kindern das Leben schenken und diese meistens in Hauptverantwortung großziehen - einen anderen Zugang zum Leben selbst haben und es daher, bei aller anderslautender offzieller Propaganda, in der Regel einfach nicht verstehen können und wollen, warum ihre oftmals gegen ihren Willen zum Militär eingezogenen Söhne in Schützengräben niedergemetzelt werden, nur damit sich z.B. irgendein Politiker anläßlich der bevorstehenden Wahlen als Vertreter von “law and order” profilieren kann. Es stellt sich auch die Frage, ob eine Friedensorganisation, in der Frauen so gering repräsentiert sind, genügend Sensibilität aufweist für frauenspezifische Themen, die mit dem Krieg zusammenhängen (z.B.Massenvergewaltigungen am Balkan).
Frauen aufzunehmen und ihre Sichtweise verstärkt zu berücksichtigen entspricht zudem dem grundlegenden Ethos des UZF und seines Gründers, also der “Wahrheit des Ganzen” im Sinne Leo Gabriels. Eine Organisation läuft zudem Gefahr, den Anschluß an eine Gesellschaft zu verlieren, wenn sie sich sozial ganz anders zusammensetzt als diese. Ein “offenes System” ist so vielfältig wie die Gesellschaft, in der es existiert.
Die Festlegung einer verpflichtenden Frauenquote hielte ich, obwohl häufig gefordert, aus verschiedensten Gründen für eine unglückliche Lösung, nicht zuletzt auch deshalb, weil sich dann alle Frauen, die sich ihre Position durch harte Arbeit und hohe Qualifikationen erworben haben, dann von wenig Wohlmeinenden als “Quotenfrauen” diskreditieren lassen müßten.
Eine Sensibilität für die Wichtigkeit einer Partizipation von Frauen halte ich jedoch für außerordentlich wichtig; eine solche Sensibilität muß man auch aus P.R.-Gründen gegenüber der Öffentlichkeit glaubhaft demonstrieren. Ich schlage vor, daß der Vorstand einen “Frauenförderungsplan” beschließt, in dem im Prinzip steht, daß man sich des großen Beitrags der Frauen zur Friedensbewegung bewußt ist und die Präsenz von Frauen in der Organisation als Bereicherung ansieht, weil ihre Perspektive auf Probleme von Krieg und Frieden nicht zuletzt im Sinne der “Wahrheit des Ganzen” von Belang ist. Dieser Plan sollte auch die Willenserklärung des Vorstands beinhalten, in Zukunft ein besonderes Augenmerk auf die Gewinnung von hochqualifizierten Frauen als ordentliche Mitglieder zu legen. Bis zur nächsten Generalversammlung in zwei Jahren sollte man auch darauf hinarbeiten, die Vorbereitungen dafür zu treffen, weitere Frauen in den Vorstand zu berufen - was ganz leicht ist, wo doch ohnehin noch ein paar Beisitzerposten vakant sind. Wenn ein solcher Frauenförderungsplan einmal vorliegt, kann man der Öffentlichkeit auch glaubhaft vermitteln, daß man das interne Strukturproblem erkannt hat und etwas dagegen tut; man wird beim Vorliegen entsprechender Bemühungen dem Umstand einer weiblichen Unterrepräsentation meist mehr Verständnis entgegenbringen, haben doch fast alle Organisationen weltweit diesbezüglich dasselbe Defizit; man braucht also keine Radikalkuren. Von bloßen Alibihandlungen rate ich aber auch ab; es soll ein wirkliches Umdenken geben.
In Wahrheit ist der niedrige Frauenanteil natürlich nur der Teil eines viel größeren Problems. Die Strukturdefizite des UZF gehen nämlich viel tiefer und kennzeichnen in der Regel “geschlossene” Systeme. Das idealtypische UZF-Vorstandsmitglied hat nach meinen Beobachtungen folgende Eigenschaften: weiße Hautfarbe (europid), wenn Österreicher: Zugehörigkeit zur deutschsprachigen Mehrheit, gehobenes Durchschnittseinkommen, römisch-katholisch, männlich, 55-75 Jahre alt. Anhand dieser kurzen sozialen Beschreibung wird klar, was in der Organisation “fehlt”.
Dies alles ist übrigens, ich betone es nochmals, ein strukturelles Problem, kein persönliches; folglich braucht sich auch niemand persönlich gekränkt fühlen, auf den die besagten Eigenschaften ganz oder teilweise zutreffen; man kann das Problem auch nur strukturell lösen, nicht persönlich. Ich rege auf jeden Fall an, das “geschlossene” System UZF durch Hinzunahme neuer Mitglieder (nicht durch Ausschluß verdienter) in ein “offenes” System umzuwandeln - ein solcher Strukturwandel würde u.a. die für die Öffentlichkeitsarbeit bedeutsame Innovationsfreudigkeit des wichtigsten Entscheidungsgremiums der Organisation heben, die momentan nach meinem subjektiven Eindruck nicht immer gegeben ist (ich habe guten Grund zu der Annahme, daß man im UZF bei der Entscheidungsfindung eher dazu tendiert, Risken zu meiden und lieber bei den “bewährten” - also alten - Vorgangsweisen zu bleiben; die Zeiten ändern sich allerdings rapide; und nur, wer mit der Zeit geht, wird sich langfristig behaupten können).
Möglicherweise könnte in diesem Zusammenhang v.a. die Rekrutierung des wissenschaftlichen Nachwuchses ebenfalls noch intensiviert werden; der Beschluß eines Plans zur Nachwuchsförderung wäre daher überlegenswert. Die Gewinnung wissenschaftlichen Nachwuchses ist auch für die langfristige Zukunftssicherung des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) wichtig.
Ein struktureller Wandel könnte die Qualität der Friedensforschung und der P.R. auch steigern v.a. hinsichtlich des Einbringens anderer Perspektiven - jene des weißen, europäischen, wohlhabenden, römisch-katholischen Mannes reiferen Alters ist vielleicht nicht immer die für beide Disziplinen förderlichste. Ich empfehle also, kurz gesagt, die Aufnahme von mehr Frauen, mehr Jungen und mehr ethnischen Minderheiten in den Vorstand des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF).
Einzig bei der ausgezeichneten Bildung und der Internationalität - zweier offenkundiger Stärken des gegenwärtigen UZF-Vorstandes - sollte man meiner Ansicht nach nur in Ausnahmefällen Abstriche machen; und zwar aus dem Image-Grund, daß man sich nach den Ergebnissen der Expertengespräche als seriöse und hochkompetente wissenschaftliche Organisation profilieren will. Es ist freilich ein Problem, daß Frauen, Minderheiten etc. oft nicht dieses Ausmaß an Möglichkeit haben, sich in der gewünschten elitären Form zu bilden und daher die Einschränkung “hohe Bildung” mit dem Ideal der Integrationsbestrebungen kollidieren könnte; man muß letztlich, so wie immer im Leben, Kompromisse zwischen Realität und Ideal schließen.
2. Steigerungsfähige Mitgliedszahl
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” ist nicht darauf angelegt, eine Massenorganisation zu sein oder zu werden. Etwas anderes würde auch keinen Sinn machen bei einem Projekt der Universität Wien. Mitglieder sollten gewisse Qualifikationen vorweisen können, z.B. wissenschaftliche Forschung, praktische Erfahrungen etc. Man legt also Wert auf Qualität vor Quantität. Und so findet man in der Vereinigung nach meinen Beobachtungen hauptsächlich Universitätsprofessoren, Diplomaten, Hof- und Ministerialräte etc., also das ganze versammelte “Who is Who in Österreich”. Eine Mitgliedschaft und Mitarbeit soll als ein Zeichen von Prestige gelten - und das ist vom Management nicht unerwünscht, denn es stärkt erstens den Zusammenhalt und ist zweitens ein gutes und richtiges Argument für die Werbung neuer Mitglieder im Sinne von: “Da kann man interessante Leute kennenlernen”.
Dennoch hat man mir gegenüber anklingen lassen, daß man gerne auch quantitativ mehr Mitglieder hätte. Die gegenwärtige Mitgliedszahl liegt nach offiziellen Angaben bei ca.hundert.
Mir erscheint das Werben neuer Mitglieder als eine wichtige künftige Aufgabe des UZF. Man könnte durch die Vergrößerung der Mitgliedszahl die oben besprochenen Strukturprobleme durch die Hinzunahme neuer Mitglieder lösen und so auch die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen erhöhen.
3. Geringe budgetäre Mittel
Der Leitgedanke größtmöglicher Effizienz und Sparsamkeit ist in der P.R. des UZF besonders wichtig, weil nur geringe budgetäre Mittel vorhanden sind und man dann wenigstens aus der Not eine Tugend machen soll. Zentral erscheint mir für die Zukunft, Maßnahmen zu überlegen, den budgetären Rahmen einerseits zu vergrößern (Fund Raising), andererseits die vorhandenen Möglichkeiten optimal zu nutzen.
4. Geringer Bekanntheitsgrad
Da die Organisation der Öffentlichkeit, so mein Eindruck, weitgehend unbekannt ist, muß es wohl eine der Hauptaufgaben künftiger Public Relations sein, diesen Bekanntheitsgrad unter massiven Kommunikationsanstrengungen und Nutzung aller zur Verfügung stehenden Kanäle zu erhöhen. Dabei sind keine Wunder zu erwarten, schon gar nicht kurzfristig, aber das Potential für eine öffentliche Profilierung ist aufgrund der in Punkt 6 der vorigen “Situationsanalyse” besprochenen Stärken meiner Ansicht nach vorhanden.
5. Widersprüchliche Zielsetzung; Problem Anti-EU-Engagement
In einigen Punkten bestehen unterschiedliche Auffassungen in der Zielsetzung der Organisation, was sich auf die P.R. negativ auswirken könnte. Bei der Ausarbeitung eines möglichen Leitbildes für das UZF werde ich mich mit diesen Fragen besonders ausführlich auseinandersetzen. Einzelne in der Vereinigung neigen z.B. zu Engagement gegen die EU, welches von der Gesamtorganisation nicht unterstützt wird. Daraus entstehen immer wieder interne Streitfragen, etwa wenn es den meist unbegründeten und manchmal begründeten Verdacht gibt, daß dieses in irgendeiner Form mit dem UZF vermischt worden ist; zuletzt flammte dieser Streit anläßlich einer Rede des 1.Vorsitzenden Prof.Bader am Nationalfeiertag auf, konnte aber zum Glück gütlich beigelegt werden.
6. Prüfung des Images unter Mitarbeitern am Institut für Philosophie notwendig
Auf die möglicherweise vorhandenen Image-Defizite des UZF am Institut für Philosophie, an dem es räumlich untergebracht ist, werde ich bei späterer Gelegenheit noch ausführlich eingehen.
Kommunikationsprüfung
1. Public Relations als praktische Friedensarbeit
Anhand einiger Aussagen führender Funktionäre des Universitätszentrums läßt sich ersehen, daß der Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der Organisation ein zentraler Stellenwert zukommt. Der Präsident Prof.Leser definiert als eine der Aufgaben des UZF die “Stellungnahme zu kontroversiellen Themen in der Öffentlichkeit”. Der 1.Vorsitzende Prof.Bader hält es für eine der wichtigsten Unternehmensaufgaben, der Öffentlichkeit Informationen zum Frieden zur Verfügung zu stellen.
Der 2.Vorsitzende Botschafter Liedermann betont, daß das “Universitätszentrum für Friedensforschung” - sieht man von den wissenschaftlichen Aktivitäten ab - auch in der praktischen Friedensarbeit tätig ist und sinnvollerweise sein muß, damit es nicht nur auf der Ebene der “grauen Theorie” verbleibt. Seiner Meinung nach besteht die praktische Friedensarbeit v.a. aus zwei Teilen: Einerseits kann man auf dem Gebiet der Diplomatie einiges beeinflussen, andererseits ist es möglich, eine breitere Öffentlichkeit für den Frieden zu sensibilisieren. Öffentlichkeitsarbeit ist also insoferne ein wichtiges Anliegen der Organisation, weil sie ein Teil der praktischen Friedensarbeit und damit unerläßlich ist.
2. Die Herausgabe der wissenschaftlichen Fachzeitschrift “Wiener Blätter zur Friedensforschung”
2.1. Selbstverständnis der Zeitschrift
Nach Einschätzung praktisch aller hochrangiger Funktionäre des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) besteht die wichtigste P.R.-Aktivität der Organisation in der Herausgabe der “hauseigenen” wissenschaftlichen Fachzeitschrift “Wiener Blätter zur Friedensforschung”.
Daß es sich wirklich um die wichtigste P.R.-Aktivität handelt, kann man an folgendem ersehen: Das meiste Geld, daß das UZF für P.R. ausgibt, wird für den Druck der “Wiener Blätter zur Friedensforschung” aufgewendet. Im Expertengespräch ging der Präsident sogar so weit, daß er meinte, seine Vereinigung hätte wahrscheinlich die “Existenzberechtigung” verloren, wenn sie eines Tages nicht mehr in der Lage sein sollte, die Zeitschrift weiterzuführen. Auch der 1.Vorsitzende, der 2.Vorsitzende, der Kassier und der Schriftführer bestätigten die Wichtigkeit der Zeitschrift für die Public Relations des Universitätszentrums. Die Gesamtleitung der Zeitschrift obliegt der Generalsekretärin Frau Hofrat Pöllinger, die als Chefredakteurin fungiert.
Das Selbstverständnis der Zeitschrift lautet nach ihrem Impressum folgendermaßen:
“Die Zeitschrift dient zur Förderung der Friedensforschung und zur Verbreitung ihrer Ergebnisse in völliger Unabhängigkeit von politischen Parteien und Interessensgruppen, jedoch in Anlehnung an das Universitätszentrum für Friedensforschung.
Außer den Berichten über die Tätigkeit des UZF bringt die Zeitschrift Aufsätze von in- und ausländischen Wissenschaftlern u.a. zu folgenden Themenbereichen: Zusammenhänge von Anthropologie und kriegerischen Auseinandersetzungen, allgemeine und spezielle Probleme der Friedens- und Konfliktforschung sowie Buchbesprechungen.”
Nach diesen Angaben kann man also folgende Charakteristika des Selbstverständnisses der Zeitschrift hervorheben:
Es handelt sich um eine wissenschaftliche Fachzeitschrift zur Friedensforschung. Die Ergebnisse der Friedensforschung sollen über das Medium verbreitet werden, und zwar über die Grenzen der Organisation hinaus. Die Zeitschrift dient also einerseits der externen Kommunikation.
Gleichzeitig sind die “Wiener Blätter zur Friedensforschung” die Zeitschrift des Universitätszentrums und berichten über seine Aktivitäten, also handelt es sich auch um eine Organisations- bzw. Mitgliederzeitschrift. Die Zeitschrift ist damit andererseits auch ein Instrument der internen Kommunikation.
Wichtig für das Selbstverständnis sind ferner u.a.: Unabhängigkeit von Parteien und Interessengruppen sowie Internationalität.
Die “Wiener Blätter zur Friedensforschung” wurden im Jahre 1974 auf Initiative Leo Gabriels hin gegründet. Sie erscheinen vierteljährlich in einem Umfang von 60 Seiten - mehr geht nicht, weil man sonst in eine höhere Preisklasse bei den Druckkosten käme (der Druck erfolgt gegenwärtig beim Wiener Verlag MANZ). Einzig die Jubiläumsausgabe Nr.100 im Jahre 1999 hatte den doppelten Umfang einer normalen Ausgabe.
Ein Hinweis erscheint mir noch bemerkenswert: Die “Wiener Blätter” sind die einzige wissenschaftliche Fachzeitschrift zur Friedensforschung in Österreich. Sie haben also v.a. auch deshalb objektiv Bedeutung, weil ihr Nicht-Erscheinen eine bedauerliche Lücke in der Fachwelt hinterlassen würde.
2.2. Verbreitung und Finanzierung
Die Zeitschrift hat eine Druckauflage von 600 Stück und eine verbreitete Auflage von ca.500 Stück. Die verbreitete Auflage setzt sich aus folgenden Teilkomponenten zusammen:
Abonnements. Jedes Mitglied des Vereins ist automatisch Abonnent der “Wiener Blätter zur Friedensforschung”. Die Zeitschrift erfüllt damit, wie bereits festgestellt, eine wichtige Aufgabe im Bereich der internen Kommunikation. Darüberhinaus gibt es nach Angabe des Kassiers Prof.Kaiser auch Abonnenten, die nicht Mitglieder sind, v.a. Institutionen (etwa Bibliotheken oder Wissenschaftliche Einrichtungen). Er schätzt den Anteil dieser “Externen” an der Gesamtzahl der zahlenden Abonnenten auf ca.40%.
Austausch. Häufig ergeht ein Abo im Austausch mit dem Abo einer anderen Zeitschrift z.B. einer anderen Forschungsinstitution, die ebenfalls eine wissenschaftliche Zeitschrift publiziert. Witer unten folgt eine relativ vollständige Liste der Zeitschriften, mit denen ein solcher Austausch besteht.
P.R.-Geschenke. Die meisten der restlichen Exemplare werden gratis verteilt an potentielle Mitglieder, die man werben will, an ausgesuchte “Opinion Leaders” in Wissenschaft, Diplomatie und hoher Verwaltung sowie an Studenten in den einschlägigen Vorlesungen.
Die Finanzierung der “Wiener Blätter zur Friedensforschung” (siehe auch Kapitel “Finanzierung des UZF”) erfolgt durch den Verein und hierbei v.a. über die von ihm empfangenen Subventionen und Mitgliedsbeiträge. Die Duckkosten lagen 2000 bei ca.6.400 Euro, darüberhinaus fielen Versandkosten an u.a.
Eine nicht unbeträchtliche Teilabdeckung der Kosten erfolgt über Inserate. Ein Inserat kostet in der Regel 10.000 Schilling (ca.720 Euro); im Jahr 2000 wurden bei Schaltung von vier Inseraten von ca.34.000 Schilling (ca.2.500 Euro) eingenommen (einem Inserenten wurde ein Preisnachlaß gewährt). Gemessen an den Druckkosten liegt also eine Kostenabdeckung durch Werbung von fast 40% vor, was mir durchaus als gesunde Finanzstruktur erscheint - es heißt immer wieder, mehr als ein Drittel der Einnahmen eines Mediums sollten aus der Werbung stammen.
Die Zeitschrift kann zahlreiche und teilweise durchaus prestigeträchtige Inserenten aufweisen, z.B. Anker Brot, Austrian Airlines, Bank Austria, CA, Die Erste, Hofburg, Österreichische Lotteriegesellschaft, Raiffeisen, RZB, Salinen, Schiebel Electronics, Siemens, Volkswagen.
Die Inserate der letzten vierzig Nummern (Nr.67 bis Nr.106), also der letzten zehn Jahre, habe ich einer statistischen Analyse unterzogen, um die der Werbung in der Zeitschrift zugrundeliegende Struktur zu erforschen.
Die Anzahl der Inserate pro Nummer läßt sich in der folgenden Tabelle ablesen.
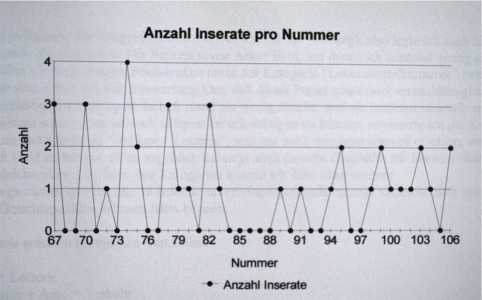
Sofort fällt auf, daß es hinsichtlich des Inserateaufkommens zwischen Nr.84 und Nr.88 einen “Durchhänger” gab und es auch danach noch einige Zeit dauerte, bis das “Geschäft” wieder in Schwung kam. Dieses Ergebnis ist mit ziemlicher Sicherheit im Zusammenhang mit den 1995 stattgefundenden und bereits ausführlich besprochenen Problemen des Universitätszentrums zu sehen, die eine Neukonsolidierung der Vereinigung notwendig machten. Es könnte durchaus sein, daß mit dem “Auszug der Theologen” der Verantwortliche für Fund Raising abhanden gekommen war und neue Kontakte zu neuen Inserenten geknüpft werden mußten, was einige Zeit in Anspruch nehmen sollte. Da die Struktur der Inserate vor und nach 1995 in diesem Fall wohl eine völlig andere sein muß, lag es nahe, beide Zeiträume getrennt zu untersuchen und nicht “über einen Kamm zu scheren”. Ich untersuchte also zuerst die Struktur der Inserate der Nummern 67-83 und anschließend der Nummern 89-106. Die Übergangsphase, in der es gar keine Inserate gab, übersprang ich.
In der Gesamtheit der 40 Nummern (Nr.67-106) gab es 38 Inserate, was einem Mittelwert von 0,95 Inseraten pro Nummer entspricht, bei einer Standardabweichung von 1,11 und einer Spannweite zwischen 0 und 4 Inseraten pro Nummer.
Kategorienschema
Aber nun zu den “getrennten” Zeiträumen. Eine grobe Sichtung der Inserate brachte mich zur Festlegung eines inhaltsanalytischen Kategorienschemas, das als sozialwissenschaftliches Instrument ihrer Erfassung dienen sollte. Ein solches muß u.a. einigen Kriterien genügen: Seine Festlegung, die man oftmals so oder anders treffen kann, sollte zumindest sinnvoll und intersubjektiv nachvollziehbar zu argumentieren sein, die Zuteilung zu einer Kategorie muß nach einheitlichen Kriterien erfolgen und die Kategorien sollten möglichst alle Einzelfälle erfassen.
Da mir auf Basis einer ersten Sichtung des Datenmaterials auffiel, daß Banken die bei weitem größte Gruppe der Inserenten stellten, war es klar, daß dieser Geschäftsbereich eine eigene Kategorie bekommen mußte. Technologiekonzerne, Automobilproduzenten und Verkehrsbetriebe erschienen mir in einem ähnlichen Geschäftsfeld tätig, weswegen ich sie zu einer eigenen Gruppe zusammenfaßte. Die Zusammenfassung war auch deshalb notwendig, damit eine gewisse relevante Größe der Gruppe gegenüber den dominierenden Banken gewährleistet war (in Einzelbereiche aufgesplittert wären die Zahlen so klein gewesen, daß ich mir eine Auswertung hätte sparen können).
Dann gab es Inserate für Kongreßzentren (hierbei v.a. für die Hofburg), also legte ich auch hier eine entsprechende Kategorie fest. Die Salinen sowie Anker Brot, mit denen ich zunächst wenig anfangen konnte, faßte ich nach einigem Nachdenken unter der Kategorie “Lebensmittelkonzerne” zusammen; es war mir aber schon vor der Auswertung klar, daß dieser Punkt quantitativ vernachlässigbar war. Die Österreichische Lotteriegesellschaft stand ein wenig abseits, weil sie zunächst nirgends wirklich hineinzupassen schien. Um sie auch adäquat berücksichtigen zu können, erweiterte ich die Kategorie der Banken und nannte sie “Banken + Lotterie”, was mir auch insoferne sinnvoll erschien, weil beides mit Geld zu tun hat. (Und angeblich haben ja auch manche Geschäfte mit Banken nicht selten Glücksspielcharakter.) In diese vier Kategorien konnte ich dann ohne weitere Zuordnungsschwierigkeiten alle 38 Inserate unterbringen, obwohl man sie vielleicht auch unter anderen Gesichtspunkten erfassen hätte können.
Die von mir erfaßten Kategorien waren also:
Banken + Lotterie
Technologie + Auto + Verkehr
Kongreßzentren
Lebensmittelkonzerne
Die Forschungsfrage lag darin, wie die Zusammensetzung der Inserate nach diesen festgelegten Kategorien aussah - und zwar in den Nummern 67 bis 83 im Vergleich zu den Nummern 89 bis 106. Hypothese 1 bis Hypothese 4 war, daß in den jeweiligen Kategorien Unterschiede der Zusammensetzung feststellbar sind. Die zugeordneten Null-Hypothesen lauteten, daß es keine entsprechenden Unterschiede gab.
Ergebnisse (Statistiktabellen beim Autor)
Das Hauptergebnis der Analyse lautet: Die Hauptsponsoren waren in der Zeit vor 1995 praktisch nur Banken, der Rest ist fast vernachlässigbar. Der Mittelwert lag bei etwas über einem Inserat pro Nummer, wobei die hohe Standardabweichung auffällt: In vielen Nummern gab es keine Inserate, dann oftmals sogar drei, einmal sogar vier. Der zweite Zeitabschnitt (von 1995 bis heute) zeigt folgende Ergebnisse:
Der Mittelwert in der Zeit nach 1995 ist etwas niedriger als früher; man hält bei etwas weniger als einem Inserat pro Nummer; Standardabweichung und Spannweite sind geringer. Dies ist u.a. dadurch zu erklären, daß das Geschäft nach Aussage der Chefredakteurin immer härter geworden ist; außerdem mußten die Inseratspreise aus Gründen der mittlerweile höheren Produktionskosten verdoppelt werden. So gesehen ist man wesentlich erfolgreicher als früher.
Man kann aus den Tabellen auch ablesen, daß es hinsichtlich der Zusammensetzung der Inserate vor und nach 1995 sehr wohl Unterschiede gibt und zumindest die Null-Hypothese 1 auf jeden Fall verworfen werden kann. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Zeiträumen ist also, daß vor 1995 Banken die fast ausschließlichen Inserenten waren; nach 1995 sind sie zwar immer noch die stärkste Inserentengruppe, ihr Anteil ist aber von über 80% auf ca.56% drastisch zurückgegangen. Die anderen Bereiche sind entsprechend der Tabelle angewachsen, wobei Lebensmittelkonzerne vorher und nachher praktisch keine wirkliche Rolle spielten.
Diesen Strukturwandel könnte man negativ oder positiv interpretieren: Man könnte also sagen, es ist schade, daß man nicht mehr so viele Banken als Sponsoren hat und man sich um diese Gruppe mehr kümmern sollte; andererseits könnte man auch so interpretieren, daß es gut ist, daß sich die Sponsoren mehr “ausdifferenziert” haben, d.h. man nicht mehr allein von Banken abhängig ist, sondern eben auch andere Bereiche ausschöpft und so Abhängigkeiten aller Art vermeidet.
Nach Angabe der Experten ist es schwer, Inserenten zu finden; alle in der Vereinigung Tätigen beteiligen sich massiv an der Suche. Trotz aller Schwierigkeiten, das hat meine Analyse deutlich gemacht, war man aber bisher aufgrund der großen Anstrengungen und des beachtlichen Engagements bei der Inserentengewinnung ziemlich erfolgreich.
2.3. Die Autoren
Kategorienschema
Ich entschloß mich auch zu einer statistischen Auswertung, die zu Aussagen über die Autoren führen sollte. Als Untersuchungsobjekt diente mir die “Autorenseite” der “Wiener Blätter zur Friedensforschung” - und zwar wieder der letzten vierzig Nummern (Nr.67 bis Nr.106). Jede Nummer der Zeitschrift beginnt mit einer Seite, in der die Autoren der jeweiligen Nummer inklusive ihres Berufes genannt sind. Aussagen über die Autoren der jeweiligen Artikel zeigen auch viel über die “Linie” der Zeitschrift.
Weil die Zahl der Autoren immer größer ist als jene der Inserenten, war es viel schwieriger, ein Kategorienschema festzulegen, daß möglichst alle berücksichtigt. Dennoch fand ich bei vielen Autoren Gemeinsamkeiten. Bei einer groben Sichtung des Datenmaterials fiel mir auf, daß die meisten Autoren z.B. Professoren oder Assistenten an Universitäten oder Mitarbeiter außeruniversitärer Forschungsinstitutionen waren. Also legte ich die Kategorie “Wissenschaft” fest. Ich entschloß mich, bei der Auswertung nicht zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung zu trennen, weil viele Autoren Doppelfunktionen innehatten und es dann möglicherweise Zuordnungsprobleme gegeben hätte.
Es fiel mir auch auf, daß es viele Diplomaten gab, also lag die Schaffung einer Kategorie “Diplomatie” ebenfalls nahe. Zuerst wollte ich die “Politik” von der “Diplomatie” trennen, dies erwies sich allerdings nicht als zielführend. Denn es waren z.B. Reden von deutschen und amerikanischen Außenministern abgedruckt - was ist ein Außenminister, Diplomat oder Politiker? Um Zuordnungsprobleme zu vermeiden, legte ich die entsprechende Kategorie als “Diplomatie und Politik” fest.
Die Schaffung einer Kategorie “Religion” erschien mir ebenfalls wichtig, weil immer wieder Artikel von hohen Funktionären von Religionsgemeinschaften und Kirchen abgedruckt waren; z.B. Botschaften des Papstes zum Weltfriedenstages. Der Wiener Erzbischof hat aber auch für die Zeitschrift geschrieben, ebenso einige Vertreter der österreichischen Hindu-Gemeinde im Zuge des “Friedensdialoges der Weltreligionen” zwischen Christen und Hinduisten.
Angehörige von Streitkräften teilte ich der Kategorie “Militär” zu. Ansonsten gab es noch die Kategorien “Wirtschaft” sowie “Non-Profit-Organisationen”, die beide allerdings vernachlässigbar waren, fielen doch nur ein paar der fast 300 Autoren unter diese beiden Gruppen.
Die vier Hauptkategorien waren also:
Wissenschaft
Diplomatie + Politik
Religion
Militär
Ich mußte mich bei der Zuordnung auf die Angaben der “Autorenseite” verlassen. Die Lebensläufe der Autoren einzeln zu überprüfen war aus technischen Gründen nicht möglich. D.h. ich konnte nur Funktionen der Autoren berücksichtigen, die für mich aus den Angaben der Zeitschriften ersichtlich waren; würde hier also irgendwo ein Fehler oder eine Unvollständigkeit vorliegen, hätte ich dies wohl übernommen, wobei ich aber prinzipiell auf die guten Recherchen der Zeitschrift vertraue. Autoren, die mehrere Artikel geschrieben hatten, wurden natürlich mehrfach gezählt, was insoferne Sinn macht, weil ja über die Analyse der Autoren Aussagen über die “Linie” der Zeitschrift getroffen werden sollten, d.h. über die “Herkunft” der einzelnen Artikel.
Die Zuordnung war in den meisten Fällen eindeutig. Einige Beispiele: Ein General des Bundesheeres oder der NATO fällt unter “Militär”, der Papst unter “Religion”, ein Professor der Universität Wien unter “Wissenschaft”, der UNO-Generalsekretär unter “Diplomatie” etc. Dennoch gab es einige Zuordnungsprobleme, für die ich ein einheitliches Verfahren finden mußte.
Es stellte sich z.B. die Frage, wo ich einen Universitätsprofessor einer Katholisch-Theologischen Fakultät einordnen sollte - unter “Wissenschaft” oder “Religion”? Trotz der großen Kirchennähe entschloß ich mich, die Einordnung entsprechend dem Selbstverständnis der Theologie und der Lokalisation an der Universität unter “Wissenschaft” zu treffen; allerdings nahm ich mir vor, den Anteil der Fachtheologen unter den Wissenschaftlern und seine Entwicklung später noch getrennt herauszuarbeiten.
Ich zögerte auch bei der Einordnung der Nuntii. Nach der Wiener Diplomatenkonvention ist ein Nuntius völkerrechtlich einem Botschafter gleichgestellt; er ist auch ein Botschafter, aber eben des Heiligen Stuhls. In gewisser Weise wäre es also naheliegend gewesen, die Nuntii unter “Diplomatie und Politik” einzuordnen, weil es sich um Diplomaten handelt; außerdem wäre es eine Vorgangsweise, die analog zu der Zuordnung der Universitätsprofessoren der Theologie unter der Kategorie “Wissenschaft” gewesen wäre. Dennoch gab es aber zwischen den beiden Fällen einen nicht unbeträchtlichen Unterschied, der mich veranlaßte, anders zu verfahren: Die Nuntii waren allesamt zur selben Zeit Inhaber dermaßen hoher Kirchenämter (Erzbischof, Kardinal etc.), daß mir die Zugangskriterien für die Kategorie “Religion” erfüllt schienen. Die Universitätsprofessoren der Theologie hatten meist keine vergleichbaren Positionen inne oder hatten diese in der Selbstbeschreibung zumindest nicht angeführt, vielleicht um zu betonen, die Aussagen des Artikels in erster Linie als Wissenschaftler zu treffen. Die Kategorie “Religion” beinhaltet also auch die Religionsdiplomatie. Solche Fälle kamen mir aber ohnehin nur selten unter; das Gesamtbild der Auswertung würde sich bei einer anderen Zuordnung daher wahrscheinlich nicht gravierend ändern.
Die so erfolgten Zuteilungen erschienen mir aber auch darum sinnvoll, weil ich durch die Scheidung von Theologieprofessoren und anderen Funktionären von Religionsgemeinschaften auch ein sozialwissenschaftliches Instrumentarium zur Verfügung hatte, das sensibel für ein bestimmtes Problem war: Zu Beginn meiner Untersuchung hatte ich den begründeten Verdacht, daß der Anteil der Theologieprofessoren an den Autoren seit 1995 massiv zurückging - erklärbar durch die im historischen Teil beschriebenen Probleme mit ihnen -, die Religion aber dennoch bis heute eine Rolle spielt - ungefähr nach dem unausgesprochenen Motto: Gott ja, Theologen nein. Mit einer Zuteilung wie der obigen, die eine Trennung von Funktionären von Religionsgemeinschaften und Universitätsprofessoren der Theologie beinhaltete, konnte ich ersehen, ob mein Eindruck richtig war oder nicht.
Zur Kategorie “Militär”: In diese Kategorie zählte ich wie gesagt alle Angehörige der Streitkräfte. Eindeutige Fälle sind, wie oben besprochen, z.B. NATO-Generäle etc. Militärberater oder -attachés sind zwar diplomatischen Delegationen oder Botschaften zugeteilt, bleiben aber doch Militärangehörige. Darum ordnete ich sie nicht der “Diplomatie”, sondern eben dem Militär zu. Reserveoffiziere rechnete ich nicht dem Militär, sondern ihrem Hauptberuf zu (mir kam z.B. ein Universitätsprofessor unter, der Oberst der Reserve war. Er fällt unter “Wissenschaft”). Bei Autoren, die an wissenschaftlichen Institutionen des Militärs wirkten (z.B. Universität der Bundeswehr in Hamburg, österreichische Landesverteidigunsakademie und dergleichen) differenzierte ich: Waren es Zivilisten, rechnete ich sie zur Wissenschaft, trugen sie militärische Ränge, zählte ich sie zum Militär. So habe ich der Mittelstellung dieser Institutionen zwischen wissenschaftlichen und militärischen Ausbildungsstätten Rechnung zu tragen versucht.
Die Forschungsfrage bestand einerseits darin, herauszufinden, wie die Zusammensetzung der Autoren der letzten vierzig Nummern in der Gesamtheit aussah (Erkundungsfrage). Ich wollte aber auch wissen, ob es vor bzw. nach 1995 hinsichtlich der Zusammensetzung der Autoren Unterschiede gab oder nicht (Entscheidungsfrage). Zu jeder Kategorie stellte ich entsprechend die Hypothese auf, daß Unterschiede vorhanden sind, die zu falsifizierenden Null-Hypothesen gingen davon aus, daß es keine Unterschiede gibt. Außerdem stellte sich eine weitere Forschungsfrage, ob sich der Anteil der Theologen an den von mir als Wissenschaftler eingestuften Autoren nach 1995 verändert hat. Die Hypothese war, daß Veränderungen vorlagen, die Null-Hypothese ging von keinen Veränderungen aus.
Ergebnisse (Statistiktabellen beim Autor)
Die Auswertung mit SPSS führte, was die Gesamtheit der letzten 40 Nummern betrifft, zu folgenden Ergebnissen:
Man kann die Tabelle folgendermaßen interpretieren: Die “Wiener Blätter zur Friedensforschung” sind eine Zeitschrift mit überwiegend wissenschaftlichem Charakter; der weitaus größte Teil der Autoren sind Universitätsprofessoren und -assistenten oder Mitarbeiter außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Diese dominierende Sichtweise wird bereichert durch Autoren aus der Praxis, v.a. aus dem Bereich Diplomatie bzw. Politik. Auch Funktionäre von Religionsgemeinschaften und Kirchen kommen zu Wort, ab und zu auch Militärs.
Bei der Zusammensetzung der Autoren kam es 1995 ebenfalls zu einem beachtlichen Wandel in mehrerlei Hinsicht:
Ein Vergleich beider Tabellen, die jeweils die Zusammensetzung vor und nach 1995 zeigen, läßt folgenden Schluß zu: Der Anteil der Kategorie “Religion” ist in etwa gleich geblieben. Der “Auszug der Theologen” in diesem Jahr führte also zu keiner Abwendung des UZF von der Religion. Illustriert kann dies werden an der intern vielbeachteten Jubiläumsausgabe Nr.100 von 1999, in der z.B. auch eine Friedensbotschaft des Papstes abgedruckt wurde. Ich bin sogar überzeugt, daß nach Erscheinen der Nr.107 (zum Zeitpunkt der Auswertung noch ausständig) die Zahl der Vertreter von Religionsgemeinschaften prozentuell noch weiter ansteigen wird, denn es ist für diese Nummer die Aufarbeitung des “Friedensdialoges zwischen Christen und Buddhisten” angekündigt.
Dafür hat sich aber anderes verändert: Der Mittelwert der unter “Diplomatie und Politik” eingestuften Autoren hat sich ca. verdoppelt, jener der unter “Militär” erfaßten Autoren ca. verdreifacht; die entsprechenden Null-Hypothesen können also verworfen werden. An diesem Faktum sieht man übrigens umso mehr, daß das UZF zwar unter seiner neuen Führung keine Abhängigkeit vom Militär wünscht, aber deswegen noch keineswegs militärfeindlich ist. Die Wissenschaftler blieben zwar die weitaus stärkste Gruppe unter den Autoren, seit 1995 gibt es aber immer mehr “Praktiker”, welche die Sichtweise v.a. der Universität ergänzen. Diese Entwicklung ist meiner Meinung nach prinzipiell positiv zu sehen, wobei für meinen persönlichen Geschmack der Anstieg der Militärs - zumindest von den relativen Zahlen her gesehen - etwas heftig war.
Obwohl die Kategorie “Religion” ungefähr gleich geblieben ist, änderte sich die Zusammensetzung der Gruppe der Wissenschaftler unter den Autoren radikal (die Theologen wurden ja von mir zu dieser Kategorie gerechnet).
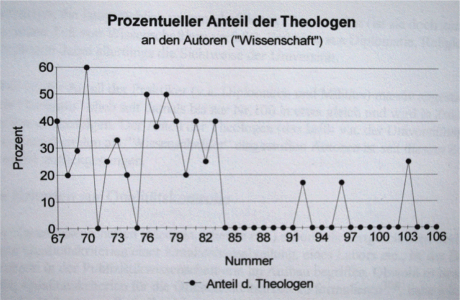
Das Diagramm zeigt den prozentuellen Anteil der Theologen an jenen Autoren, die ich als “Wissenschaftler” eingestuft habe. An einem Beispiel sei die Berechnungsart illustriert: In Nr.76 gab es neun Autoren. Zwei wurden eingestuft in die Kategorie “Diplomatie und Politik”, einer unter “Religion”. Übrig blieben sechs Autoren in der Kategorie “Wissenschaft”, drei davon waren Theologen. Also liegt bei dieser Nummer ein Anteil der Theologen an den Wissenschaftlern von 50% vor.
Im Prinzip läßt sich anhand der obigen Tabelle folgende Aussage treffen: Die entsprechende Null-Hypothese kann verworfen werden. Der Machtwechsel im UZF 1995, der genau zwischen den beiden Nummern 83 und 84 stattfand, führte zu einer völligen Umorientierung der Zeitschrift, der u.a. mit einem radikalen Rückgang der Fachtheologen unter den “wissenschaftlichen” Autoren verbunden war. Nach diesem Bruch sollte nur mehr dann und wann ein Theologe einen einzelnen Artikel publizieren (Nr.92, Nr.96 und Nr.103) - aber das sind nur statistische “Ausreißer”. Im Prinzip wurden die Fachtheologen seit 1995 marginalisiert. Dieses Ergebnis erscheint auch vor dem Hintergrund der Aussagen der Expertengespräche plausibel.
Zusammenfassung
Die Zusammensetzung der Autoren erfolgt in folgenden Gruppen (Aufzählung nach zahlenmäßiger Stärke): Wissenschaft, Diplomatie bzw.Politik, Religion, Militär. Vertreter aus Wirtschaft und von Non-Profit-Organisationen kommen auch vor, sind aber quantitativ vernachlässigbar. Man kann die “Wiener Blätter zur Friedensforschung” daher als eine Zeitschrift charakterisieren, die hauptsächlich wissenschaftlichen Charakter hat (ist sie doch zum überwiegenden Teil von Wissenschaftlern verfaßt). Praktiker aus Diplomatie, Religion und Militär ergänzen dabei allerdings die Sichtweise der Universität.
Nach 1995 ist der Anteil der Praktiker (v.a. Diplomaten und Militärs) massiv angestiegen. Die Kategorie “Religion” blieb seit damals bis zur Nr.106 in etwa gleich und wird in Zukunft tendentiell noch ansteigen. Der Anteil der Theologen (das heißt v.a. der Universitätsprofessoren und -assistenten) an den als “Wissenschaftler” eingestuften Autoren ist seit diesem Zeitpunkt jedoch massiv zurückgegangen.
2.4. Einige Kriterien zur Qualitätskontrolle
Während die Naturwissenschaften (Medizin, Chemie etc.) schon sehr fortgeschritten sind bei der Erstellung von Qualitätskriterien einer Krankenhausabteilung, eines Labors etc., ist der Bereich der Qualitätskontrolle in der Publizistikwissenschaft erst im Aufbau begriffen. Obwohl es beachtenswerte Versuche gibt, Qualitätskriterien für die Öffentlichkeitsarbeit zu formulieren, habe ich z.B. keine vollständige oder halbwegs vollständige Liste von Kriterien gefunden, anhand derer man prüfen könnte, ob z.B. eine Mitarbeiterzeitschrift objektiv gut oder schlecht ist. Einige anerkannte Kriterien gibt es dennoch; ich habe sie mir aus der Fachliteratur “zusammengeklaubt”. Dieses Kapitel erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber wohl den, gewisse Erkenntnisse zu ermöglichen.
Zur Begrifflichkeit: In der P.R.-Fachliteratur spricht man gerne von “Mitarbeiterzeitschriften”, weil man zu betonen pflegt, daß alle Mitarbeiter bei der Gestaltung der “hauseigenen” Zeitschrift miteingebunden werden sollen und diese Publikation außerdem als Plattform der Kommunikation mit den eigenen Mitarbeitern bzw. Mitgliedern gedacht ist. Die “Wiener Blätter zur Friedensforschung” sind in diesem Sinne ohne Zweifel eine Mitarbeiterzeitschrift, denn es geht u.a. um die interne Kommunikation; es ist eine Zeitschrift von Mitarbeitern, die sich auch an Mitarbeiter bzw. Mitglieder der Organisation richtet. Gleichzeitig dienen die “Wiener Blätter zur Friedensforschung” aber nicht nur der internen Kommunikation, sondern, wie oben aufgearbeitet, auch der externen Kommunikation. Es geht also auch darum, z.B. “Opinion Leaders” etwa in der Diplomatie etc. zu erreichen. In gewisser Weise ist es daher auch eine “Diplomatenzeitschrift” etc., je nachdem welche Zielgruppe man als die maßgebliche für eine eventuelle Benennung der Zeitschrift erachtet. Die Bezeichnung “Vereinszeitschrift” erscheint mir ebenfalls nicht falsch, weil das UZF rechtlich betrachtet ein Verein ist, der allerdings eine enge Bindung an die Universität Wien aufweist. Und die “Wiener Blätter zur Friedensforschung” berichten ja u.a. über die Aktivitäten des Vereins bzw. der Organisation.
Gleichzeitig ist die Bezeichnung “wissenschaftliche Fachzeitschrift” sicherlich die beste und angemessenste, weil sie, wie oben ebenfalls aufgearbeitet, hauptsächlich von Wissenschaftlern verfaßt wird und tatsächlich ein hohes akademisches Niveau aufweist. In der weiteren Folge werde ich allerdings trotz alledem den Begriff “Mitarbeiterzeitschrift” verwenden. Dieser ist eigentlich zwar, obwohl richtig, viel zu eng für die “Wiener Blätter für Friedensforschung”; in der P.R.-Literatur wird für die “hauseigene” Zeitschrift allerdings hauptsächlich diese Bezeichnung gewählt und aus Gründen der Einfachheit halte ich mich an diese.
Doch zurück zur Qualitätskontrolle: Ein intuitiv naheliegendes Kriterium konnte nicht zugelassen werden, nämlich jenes der Farbgestaltung. Nach Meinung einschlägiger P.R.-Lehrbücher ist es nämlich wichtiger, seiner Zeitschrift einen soliden finanziellen Hintergrund zu geben und auf diese Art ihren Fortbestand zu sichern. Auch die Häufigkeit der Erscheinung wird allgemein als wichtiger erachtet als die Färbigkeit, d.h. es ist besser, die Zeitschrift erscheint öfter und schwarz-weiß als ab und zu und dafür färbig. Da Farbdruck immens teuer ist, ist er geeignet, eine Zeitschrift finanziell zu verunmöglichen, um nicht zu sagen, zu ruinieren; außerdem sind dann, wenn überhaupt, meist nur seltenere Erscheinungsweisen möglich, was die Wirkung der Zeitschrift schmälert. Das Vorliegen färbiger Gestaltung kann daher kein positives Kriterium der Qualitätskontrolle sein, sondern möglicherweise sogar das Gegenteil. Farbdruck ist nur dann empfehlenswert, wenn wirklich genug Geld vorhanden ist. Die “Wiener Blätter zur Friedensforschung” sind in schwarz-weiß gehalten, was auch den angestrebten wissenschaftlichen und nüchternen Charakter betont.
Zulässige Kriterien für die Feststellung der Qualität einer Mitarbeiterzeitschrift sind u.a. folgende:
Fachliche Qualifikation des Verantwortlichen.
Insbesonders der Verantwortliche für eine Mitarbeiterzeitschrift muß gut qualifiziert sein, um seine Aufgabe adäquat bewältigen zu können. Um die Qualität der Zeitschrift einer Organisation festzustellen, muß daher überprüft werden, ob der Verantwortliche in seinem Lebenslauf wissenschaftliche Ausbildungen und praktische Erfahrungen aufweisen kann, die ihn für die Leitung und Gestaltung einer entsprechenden Publikation geeignet erscheinen lassen.
Anwendung auf die “Wiener Blätter zur Friedensforschung”. Die Chefredakteurin Frau Hofrat Sigrid Pöllinger ist doppelte Akademikerin (Diplomgrad in Dolmetsch Englisch-Russisch sowie Promotion in Philosophie). Nachdem sie zuerst als Dolmetscherin für die englische Botschaft in Wien gearbeitet hatte, wurde sie an der Universität Wien tätig, und zwar im Bereich Friedensforschung. 1979 ernannte man sie zur Generalsekretärin des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF), dem sie heute als Angestellte der Akademie der Wissenschaft zugeteilt ist. Sie arbeitet zudem im Bereich der Diplomatie, u.a. als Mitglied der österreichischen Delegation bei der OSZE. Über letztere Organisation hat sie auch ein Lehrbuch geschrieben, das ich - weil ich bei Recherchen in völlig anderen Zusammenhängen (politikwissenschaftliche Forschungsarbeit) auf häufige Zitierungen stieß - als Standardwerk einschätzen würde. Frau Hofrat Pöllinger nahm und nimmt auch Lehraufträge zur Friedensforschung z.B. an den Universitäten Wien, Klagenfurt sowie ausländischen Universitäten wahr.
Ich glaube ohne Übertreibung sagen zu können, daß man in ihrem Fall von ganz hervorragenden Qualifikationen für die Führung einer Fachzeitschrift zur Friedensforschung sprechen kann, denn es liegen zahlreiche wissenschaftliche Aktivitäten und praktische berufliche Erfahrungen im Bereich Friedensforschung bzw. Diplomatie vor.
Einbindung des Verantwortlichen in den internen Kommunikationsfluß der Organisation
Wenn eine Zeitschrift über die Aktivitäten einer Organisation berichtet, setzt das voraus, daß der Verantwortliche gut über diese Aktivitäten und die Organisation selbst informiert und in den internen Informationsfluß eingebunden ist. Optimal, wenn auch in der Praxis selten, wäre ein Mitspracherecht in führenden Gremien.
Anwendung auf die “Wiener Blätter zur Friedensforschung”. Die Chefredakteurin ist in Personalunion Generalsekretärin der Vereinigung; als solche verfügt sie über Sitz und Stimme im Vorstand. Sie ist über die internen Vorgänge gut unterrichtet, v.a. weil sie auch einen wesentlichen Teil der Organisationsarbeit übernimmt. Ich würde daher auch meinen, daß das Kriterium erfüllt ist und eine Einbindung des Verantwortlichen in den internen Kommunikationsfluß gegeben ist.
Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Publikation
Ein Zeitschrift muß definitionsgemäß mit einer gewissen Häufigkeit im Jahr erscheinen, sonst handelt es sich um keine Zeitschrift. Einmal pro Jahr ist sicherlich nicht ausreichend, sonst liegt vielleicht ein Jahrbuch vor, was an sich nicht schlecht wäre - den Anspruch, eine Zeitschrift zu publizieren, müßte man in diesem Fall aber aufgeben. Wie oft pro Jahr die Publikation erfolgen muß, ist eine Frage der Definition; meiner Meinung nach ist es immer willkürlich, wenn eine genaue Zahl festgelegt wird. Allgemein gilt jedoch: Je öfter, umso besser. Das liegt daran, weil die Wirkung einer Zeitschrift größer ist, wenn sie öfter erscheint.
Egal, welches Erscheinungsintervall festgelegt wurde, es sollte dann auch erfüllt werden. D.h. die Zeitschrift sollte über einen längeren Zeitraum hin regelmäßig in diesem Intervall erscheinen und nicht z.B. nur in einem Jahr viermal, dann für ein Jahr gar nicht, dann wieder in einem Jahr zweimal und im nächsten dreimal, um dann eingestellt zu werden. Ein solche Abfolge wäre wohl ein Zeichen mangelnder Professionalität und defizitärem Management.
Anwendung auf die “Wiener Blätter zur Friedensforschung”. Die Zeitschrift wurde 1974 auf Initiative Leo Gabriels gegründet, sie existiert also bald 30 Jahre. Die “Wiener Blätter” erscheinen viermal pro Jahr, was mir persönlich als vertretbare Häufigkeit erscheint. Von den letzten 10 Jahren liegen mir die kopierten Titelblätter vor, anhand derer ich ersehen kann, daß sie in jedem Jahr wirklich viermal erschienen sind - die Ausnahme liegt beim nur dreimaligen Erscheinen 1995 vor, im Jahr der Krise, die aber überwunden ist. Ansonsten ist die Regelmäßigkeit vorbildlich gewährleistet. Ich meine also auch, daß dieses Kriterium erfüllt ist.
Akzeptanz durch die Führung
Es ist allgemein anerkannt, daß man eine Mitarbeiterzeitschrift innerhalb einer Organisation nur dann langfristig betreiben kann, wenn die Führung voll hinter dieser Publikation steht, sie aktiv unterstützt und bereit ist, dafür eine nicht unbeträchtliche Geldsumme auszugeben. Daß die Zeitschrift durch die Führung gewollt ist, sollte als Zeichen für die anderen Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen öffentlich bekundet werden.
Anwendung auf die “Wiener Blätter zur Friedensforschung”. Ich habe bereits oben festgestellt, daß die Ergebnisse meiner Expertengespräche auf die Akzeptanz durch die Führung hindeuten. Der Präsident meinte, seine Organisation hätte wahrscheinlich die “Existenzberechtigung” verloren, wenn sie eines Tages nicht mehr in der Lage sein sollte, die Zeitschrift weiterzuführen. Auch der 1.Vorsitzende, der 2.Vorsitzende, der Kassier und der Schriftführer bestätigten die Wichtigkeit der Zeitschrift für die Public Relations des Universitätszentrums. Das Kriterium der Akzeptanz der Zeitschrift durch die Führung ist eindeutig erfüllt.
Offenheit nach allen Richtungen, d.h. Meinungsvielfalt
Eine Zeitschrift wir für den Leser interessanter und spannender, wenn sie Meinungsvielfalt zuläßt.
Anwendung auf die “Wiener Blätter zur Friedensforschung”. Dieses Kriterium kann man ganz leicht überprüfen, indem man Artikel sucht, die einander hinsichtlich der grundlegenden Aussage widersprechen. Diese gibt es in den “Wiener Blättern zur Friedensforschung” - z.B. brachte der 1.Vorsitzende Erwin Bader in einer Nummer Aufrufe für die Beibehaltung der Neutralität Österreichs, aber in einer anderen Nummer schreibt wieder z.B. ein NATO-General, der wiederum die Wichtigkeit internationaler Bündnisse zur Friedenssicherung betont. Diese Meinungsvielfalt ist positiv und macht die Zeitschrift lebendig und interessant. Ich werde im Laufe der Arbeit allerdings die Uneinheitlichkeit des Auftrittes des UZF in der Öffentlichkeit dennoch kritisieren und mehr Einheitlichkeit fordern. Für die Zeitschrift gilt das Gesagte nicht, weil nach Meinung wesentlicher P.R.-Lehrbücher eine Zeitschrift durch Vielfalt eher gewinnt, v.a. wenn sie auch der internen Kommunikation (etwa mit Vereinsmitgliedern) dient.
Einbindung aller Mitarbeiter
Die Zeitschrift wird sich dann hoher Akzeptanz erfreuen, wenn möglichst alle Mitarbeiter in die Gestaltung eingebunden werden. Eine Zeitschrift repräsentiert nur dann die Organisation gut, wenn alle Teile der Organisation vertreten sind, also in einer Firma z.B. nicht nur der Generaldirektor, sondern auch der Betriebsrat, in einem Krankenhaus nicht nur der Primararzt, sondern auch der Patientenvertreter etc.
Anwendung auf die “Wiener Blätter zur Friedensforschung”. Meine unabhängige Befragungen der Mitarbeiter voneinander während der Expertengespräche, was denn jeder einzelne in der Organisation so tut, ergab u.a., daß alle Mitarbeiter in die Gestaltung der Zeitschrift irgendwie involviert sind, sei es durch die Verfassung wissenschaftlicher Artikel, Management- und Organisationsaufgaben, Indexerstellungen, Vermarktung via Internet, Fund Raising (z.B. Subventionen, Inserentengewinnung), Lektoratsarbeiten (z.B. Korrekturlesen, Transformierung von Schreibmaschinenmanuskripten in Computerdateien) etc. Praktisch jeder war mit der Handhabung zufrieden; viele schienen auf ihre Tätigkeit stolz und waren nach meinem Eindruck hochmotiviert.
Allerdings stieß ich in meinen Interviews auf ein Vorstandsmitglied, Herrn Prof.Böhm, der mir gegenüber meinte, seine Beiträge wären von der Redaktion der “Wiener Blätter zur Friedensforschung” nach seinem Eindruck “nicht erwünscht”. Er fühlte sich - subjektiv - hinsichtlich seiner Präsenz in der Zeitschrift benachteiligt. Tatsächlich läßt sich eine sehr geringe Präsenz seiner Person in der Zeitschrift feststellen. So ist er seit der Nummer 84 (Amtsantritt der neuen Führung) bis zur Nummer 106 (letzte Nummer zum Zeitpunkt meiner Recherchen) nur zweimal vertreten, das letzte Mal schrieb er in der Nummer 90 im März 1997.
Ich denke aus verschiedenen Gründen aber ausdrücklich nicht, daß wirklich ein bewußter Ausschluß seiner Person im Sinne einer Zensur vorliegt, sondern eher ein gegenseitiges Mißverständnis. Nicht zuletzt bin ich deshalb dieser Ansicht, weil die Generalsekretärin Frau Hofrat Pöllinger, die zugleich Chefredakteurin der “Wiener Blätter zur Friedensforschung” ist, im Interview - von sich aus, d.h. ungefragt - die explizite Aufforderung an mich richtete, ich möge auf jeden Fall auch Prof.Böhm interviewen, er sei für das UZF “äußerst aktiv” und sollte “auf keinen Fall übergangen werden”. Dies war nicht der einzige Grund, warum ich ihn aufsuchte - ich hätte es sowieso vorgehabt -, aber sicher ein wesentlicher Faktor, warum ich es nicht vergaß und auch ehestbaldigst tat. Die Generalsekretärin hätte so etwas kaum zu mir gesagt, wenn sie ein Vorstandsmitglied wirklich aktiv ausschließen wollte; dieser Umstand relativiert die ganze Problematik schon außerordentlich.
Auf jeden Fall fühlt sich ein Vorstandsmitglied subjektiv - ob zu Recht oder Unrecht - benachteiligt; es zieht sich daher tendentiell zurück, liefert keine Artikel mehr ab, sondern nützt eher andere Publikationsmöglichkeiten, die ihm ebenfalls zur Verfügung stehen. Entsprechend gering fällt auch seine Präsenz aus.
Ich würde folgendes vorschlagen: Man soll das Problem mit Prof.Böhm klären, indem man zunächst ausdrücklich und offiziell feststellt, daß jeder Beitrag jedes UZF-Mitarbeiters erwünscht ist. Man soll ihn auch in Zukunft in die Gestaltung der Zeitschrift stärker einbinden. Selbst, wenn seine Klagen, irgendwann übergangen worden zu sein, zu Unrecht bestehen sollten, ist es für die interne Kommunikation und das Betriebsklima gut, wenn man auf ihn zugeht, sowohl im Sinne der P.R., als auch im Sinne der Friedensidee.
Es ist außerdem meiner Ansicht nach wirklich schade, wenn man so eine engagiert gemachte Zeitschrift hat, die sonst alle Qualitätskriterien erfüllt und dann gerade an einem auch nur ansatzweise Zweifel bestehen läßt. Prinzipiell hat Herr Prof.Böhm als Vorstandsmitglied, das stelle ich aus P.R.-Sicht fest, das Recht, berücksichtigt zu werden; alle Richtungen der Organisation sollen nämlich in der “hauseigenen” Zeitschrift vertreten sein; und obwohl ich ansonsten in der vorliegenden Arbeit für mehr Einheitlichkeit im öffentlichen Auftritt plädieren werde, gilt das Gesagte für die Zeitschrift - wie oben festgestellt - nicht; nach Meinung der Fachliteratur gewinnt diese eher durch Vielfalt.
Insgesamt glaube ich, daß das vorliegende Kriterium in Großen und Ganzen erfüllt ist, daß man aber den “Fall Böhm” berücksichtigen und zur Zufriedenheit aller Beteiligten klären wird müssen.
Unabhängigkeit der Redaktion
Die Unabhängigkeit der Redaktion ist fast das wichtigste, wenngleich das am schwersten zu überprüfende Kriterium der Qualität einer Zeitschrift. Eventueller Zensur fällt immer zuerst Wahres, Kontroversielles, Kritisches etc. zum Opfer. Hofberichterstattung über die Unternehmensführung interessiert niemanden, sondern befriedigt nur die Eitelkeiten der Chefetage. Nur freie Redaktionen können Qualität liefern! Es ist ein häufiges Problem in der Praxis, daß die Unabhängigkeit der Redaktion innerbetrieblich oftmals nicht gewährleistet ist.
Anwendung auf die “Wiener Blätter zur Friedensforschung”. Es ist in der Praxis sehr schwierig bis unmöglich, die wirkliche Unabhängigkeit der Redaktion zu überprüfen, noch dazu für einen Außenstehenden. Mir sind allerdings keinerlei Klagen (auch keine anonymen) zu Ohren gekommen, daß diese nicht gewährleistet, sondern durch Weisungen “von oben” gefährdet sei. Ich möchte nochmals betonen, wie wichtig die Unabhängigkeit der Redaktion ist; sie ist eine “conditio sine qua non” für publizistische Qualität.
Mir gegenüber anonym geäußerten Klagen darüber, daß die Chefredakteurin der “Wiener Blätter zur Friedensforschung” sich in ihre Arbeit nichts dreinreden läßt und fast völlig autonom über den Inhalt der einzelnen Nummern entscheidet, kann ich nur entgegnen: Das gehört sich auch so, es wäre schlimm, wenn es anders wäre. Die Redaktion besteht im Falle der “Wiener Blätter zur Friedensforschung” eben im Prinzip aus der einen Verantwortlichen, nämlich eben der Chefredakteurin; ich betone, daß sie zwar von den entsprechenden Gremien des UZF eingesetzt werden kann, aber einmal im Amt, bei Erfüllung ihrer redaktionellen Aufgabe aus Sicht der Publizistikwissenschaft an keinerlei Weisungen gebunden sein darf, weder von den drei Vorsitzenden, vom Präsidenten, vom Vorstand, vom Herausgeber noch von sonst irgendjemandem. Man darf sich nur dann legitim über ihre Arbeit beklagen, wenn eines der von der Publizistikwissenschaft erarbeiteten (und zuvor skizzierten) Qualitätskriterien nachweisbar nicht erfüllt ist oder zumindest begründete Zweifel an einer solchen Erfüllung bestehen, d.h. die redaktionelle Freiheit findet natürlich innerhalb dieser Rahmenbedingungen statt, die aber praktisch ohnehin nach meinem Dafürhalten erfüllt werden; daran hat die Chefredakteurin auch ein Interesse, weil sie, so mein persönlicher Eindruck, sich mit dem Projekt sehr identifiziert, und daher ihre Arbeit unbedingt gut machen will - was nach dem Ergebnis dieser Studie auch tatsächlich geschieht.
Ergebnis der Qualitätskontrolle
Zusammenfassend kann ich aufgrund der Erfüllung aller publizistikwissenschaftlicher Qualitätskriterien sagen, daß die “Wiener Blätter zur Friedensforschung” eine - objektiv - hervorragend gemachte Publikation sind.
Redaktionsstatut
Es ist ein Zeichen von Professionalität, wenn eine Redaktion über ein “Redaktionsstatut” verfügt, in dem die redaktionelle Freiheit und Autonomie einerseits, die Richtlinien der redaktionellen Gestaltung (im Sinne der hier skizzierten Qualitätskriterien) andererseits betont wird. Ich unterbreite für ein solches Redaktionsstatut einen Vorschlag, der alle in diesem Abschnitt genannten Aspekte berücksichtigt. Änderungen sollten daran am besten gar nicht getroffen werden, weil die redaktionelle Freiheit maximal sein muß und die publizistikwissenschaftlichen Qualitätskriterien so formuliert sind, daß sie nur formale und minimale Einschränkungen beinhalten; jede weitere Einschränkung könnte daher geeignet sein, die Pressefreiheit zu stören.
Ein Redaktionsstatut dient der Absicherung der redaktionellen Freiheit, nicht der Kontrolle der Redaktion. Daher darf es nur bei Zustimmung der Redaktion angenommen oder abgeändert werden. Es beruht auf Übereinkunft zwischen Vorstand und Redaktion, nicht auf Verordnung.
Redaktionsstatut
der “Wiener Blätter zur Friedensforschung”
Vierteljahreszeitschrift des UZF
§1.
Verantwortlich für die Gestaltung der Zeitschrift ist der Chefredakteur, der seine redaktionelle Arbeit vollständig weisungsfrei erfüllt. Die Freiheit der Redaktion, die im “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) aus seiner Person besteht, ist zu jeder Zeit zu gewährleiten.
§2.
Bei Erfüllung seiner Aufgabe muß der Chefredakteur - neben den Prinzipien der Wissenschaftlichkeit und der Aktualität - die grundlegende Linie der Zeitschrift beachten, die auch im Impressum abzudrucken ist:
“Die Zeitschrift dient zur Förderung der Friedensforschung und zur Verbreitung ihrer Ergebnisse in völliger Unabhängigkeit von politischen Parteien und Interessensgruppen, jedoch in Anlehnung an das Universitätszentrum für Friedensforschung.
Außer den Berichten über die Tätigkeit des UZF bringt die Zeitschrift Aufsätze von in- und ausländischen Wissenschaftlern u.a. zu folgenden Themenbereichen: Zusammenhänge von Anthropologie und kriegerischen Auseinandersetzungen, allgemeine und spezielle Probleme der Friedens- und Konfliktforschung sowie Buchbesprechungen.”
§3.
Bei Besetzung des Amtes des Chefredakteurs müssen durch das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) folgende zwei Qualitätskriterien sichergestellt werden:
(a) Es müssen wissenschaftliche Qualifikationen und optimalerweise auch praktische Erfahrungen vorliegen, welche den Chefredakteur zur Führung einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift zur Friedensforschung geeignet erscheinen lassen.
(b) Der Chefredakteur muß in den internen Informationsfluß der Organisation eingebunden sein, weil er über deren Aktivitäten berichten und daher ständig über diese auf dem letzten Stand informiert werden muß; nach Möglichkeit sollte er daher in Personalunion Vorstandsmitglied sein.
§4.
Bei Erfüllung seiner Aufgabe soll der Chefredakteur nach Kräften über die Einhaltung folgender weiterer Qualitätskriterien wachen:
(a) Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Publikation. Als Häufigkeit bzw. Erscheinungsintervall ist eine viermal jährliche Publikation festgesetzt; dieses Intervall soll nach Möglichkeit regelmäßig erfüllt werden.
(b) Offenheit nach allen Richtungen bzw. Meinungsvielfalt. Da eine Zeitschrift durch Vielfalt gewinnt, ist die Berücksichtung vieler verschiedener Meinungen zu gewährleisten.
(c) Einbindung aller Mitarbeiter. Nach Möglichkeit sollen alle Mitarbeiter des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) in die Gestaltung der Zeitschrift eingebunden werden. In den veröffentlichten Artikeln müssen alle Richtungen in der Organisation und insbesonders im Vorstand auf deren Wunsch und Inititative hin angemessen berücksichtigt werden, d.h. jede zu einem gewissen Minimum und darüberhinaus im Verhältnis zur Größe des Beitrages hinsichtlich Inserentengewinnung, redaktioneller Arbeit, Management, Lektoratstätigkeit, Internetvermarktung etc., wozu jeder aufgefordert und eingeladen ist. Externen Autoren v.a. aus Wissenschaft und Praxis kommt ebenfalls große Bedeutung zu.
§5.
Der Vorstand des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) betont ausdrücklich die große Bedeutung der Zeitschrift für die interne und externe Kommunikation der Organisation und unterstützt dieses Projekt nach Kräften. Seit ihrer Gründung durch den Wiener Philosophen Leo Gabriel im Jahre 1974 konnte die Zeitschrift mit Erfolg eine öffentliche Wirksamkeit im Sinne der Friedensidee entfalten konnte. Die “Wiener Blätter zur Friedensforschung” sind auch deshalb unterstützenswert, weil sie - so der momentane Stand - die einzige wissenschaftliche Fachzeitschrift zu besagtem Gebiet in Österreich sind.
§6.
Die Finanzierung der Zeitschrift erfolgt durch das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF), v.a. über die von ihm empfangenen Mitgliedsbeiträge, Subventionen, Spenden sowie über Abonnements und Inserate, wobei einer Abdeckung der Druckkosten durch Werbung zu einem Drittel entgegenzustreben ist. Alle Mitarbeiter des UZF sind dazu aufgerufen, sich an der finanziellen Sicherung der Zeitschrift durch Fund Raising-Aktivitäten zu beteiligen.
§7.
Annahme und Änderung des vorliegenden Dokumentes, das intern allseits zu beachten und zu respektieren ist, können nur vom Vorstand des UZF mit 2/3-Mehrheit und bei ausdrücklicher Zustimmung des Chefredakteurs getroffen werden (wegen des Übereinkunftscharakters eines Redaktionsstatuts zwischen Vorstand und Redaktion). Für Entscheidung über die Auslegung und die korrekte Anwendung der vereinbarten Richtlinien ist, wenn keine Einigung im Konsens erfolgt (der von allen Beteiligten immer nach Kräften anzustreben ist), in letzter Instanz das in den UZF-Statuten vorgesehene unparteiische Schiedgericht berufen, das auf Basis dieses Dokumentes, unter Anhörung aller Seiten und unvoreingenommener Prüfung sämtlicher vorgelegter Fakten urteilt.
3. Der Internet-Auftritt
3.1. Usability
Zunächst sollen einer Auseinandersetzung mit der Internet-Präsenz des UZF einige Gedanken zu Jakob Nielsens Konzept der “Usability” vorausgeschickt werden; Nielsen hat sich mittlerweile in Kreisen der Publizistikwissenschaft den Ruf einer Art Kapazität im Bereich Internetgestaltung erworben hat, obwohl es auch legitime Kritik an ihm gibt. Wörtlich übersetzt bedeutet “Usability” wohl “Brauchbarkeit” - und zwar Brauchbarkeit der Angebote im Internet. Brauchbar sollen diese Angebote in erster Linie für den User sein. Man sieht: Nielsens Konzept ist ausgesprochen rezipientenorientiert, was auch notwendig ist, denn eine Homepage kann sich wohl nur dann über hohe Zugriffsraten und Akzeptanz erfreuen, wenn sie nicht nur den Bedürfnissen des “Senders”, sondern vor allem denen des “Empfängers” entspricht.
Wenn man eine sinngemäße Übersetzung wählt, könnte man Usability - in meiner Interpretation des von Nielsen Gemeinten - auch als “Medienadäquanz” bezeichnen. Jedes Medium besitzt eine ihm eigene Struktur, die den Kommunikationsprozeß in bestimmte Bahnen lenkt; das Medium ist nicht “neutral”, es formt die Kommunikation. Gewisse Inhalte in gewisser Form lassen sich z.B. in einem bestimmten Medium eben besser kommunizieren als in anderen. In diesem Sinne könnte man dem in der Publizistikwissenschaft in der Regel durchaus geschätzten genialen Selbstdarsteller und Pop-Philosophen Marshall McLuhan recht geben, wenn er meint: “Das Medium ist die Botschaft”.
Nielsen ist sich dieses Umstandes voll bewußt, wenn er z.B. in einem Interview sagt:
“It turns out that the old medium of the book is still the best approach to telling a long story in proceeding linearly through an argument to build up to a conclusion. Also, from a pragmatic perspective, the book has a huge numbers of screenshots in it, and these examples would have been difficult to present on the Web and preserve the ultra-fast response times I believe in.”
Ein Medium wie das Buch bietet also ein günstiges Umfeld für Aufbau und Entfaltung eines umfangreichen Gedankengebäudes. Solche Inhalte in einer solchen Form könnten nicht nur über das Internet, sondern ganz besonders über das Fernsehen nur schwer transportiert werden, vielmehr legt das Fernsehen eine andere Gestaltungen der Aussage nahe - z.B. kurze, bilderreiche, emotionalisierende, unterhaltsame Sequenzen; ein Umstand, der Neil Postman zu einer wortreichen Klage über den Kulturverfall des Abendlandes durch das Fernsehen veranlaßt, den ich in meiner jüngsten Forschungsarbeit für die Abteilung Medienpädagogik des Bundesministeriums für Wissenschaft nicht diagnostizieren konnte.
Das Internet besitzt ebenfalls eine eigene Struktur mit ganz besonderen, ihr innewohnenden Möglichkeiten und Grenzen. Immer wieder wird von Autoren z.B. die verstärkte “feedback”-Möglichkeit hervorgehoben, die in den “alten” Medien nicht in diesem ausgeprägten Sinne gegeben ist. Im Internet kann jeder Empfänger (Rezipient) ohne allzu großen finanziellen Aufwand potentiell zum Sender (Kommunikator) werden, was Perspektiven für ein Mehr an Demokratie in der Kommunikation eröffnet. Das Internet wird so zum unverzichtbaren Bestandteil einer dialogorientierten Unternehmenskommunikation; die Dialogführung mit Öffentlichkeiten via Internet ist bereits in der Praxis mit Erfolg erprobt worden.
Da das Internet ein Neues Medium ist, kann nur schwer gesagt werden, welche inhaltliche und formale Gestaltung ihm “angemessen”, also medienadäquat ist. Welche Gestaltung kommt der Struktur des Internet entgegen, welche nicht? Dieser Frage stellt sich Nielsen. Seine Suche nach der Usability ist eine Suche nach neuen, medienadäquaten Darstellungen im Internet, wobei besonders das Interesse der Benutzer des Mediums im Zentrum steht. Wenn der Anbieter seine Internet-Angebote benutzerfreundlich gestaltet, nützt ihm das aber auch, weil die Zugriffe auf seine Homepage erhöht werden. Nielsen schätzt, daß zahlreiche E-Commerce-Seite durch bessere Gestaltung hinsichtlich Usability ihr Verkaufsvolumen um 500-1000% steigern könnten. Er muß aber eben auf die Bedürfnisse seiner User eingehen und der Struktur des Internet gerecht werden.
Was macht eine Homepage aber nun “useable”?
Nielsen ist weit davon entfernt, die alleinig seligmachenden Patentlösungen anzugeben. Er äußert aber meiner Meinung nach viele gute Gedanken dazu, z.B. folgende. Auf eine Interview-Frage“What are the key things designers can do to improve their site’s usability?” antwortet er u.a.:
“The most important thing is to discover the three main reasons users come to your site and make these things extremely fast and obvious to do. Less common actions should certainly not be any more complicated than necessary but priority should be given to the key users goals.
I also recommend defining an information architecture that matches the users’ model of the information space and to design a fairly minimalist navigation system to move people around this architecture. I don’t think everything should be linked to everything else, but there should be a few navigation features and more local navigation than we typically see on current websites...
Finally, of course, all pages should download as quickly as possible”
Wichtig sind nach Nielsens Meinung also:
Beantwortung von Fragen über die User wie z.B.: Warum schauen sich die User meine Seite an? Was suchen sie? Was wollen sie eigentlich? Aus welchen Ländern kommen sie? Nur wenn man die Antwort auf solche und ähnlich Fragen kennt, kann man seine Internet-Präsenz optimieren.
Vorhandensein eines übersichtlichen Navigationssystems. Man soll sich auf einer Seite nicht “verirren”; sie soll übersichtlich sein; man soll schnell und einfach wieder z.B. auf die Ausgangsseite zurückkommen.
Schnelle Ladezeiten. Nielsen ist ein geschworener Feind von zuvielen Bildern; diese sind zwar schön, laden aber zu lange. Netto-Wartezeiten über fünfzehn Sekunden lehnt Nielsen ab. (Zur Erklärung: Die Wartezeit im Internet ist abhängig von der Tageszeit; es geht schneller oder langsamer, je nachdem, wieviele User gerade im Netz sind. Die Wartezeit hängt aber auch von der Informationsmenge ab, die heruntergeladen wird. Diese Netto-Wartezeit, die unabhängig von der Tageszeit ist kann man ganz leicht berechnen, indem man die Zahl der geladenen Kilo- bzw. Megabytes durch die Ladekapazität des Modems dividiert. Es gibt automatisierte Computerprogramme, die das überprüfen). Die einzige Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, ob der zu erwartende technische Fortschritt die Ladekapazität bald so groß machen wird, daß selbst sehr viele Bilder die Ladezeit nicht verlängern, was momentan aber noch nicht der Fall ist.
Ich warne davor, alles, was Nielsen sagt, unreflektiert aufzunehmen; er steht Marshal McLuhan in seinem Wunsche nach Selbstdarstellung nämlich um nichts nach (auf seiner Homepage kann man z.B. seine Vorträge buchen, beworben mit dem Hinweis “rent-a-guru”). Aber er hat viele gute Ideen, welche man berücksichtigen sollte, natürlich adaptiert an die Bedürfnisse der eigenen Organisation.
Einige der von ihm gegebenen Anregungen halte ich für besonders wichtig:
Er lehnt Adressen (URLs) ab, bei deren Eintippen man sich fast die Finger bricht, z.B. “a52q5368439_figview.htm” oder ähnliches; besonders “evil” zum Tippen ist seiner Meinung nach auch das Zeichen “~”. Die Adresse soll gut zu merken sein und etwas über die Homepage aussagen.
Nielsen ist überhaupt ein Puritaner, der meint, man solle der Versuchung nicht erliegen, zu viele färbig leuchtende, blinkende, hüpfende, pulsierende, tanzende, wandernde, kriechende, singende, jodelnde etc. Schriftzüge, Bilder oder sonstige Objekte zu installieren und eine Art Las Vegas aus der eigenen Homepage zu machen - was ja technisch ganz leicht möglich wäre -, nicht zuletzt auch aufgrund der längeren Ladezeiten. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob er hier ganz recht hat, denn ich weiß von den statistischen Auswertungen meiner eigenen Homepage, daß solche Seiten meistens mehr Zugriffe haben als andere; aber für eine wissenschaftliche Seite scheint mir Nüchternheit auf jeden Fall angebracht. Den HTML-Befehl “BLINK” bezeichnet Nielsen als “simply evil”.
Es soll nach Nielsens Meinung auch keine “verwaisten Seiten” geben, sondern man soll von überall zur Hauptseite zurückkommen; nicht zuletzt, weil manche User ja nicht über die Haupt-, sondern einer Nebenseite “einsteigen”. Er warnt vor zu langem “Scrollen” des Textes, wobei mir diese Warnung fraglich und wenig begründet erscheint. Er rät dazu, sich an die Standardfarben der Links zu halten (Blau heißt: “Link”, Lila heißt “schon besucht”), bei Bruch dieser Konventionen entsteht sonst Verwirrung. Man soll seiner Meinung nach überhaupt die Möglichkeiten der Vernetzung nützen und auch Einrichtungen zu Rückmeldungen per e-mail schaffen.
Was Nielsen aber für ganz besonders wichtig hält, sind ständige Updates, d.h. die im Internet vorhandenen Informationen müssen in regelmäßigen Abständen überprüft und auf den neuesten Stand gebracht werden (obwohl es auch dauerhaftere Inhalte gibt). Aber es soll nicht der Eindruck entstehen, daß sich niemand um die Seite kümmert. Er rät aus diesem Grund auch großen Firmen dazu, nicht nur Geld für die Gestaltung, sondern auch für die “Wartung” der Homepage zu budgetieren, was mir auf Non-Profit-Organisationen aufgrund deren Geldmangel für nur in beschränktem Maße übertragbar erscheint (dort beruht in der Praxis vieles auf Eigeninitiative; weder das eine, noch das andere wird daher wirklich budgetiert). Aber Nielsen hat sicherlich recht, daß die regelmäßige “Wartung” genauso wichtig ist wie die erste Gestaltung.
Soviel zur Ebene der “Taktik”, also der guten Umsetzung. Aber auch zum dahinterliegenden Web-Management, also zur Internet-”Strategie”, nimmt Nielsen Stellung. Ich werde nicht all seine Anregungen nennen, weil manche für den vorliegenden Fall, eine kleine Friedensforschungsstelle, unbrauchbar sind, z.B. wenn er davor warnt, Intranet und Internet zu vermischen und als dasselbe zu behandeln; er meint, man würde für beides eigene Ansätze brauchen. Im Falle des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) ist es schon ein großer Fortschritt, daß man überhaupt im Internet aktiv ist; es gibt dort kein Intranet. Ich bin auch der Meinung, daß ein paar Leute, die ihr Büro im selben Gang am Institut für Philosophie haben, zur Not auch ohne technisch hochwertige, betriebsinterne Computernetzwerke miteinander kommunizieren können, z.B. indem sie gemeinsam einen Kaffee trinken; man soll es ja nicht übertreiben mit der modernen Technologie.
Folgende für diese Arbeit relevante Punkte müssen aber genannt werden:
Zunächst sollte man die Bedeutung des Internet kennen. Es ist ein wichtiges Medium, das weltweit schon hunderte Millionen Menschen benutzen; es spielt für Wahlkampfkampagnen, für P.R., für andere Kommunikationsaktivitäten schon jetzt eine wichtige Rolle, die wachsen wird. Präsenz eines Unternehmens im Internet ist kein Luxus, sondern hat zentrale strategische Bedeutung. Dieser Umstand sollte auch organisationsintern bekannt und geschätzt werden. Das Internet ist kein “sekundäres” Medium, sondern genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als andere Kommunikationsaktivitäten.
Man sollte wissen, warum man im Internet ist, d.h. was man eigentlich mit dieser Kommunikationsmaßnahme erreichen will. “Weil es alle machen” ist kein Grund; diese Einstellung steht der optimalen Nutzung nur im Wege.
Auch soll man nicht nur für den Chef “designen”. Das ist tatsächlich ein häufiges Problem in der Praxis, wie zuvor auch im Zusammenhang mit Betriebszeitschriften gesagt wurde, die oftmals nur gestaltet werden, um dem obersten Boss zu gefallen, aber nicht, um Publikum anzusprechen. Nielsens Feindbild Nr.1 sind die eitlen “Senior Vice Presidents”, die alle am liebsten eine eigene Fotogalerie von sich selbst auf der Homepage haben möchten, verbunden mit kriecherischer Beweihräucherung durch gefällige Hofschranzen.
3.2. Anwendung auf das UZF
Das Internet ist das neue Medium der globalisierten Welt; es besitzt bereits jetzt große Bedeutung, aber noch immer ein ungeheures Potential. Es ist im Prinzip die Erfüllung der Prognose Marshal McLuhans, der lange vor der Erfindung der Datenhighways vorhergesehen hat, daß die Neuen Medien durch ihre phänomenalen Geschwindigkeiten Raum und Zeit zu überwinden vermögen und daß “elektrisch zusammengezogen die Welt nur mehr ein Dorf ist”.
Es ist das ideale Medium für eine auf internationale Kontaktnahme ausgerichtete Organisation wie das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF), noch dazu, wenn ohnehin kaum Geld vorhanden ist. Das Internet kostet praktisch nichts (Speicherplatz stellt im vorliegenden Fall die Universität zur Verfügung), es ist nur die Arbeitskraft und das Know-How notwendig, das man in die Gestaltung investiert; wenn Eigeninitiative da ist, kann man sich auch die Anstellung eines eigenen Designers sparen. Es ist nach Nielsens Ansicht auch nicht immer notwendig, immer das beste, schrillste und EDV-mäßig komplizierteste Design zu haben. Es kommt darauf an, daß die Homepage lebt, mit Liebe und Engagement betreut und gewartet wird etc. Solche Seiten haben oftmals mehr Reiz als um teures Geld von einer externen Agentur perfekt designte Auftritte, um die sich dann aber niemand kümmert.
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) ist im Internet präsent, und zwar unter einer Adresse, die Nielsen gefallen würde: “frieden.univie.ac.at”, wodurch das Anliegen des Friedens sowie die Bindung an die Universität Wien (“univie” ist, wie allgemein bekannt, die Abkürzung der “University of Vienna”) gezeigt wird.
Die - in der Gesamtheit positiv ausgegangene - Qualitätskontrolle des Internet-Managements bestand aus einem Interview mit dem “Webmaster”, dem 1.Vorsitzenden Prof.Bader zum Internet-Management. Auf sein Engagement geht die Präsenz des UZF im Internet zurück; es ist sein Verdienst, daß seine Organisation das 21.Jahrhundert nicht verschlafen hat. Das Interview deutet darauf hin, daß sowohl auf der Ebene der Strategie, als auch der Taktik die oben genannten Forderungen zur “Usability” im wesentlichen erfüllt sind. Die Wissenschaftlichkeit seiner Organisation verlangt, führte er mir sinngemäß aus, einfache und nüchtern gestaltete Information, keinen Firlefanz, wobei sich das UZF hier ganz auf einer Linie mit Nielsen befindet, der letzteren überhaupt ganz ablehnt, weil als positiver Nebeneffekt bei Verzicht geringe Ladezeiten vorhanden sind.
Prof.Bader hat in der Vergangenheit auch z.B. Seminare an der Universität Wien zur Globalisierung geleitet, ist sich also über die zunehmenden internationalen Vernetzungen und das Zusammenrücken der ganzen Welt u.a. durch die Neuen Medien vollkommen bewußt. Er benutzt das Netz auch nicht nur aus dem Grund, weil es alle tun, sondern weil er die Erleichterung von internationaler Kontaktnahmen und auch die Möglichkeit, öffentlich leicht verfügbare Informationen zum Frieden und über die eigene Organisation zur Verfügung zu stellen, gegeben sieht, was beides den Zielen des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) entspricht. Außerdem räumt er dem Internet richtigerweise eine zentrale Rolle in der Kommunikation (P.R.) seiner Forschungsstelle ein, behandelt es also keineswegs als sekundäres Medium, obwohl es natürlich schon “Begleitungen” anderer Kommunikationsaktivitäten gibt, z.B. werden Veranstaltungen angekündigt; auch die Zeitschrift wird im Internet beworben - ein vom Schriftführer Herbert Sticklberger erstellter Index der publizierten Arbeiten ist online ebenfalls vorhanden. Prof.Bader kümmert sich sehr intensiv um die UZF-Präsent im Internet, erneuert die Informationen ständig; man kann auf jeden Fall sagen, daß das Projekt lebt.
Die meisten anderen im UZF interessieren sich - auch aus Generationsgründen - nicht so sehr für das Internet (obwohl man niemanden unterschätzen soll, denn der Kassier Prof.Kaiser besitzt zu meiner Überraschung auch einen Internetanschluß und meinte im Gespräch mit mir, er “könne ohne Internet gar nicht mehr leben”, was ihn als Mann Mitte siebzig wohltuend von vielen seiner Altergenossen unterscheidet - man sieht, daß Jugend bei vielen keine Frage der Lebensjahre, sondern der inneren Einstellung und der Aufgeschlossenheit ist.)
Dieser besagte Umstand, daß sich außer den Genannten praktisch niemand mit Internet auskennt oder, wenn ein solches Wissen doch vorhanden sein sollte, sich nicht für das UZF im Internet engagiert, hat eine positive und - möglicherweise - eine negative Seite. Die positive Seite ist, daß Prof.Bader “redaktionelle Freiheit” bei der Internetgestaltung genießt und ihm niemand “dreinredet”. Nielsens Warnung vor zu starker Zensur, die zu Qualitätsverlust z.B. durch erzwungenen Personenkult führen kann, ist im vorliegenden Fall also ungerechtfertigt. Die negative Seite ist, daß - möglicherweise - das Engagement im Internet allgemein nicht genug geschätzt wird und von vielen im UZF nicht als mindestens ebenso wichtig wie andere Kommunikationsaktivitäten (z.B. Veranstaltungen) erachtet wird. Das wäre aber eine Fehleinschätzung; es stellt sich die Frage, ob man mit dem Internet nicht viel mehr Menschen erreichen kann als mit manchen Symposien.
Auf eine solche UZF-interne Einschätzung deutet z.B. auch der Umstand hin, daß im Internet zwar die Zeitschrift beworben wird, aber man weder im Impressum der Zeitschrift, noch in einem kleinen Inserat Hinweise auf die Homepage findet. Ich rege an, die Homepage auch in der Zeitschrift zu bewerben, das nennt man “cross promotion” (das heißt, wenn ein Unternehmen mehrere Medien hat, bewirbt sie das eine im anderen; so schaukeln sich diese gegenseitig auf zu mehr Erfolg). Es muß allgemeiner common sense sein, daß dem Internet zentrale Bedeutung in der Kommunikation des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) und daß dem 1.Vorsitzenden als Verantwortlichem bei Gestaltung der Homepage ein wichtiger Verdienst zukommt!
Eine noch verbleibende Kritik des Managements der Kommunikation via Internet im UZF gibt es aus Perspektive des rezipientenorientierten Ansatzes Nielsens: Ein Internet-Auftritt schöpft nur dann sein volles Potential aus, wenn man die Bedürfnisse seiner User kennt und sie durch entsprechende Informationsangebote befriedigt. Eine Voraussetzung dafür ist, daß man die Homepage evaluiert und Informationen über die User sammelt. Ein vielleicht nicht ausreichender, aber zumindest erster Schritt dazu wäre die automatisierte statistische Auswertung von Daten mithilfe spezieller Software. Es muß auch geprüft werden, ob genügend Feedback-Möglichkeiten vorhanden sind, damit das Dialogpotential des Internet auch ausreichend ausgeschöpft wird.
4. Die Veranstaltungen
4.1. Allgemeines
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) organisiert jedes Semester wissenschaftliche Veranstaltungen, welche die Ergebnisse der Friedensforschung an eine breitere Öffentlichkeit vermitteln sollen. Ich würde zunächst einmal die Grundunterscheidungen zwischen “Lehrveranstaltungen” und “Kongressen” treffen. Die unter Verantwortung des UZF durchgeführten Lehrveranstaltungen an der Universität Wien finden regelmäßig, d.h. jede Woche das ganze Semester hindurch statt und richten sich v.a. an Studenten der Universität Wien.
Jene Veranstaltungen, die ich unter dem von mir gewählten Oberbegriff “Kongresse” zusammenfasse, finden wesentlich seltener, nämlich ein paar Mal pro Jahr zu verschiedenen, ausgewählten Themen statt und haben daher, obwohl manche Kongreßreihen fortgesetzt werden, im Gegensatz zu den Lehrveranstaltungen, keinen regelmäßigen Charakter. Sie richten sich v.a. an die wissenschaftliche Fachwelt, an Diplomaten und andere “Opinion Leaders” etc. Studenten und überhaupt alle Interessierte dürfen natürlich auch teilnehmen; Studenten werden in den Lehrveranstaltungen auch auf die Kongresse hingewiesen.
Ich möchte gleich vorweg sagen, daß ich persönlich glaube, daß das UZF innerhalb der Jahrzehnte seines Bestehens eine sehr hohe Kompetenz hinsichtlich der Veranstaltungstätigkeit erworben hat.
4.2. Die Lehrveranstaltungen
Im Prinzip finden unter Federführung des UZF zwei Lehrveranstaltungen am Institut für Philosophie der Universität Wien statt.
Einerseits gibt es jedes Semester eine Basislehrveranstaltung, die “Arbeitsgemeinschaft Friedensforschung”, unter der Hauptverantwortung von Herrn Prof.Bader. In ihr werden grundsätzliche und aktuelle Probleme der Friedensforschung beleuchtet. Die Teilnehmer können sich über selbsterarbeitete und meist auch frei gewählte Themen aus dem Feld Friedens- und Konfliktforschung sehr stark einbringen, indem sie ihre Ergebnisse im Plenum referieren, wo sie anschließend diskutiert und kritisiert werden.
So wird jedes Mal ein weites Spektrum von Problemkreisen behandelt - von Huntingtons Kulturknallthese bis zu Leben und Werk Bertha von Suttners, von der Geschichte der Friedensbewegung bis zur aktuellen Debatte um die gegenwärtige und zukünftige österreichische Sicherheitspolitik. Die Lehrveranstaltung, das weiß ich aus Gesprächen mit Kollegen, ist unter Studenten schon zu einem “Geheimtip” für Interessierte geworden.
Nicht jedes, aber fast jedes Wintersemester gibt es zudem eine Vorlesung zur “Geschichte der Friedenstheorien in Europa”, deren Durchführung Frau Hofrat Pöllinger obliegt. Hier geht es um philosophische Grundlagen, etwa um Immanuel Kants Schrift “Zum ewigen Frieden”. Aber auch der Beitrag von Internationalen Organisationen zum Frieden in Europa und der Welt wird ausführlich behandelt. Meist ist die Vorlesung mit einer Exkursion zur OSZE in der Wiener Hofburg verknüpft, wo Praktiker kurze Vorträge über ihre Tätigkeit halten. Die Vorlesung ist aus meiner Sicht v.a. aufgrund der geglückten Mischung zwischen Theorie und Praxis zu empfehlen.
Von Fall zu Fall wird noch ein weiterer Lehrauftrag lukriert, viel mehr geht momentan aber nicht. Die Funktionäre des UZF halten aber auch immer wieder Vorträge an anderen Universitäten im In- und Ausland, z.B. am York College in Pennsylvania, USA, mit dem man wissenschaftlich stark kooperiert.
4.3. Die Kongresse
Es gibt in der Praxis hauptsächlich zwei Typen von Kongressen, die vom “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) durchgeführt werden: “Symposien” einerseits sowie “Forschungsgespräche” andererseits.
Symposien sind aufwendig vorbereitet, werden stark angekündigt und man bemüht sich um Internationalität des Publikums. Es gibt zahlreiche Referenten, die jeweils zu einem Teilaspekt eines umfassenden Themas aus dem Bereich Friedens- und Konfliktforschung sprechen. Die Dauer der Symposien ist meist ganztägig. Die “Friedensdialoge” sind spezielle Symposien. Sie folgen den oben bereits besprochenen “Sieben Regeln des Friedensdialoges”, werden mediiert und dienen der Reflexion auf das Gemeinsame und damit der Verständigung verschiedener Weltanschauungen in einem wissenschaftlichen Umfeld.
Forschungsgespräche finden meist im kleineren Rahmen (Wissenschaftlicher Beirat, Lehrveranstaltungen etc.) statt. Man lädt meist nur einen Referenten und ein kleines, ausgesuchtes Publikum ein, v.a. Mitglieder des UZF. Studenten und andere Interessierte dürfen aber natürlich auch kommen. Der Referent spricht ca. ein bis zwei Stunden zu einem Thema aus dem Bereich Friedens- und Konfliktforschung. Es gibt eine Gesprächsleitung, die den Referenten auch z.B. unterbrechen darf, um ihm Zwischenfragen zu stellen oder zu bitten, gewisse Punkte noch näher auszuführen. Auch das Publikum beteiligt sich stark, es wird großer Wert auf Diskussion gelegt. Forschungsgespräche sind sehr reizvoll, weil sie einerseits in die Tiefe gehen, andererseits kein so großer Aufwand für die Organisation notwendig ist. Sie sind auch ein gutes Mittel, um externes Know-How von Praktikern in das UZF einzubringen. Eventuelle Fehler bei den Veranstaltungen von Seiten des Referenten oder der Organisation sind nicht so schlimm wie bei einem Symposium, weil der Rahmen einfach viel kleiner und zwangloser ist. Ich bin der Ansicht, daß man von diesem Instrument häufiger Gebrauch machen sollte, allein wegen der relativ leichten Organisation.
Im Sommersemester 2001, dem Zeitraum meiner empirischen Erhebungen, fanden zwei Kongresse des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) statt, nämlich ein Internationales Symposium über Minderheiten sowie ein Forschungsgespräch gegen den Europäischen Integrationsprozeß. Man sagte mir, daß es sich hinsichtlich der Zahl der Veranstaltungen um kein untypisches Semester handle.
Ich entschloß mich zu einer teilnehmenden Beobachtung an den beiden Veranstaltungen, die mir einen Einblick in die Kommunikation des Universitätszentrums vermitteln sollte. Auf Basis dieser Teilnahme habe ich zwei Berichte verfaßt, die im Anschluß widergegeben werden. Diese Berichte versuchen die Ereignisse und die dort vermittelten Inhalte getreulich widerzugeben, beinhalten aber u.a. auch persönliche Gedanken zum Thema, was im Sinne eines Kommentars erlaubt sein muß.
1. Internationales Symposium über Minderheiten
Bericht über das Internationale Symposium
“Minderheiten: Probleme in Europa und USA” am 21.5.2001
Vorbemerkung
Am 21.Mai 2001 fand im Hörsaal 3 F des Instituts für Philosophie der Universität Wien ein Internationales Symposium über Minderheitenprobleme in Europa und den USA statt. Veranstalter des Symposiums war das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF). Die Verantwortung für die Organisation hatte Frau Hofrat Diplom-Dolmetscher Dr.Sigrid Pöllinger inne, die Generalsekretärin des UZF.
Den Grundgedanken der Veranstaltung erklärte die Verantwortliche in unserem Interview kurz und bündig: “Es wird im zukünftigen Europa wahrscheinlich keinen Krieg mehr geben, der nicht irgendwie mit einer Minderheitenfrage zusammenhängt - sei es nun, daß eine Mehrheit Gewalt gegen eine Minderheit oder umgekehrt eine Minderheit Gewalt gegen eine Mehrheit übt. Daher muß dieses Thema in irgendeiner Form im Rahmen der Friedensforschung behandelt werden.” Diese Erklärung ist unmittelbar einleuchtend, man braucht ihr nichts hinzuzufügen.
Es kann nicht Sinn der vorliegenden Zusammenfassung sein, eine vollständige und lückenlose Darstellung des Symposiums zu geben; es können nur Hauptaussagen grob skizziert werden; manche Auslassungen und Kürzungen aus Platzgründen sind unvermeidlich. Ich bitte dafür um Verständnis und hoffe, daß sich niemand bei Lektüre meiner Darstellung durch meine (rein subjektive) Gewichtung übergangen oder benachteiligt fühlt, noch dazu, wo die Benachteiligung von Minderheiten ein Hauptthema des Symposiums gewesen und jeder Teilnehmer für Diskrimierungen aller Art sensibilisiert worden ist. Es muß folgendes gesagt werden: Die Veranstaltung wird vom UZF publizistisch aufgearbeitet; an einer noch ausführlicheren Gesamtdarstellung Interessierten empfehle ich daher die zum Zeitpunkt der Niederschrift vorliegender Arbeit noch ausstehenden Ausgaben der “Wiener Blätter zur Friedensforschung” ab Nr.108, welche die meisten Vorträge vollständig abdrucken und damit eine umfassendere Dokumentation liefern werden als die vorliegende Arbeit es tun kann.
Ablauf
Der erste Teil des Symposiums widmete sich der Theorie, den allgemeinen Rahmenbedingungen und der Begriffsklärung. Obwohl dies zunächst relativ langweilig klang, entpuppte sich gerade dieser Teil des Symposiums eigentlich als der interessanteste - denn er war aufgrund der guten Präsentation nicht nur sehr anschaulich, sondern aufgrund der Wichtigkeit, sich auf eine gewisse Begrifflichkeit zu einigen, unbedingt notwendig. Dieser erste Teil wurde von den Mitarbeitern des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) bestritten, sicherlich, um bei dieser Gelegenheit den Grundgedanken der Veranstaltung zu erläutern, aber wohl auch, weil gerade hinsichtlich der Kenntnis von Internationalen Organisationen (die aufgrund ihrer Aktivitäten zum Minderheitenschutz eine wesentliche Rahmenbedingung für das Thema liefern) große Kompetenzen im UZF vorhanden sind.
Herr Botschafter Helmut Liedermann, 2.Vorsitzender des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) und ehemaliger KSZE/OSZE-Generalsekretär, machte den Anfang, indem er die Entwicklung der Menschenrechtsidee v.a. in Bezug auf Minderheiten skizzierte. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der KSZE-Schlußakte von Helsinki 1975 zu, die wesentliche Regelungen zu Minderheitenrechten enthält. Wichtig erscheint im Zusammenhang mit Minderheitenschutz v.a., daß in diesem Dokument Menschenrechte von einem bloß angestrebten Fernziel zu einem konkreteren “politischen Prinzip” aufgewertet wurden. Seit der Schlußakte ist es nach der Interpretation des als Experten zum Thema ausgewiesenen Referenten auch nicht mehr möglich, daß unter Berufung auf die staatliche Souveränität die Gewährleistung von Menschenrechten verweigert wird. Die OSZE hat z.B. auch Anfang der 90er ein Dokument in Kopenhagen beschlossen, das ebenfalls Regelungen des Verhaltens gegenüber Minderheiten enthält; auch UNO und Europarat haben Aktivitäten in diese Richtung entfaltet. Schutz der Minderheiten ist ein wichtiges und sinnvolles politisches Instrument zum Abbau ethnischer Spannungen. Bedauerlicherweise ist die Definition des Begriffes “Minderheit” ein Problem; es gibt keine allgemein verbindliche Definition und manche Staaten versuchen sich um den Minderheitenschutz quasi “zu drücken”, indem sie die Existenz von Minderheiten auf ihrem Staatsgebiet schlicht leugnen.
Frau Hofrat Sigrid Pöllinger, Generalsekretärin des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) und Mitglied der österreichischen OSZE-Delegation, knüpfte an diese Ausführungen an und betonte v.a. die Wichtigkeit des Themas. Im Europa zwischen Atlantik und Ural gibt es ca.750 Mio. Einwohner; es gibt um die 40 Staaten, aber ca.70 Völker. Ungefähr 100 Mio. Menschen leben in Europa als Minderheit - man sieht, daß Minderheitsprobleme keineswegs irrelevant sind, was der Begriff “Minderheit” zunächst ja an sich nahelegen würde. Es gibt auch praktisch kein Land in Europa ohne Minderheitenprobleme. Die Referentin betonte, daß Minderheitenschutz praktische Friedensarbeit ist, denn durch dieses Instrument können Minderheiten eingebunden und Konflikte entschärft werden. Diese Entschärfung ist notwendig, weil in Europa viele Kriege aus ethnischen Konflikten erwachsen sind (Balkan, Tschetschenien etc.) und ohne Zweifel noch erwachsen werden. Die OSZE leistet durch ihre Missionen, aber auch durch die Einrichtung des Amtes eines Hochkommissars für Minderheiten, einen wichtigen Beitrag zum Minderheitenschutz. Der Vortrag der Generalsekretärin war fachlich kompetent und zudem auch so anschaulich gehalten, daß er Resonanz in den Medien fand.
Herr Prof.Erich Kaiser, Kassier und damit Vorstandsmitglied des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF), beschäftigte sich v.a. mit Begriffsklärungen und Definitionen zur Minderheitenfrage. Er schickte voraus, daß noch im Mittelalter politische Gebilde auf einer territorialen Basis organisiert waren und die konkrete ethnische Zusammensetzung nicht so entscheidend war; erst in der frühen Neuzeit entstanden Bestrebungen, eine Übereinstimmung zwischen Ethnie und Staatsgebiet zu herzustellen und Nationalstaaten zu schaffen; dann erst wurden Minderheiten zum “Problem”. Minderheiten sind Staatsangehörige mit eigenen ethnischen, sprachlichen und religiösen Eigenschaften, die zahlenmäßig der größten Gruppe des Staatsvolkes unterlegen sind. Eine Ethnie ist gekennzeicht durch drei Elemente: Glauben an eine gemeinsame Herkunft, gemeinsame Kultur und Geschichte sowie gemeinsame aktuelle Erfahrungen. Diskriminierung ist die Benachteiligung einer Ethnie aufgrund bewußter oder unbewußter Vorurteile. Ein Vorurteil liegt vor, wenn einer Gruppe negative und abzulehnende Eigenschaften von vornherein zugesprochen werden. Diese Vorurteile sind aber nicht gerechtfertigt, denn Minderheiten stellen nach dem Urteil des Referenten und zweifellos auch des UZF in seiner Gesamtheit keine Bedrohung der Mehrheit, sondern eine Bereicherung der Kultur eines Staates dar. Assimilation, also vollständige Übernahme der Kultur einer Mehrheit durch eine Minderheit unter Aufgabe des eigenen Kultutgutes empfiehlt sich aus diesem Grunde eben nicht, sondern vielmehr wirkliche Integration, die eher von einem gemeinsamen Miteinander gekennzeichnet ist.
Darauf folgte der “österreichische” Teil des Symposiums, wo es v.a. um die Frage ging, wie es um die Situation der Minderheiten hierzulande bestellt ist. Zuerst sprach Herr Mag.Stephan Leitner, der in der Volksgruppenabteilung des Bundeskanzleramtes tätig ist, zum Volksgruppenschutz in Österreich.
Volksgruppen sind Minderheiten, deren Aufenthalt in Österreich schon sehr lange nachweisbar ist; in der Verwaltungspraxis geht man von ca. 100 Jahren aus. Beispiele für Volksgruppen in Österreich sind Slowenen (etwa in Kärnten), Roma (etwa im Burgenland) etc. Negative Tendenzen (z.B. Abwanderungsdruck in Ballungszentren) gefährden die Volksgruppen einerseits in ihrem Bestand und Zusammenhalt, andererseits gibt es auch positive Tendenzen, die sich zugunsten ihrer Sprache und Kultur auswirken (z.B., daß seit dem Fall des Eisernen Vorhanges ihre Sprachen teilweise wieder gefragter sind). Der rechtliche Schutz der Volksgruppen in Österreich ist im internationalen Vergleich hervorragend, was auch der unlängst zu uns entsandte “EU-Weisenrat” feststellte. Im Prinzip erfolgt der Schutz über einige Instrumente: Minderheitenschulwesen (zweisprachiger Unterricht in den Volksschulen), Amtssprachenregelungen (eigene Sprache kann bei einem Anteil von 10% der Gemeindebevölkerung vor Behörden gebraucht werden; hat aber kaum Bedeutung, weil meistens genügend Deutschkenntnisse vorhanden sind), zweisprachige Ortsschilder (stellen ein Signal an die Allgemeinheit dar, sind im politischen Diskurs in Österreich leider seit jeher umstritten), Volksgruppenförderung (pro Jahr gibt das BKA ca. 3,6 Mio. Euro zur Förderung der Volksgruppen und ihrer Kultur aus) sowie Volksgruppenbeiräte (wird eine Minderheit als Volksgruppe anerkannt, darf sie solche Vertretungsgremien einrichten, die dann im engen Kontakt mit den Behörden stehen).
Herr Dr.Franci Zwitter vom Ludwig Boltzmann-Institut für neuere österreichische Geistesgeschichte referierte anschließend zur Situation der Slowenen in Österreich. Trotz des international vorbildlichen rechtlichen Schutzes der Minderheiten in Österreich, auf den er in der anschließenden Diskussion auch besonders hingewiesen wurde, meinte der Referent, daß die faktische Lage der Slowenen dennoch problematisch und schwierig sei. Er beklagte v.a. das Verhalten des Kärntner Landeshauptmannes Dr.Jörg Haider, der ständig von einer drohenden “Slowenisierung Kärntens” spricht. Diese Befürchtung ist aber völlig unbegründet; eher besteht die Gefahr, daß die Slowenen in Kärnten den Anschluß an ihre kulturelle Tradition verlieren. Es ist auch keineswegs so, daß die Slowenen in Kärnten kein Deutsch sprechen würden; praktisch jeder spricht gut Deutsch. Aber nebenher, meinte der Referent, sollte doch die slowenische Sprache auch weitergepflegt werden. Ich persönlich denke, daß dem Referenten hier zuzustimmen ist; Menschen, die zweisprachig aufwachsen, können sich für eine Gemeinschaft als sehr wertvoll erweisen, besitzen sie dann doch eine besondere Fremdsprachenkompetenz, die z.B. in der Wirtschaft oder Diplomatie durchaus Anwendung finden kann. Daß Minderheiten nicht von Haus aus eine Bedrohung der Integrität eines Staates darstellen, kann man meiner Meinung nach überhaupt an den Kärtner Slowenen deutlich illustrieren, die sich in einer Volksabstimmung schon einmal, zu Beginn der 1.Republik, mit überwältigender Mehrheit für den Verbleib bei Österreich und gegen einen Anschluß an Slowenien bzw. Jugoslawien ausgesprochen haben. Der Referent wirkte auf mich durchaus positiv, weil er sowohl ein Plädoyer gegen die häufigen Vorurteile der Mehrheit gegen die Minderheit der Slowenen hielt, aber auch gegen einzelne Gruppen auftrat, die (auch als Antwort darauf) einen slowenischen Nationalismus predigen; er vertrat die Meinung, die Slowenen sollten ihr Kulturgut pflegen und ansonsten zu einem guten Verhältnis zur Mehrheit gelangen, das aber nicht so aussehen kann, daß die slowenische Volksgruppe auf ihre grundlegenden Rechte verzichtet oder darauf, diese auch zur Not einklagen zu können. Eine eigene slowenische Partei lehnte Dr.Zwitter ab, stattdessen plädierte er für eine Integration von Slowenen in alle Parteien - auch in die FPÖ, mit der sich das Verhältnis aber insgesamt eben schwierig gestaltet. Letztere Schwierigkeiten können, wie im Abstand von einigen Monaten zum Referat bemerkt werden muß, auch durch die jüngste mediale Eskalation des Ortstafelkonfliktes verdeutlicht werden.
Darauf folgte ein Referat über “Roma in Österreich” von Frau Mag.Mirjam Karoly, die für das “Romano Centro” arbeitet, einen Roma-Interessensverband. In Österreich, sagte sie, gibt es ca. 25.000 Roma, ein großer Teil besitzt die Staatsbürgerschaft; es gibt autochthone Gruppen (z.B. im Burgenland), viele sind aber in den 60ern zugewandert. Während der NS-Zeit waren sie verfolgt, noch heute gibt es (laut Umfragen) Vorurteile der Mehrheit und (laut Erfahrungen aus der Praxis) auch faktische Diskriminierungen. Ein großes Problem der Roma ist das niedrige Bildungsniveau; es gibt bei den Roma, so die Referentin, “keine intellektuelle Elite”. 1989 wurde der erste Roma-Verein gegründet, 1993 wurden die Roma als Volksgruppe anerkannt, was gewisse Rechte und Förderungen nach sich zieht. Es gibt einen Volksgruppenbeirat und die Roma erhalten pro Jahr auch ca.220.000 Euro Förderung vom Staat. Zweisprachige Ortstafeln und ein zweisprachiges Schulwesen gibt es nicht, allerdings ein gewisses “sprachliches revival” bei der Jugend. Ein großer Rückschlag für die Roma in Österreich war das Bombenattentat in Oberwart vor einigen Jahren. Es gibt, so die Referentin, bei den Roma viele unterschiedliche Gruppen, aber eine Sprache und Kultur, allgemein seien die Roma eine Schicksalsgemeinschaft.
Was das Publikum sehr positiv ansprach, war zweifellos das große Engagement, mit dem die Referentin sich ihrer Aufgabe, nämlich der Interessenvertretung der stark benachteiligten Gruppe der Roma annahm; sie wirkte - nach meinem Eindruck - überhaupt äußerst sympathisch, was auch daran lag, daß sie nicht nur besonders gut redete, sondern auch besonders gut aussah.
Dennoch war ich persönlich mit dem “Endresultat” nicht vollauf zufrieden, weil einiges meiner Ansicht nach in der kurzen Zeit nicht ausreichend geklärt werden konnte. Im Laufe des Referates wurde z.B. klar, daß sowohl die Roma, als auch die Sinti jeweils ihre eigenen Interessenvertretungen haben, die sich füreinander nicht unbedingt zuständig fühlen. Das wirft natürlich Fragen auf: Könnte eine gewisse Rivalität zwischen beiden Gruppen vorliegen - trotz “offiziell” sicherlich anderslautender Beteuerungen? Denn wenn man die gleichen Interessen hat, warum braucht man dann verschiedene Interessensvertretungen? Könnte es nicht überhaupt so sein, daß neben Roma und Sinti vielleicht noch andere Gruppen unter den vormals “Zigeuner” genannten Menschen existieren - heute sollte man diesen negativ besetzten Begriff eigentlich nicht mehr verwenden -, welche gegen die beiden “großen” Gruppen vielleicht gar nicht aufkommen? Es wäre ratsam, dieses Problem bei geplanten Fortsetzungen des Symposiums näher zu durchleuchten, indem man auch einmal Sinti-Vertreter oder, wenn es sie gibt, auch andere Gruppen einlädt und um ihre Meinung fragt.
Die Referentin stellte fest, daß es verschiedene Gruppen innerhalb des Stammes der Roma gäbe, aber die Roma auf jeden Fall eine “Schicksalsgemeinschaft” seien. Es wäre interessant, Recherchen zu der Frage bei einer anderen Quelle zu betreiben, wie groß die entsprechenden Uneinigkeiten tatsächlich sind. Vielleicht käme man nach weiterer Forschung dahinter, daß die Roma in viele Clans gespalten auftreten, die ihrerseits wiederum auf nicht unbeträchtliche Weise miteinander rivalisieren. Gibt es eine solche Rivalität? Wie werden Konflikte untereinander eigentlich ausgetragen?
Außerdem stellten sich mir persönlich auch einige weitere Fragen, die in dem doch eher die “positiven” Seiten beleuchtenden Referat nicht befriedigend beantwortet werden konnten: Sind Stammesgesellschaften - und eine solche liegt beim “Stamm der Roma” (so nannte die Referentin die von ihr vertretene Volksgruppe) doch wohl vor - aus der Perspektive einer modernen Demokratie nicht auch in gewisser Weise kritikwürdig? Wie werden Frauen in solchen Gesellschaften behandelt - und zwar wirklich, nicht nur in der schönfärbenden Version? Welche Werte werden innerhalb der Stämme transportiert? Ich weiß z.B. von kretischen Clans (ich meine jetzt griechisch-stämmige Einheimische, nicht Roma), daß dort noch heute Blutrache praktiziert wird, daß die Frauen relativ geringe Entfaltungsmöglichkeiten und dafür die “alten Herren” im Prinzip unwidersprochen das Sagen haben; auch unter Kosovo-Albanern existieren solche aus anachronistischen Ehrbegriffen entsprungene Verhaltensmuster. Gibt es ähnliche Vorstellungen z.B. noch bei den Roma, die ja wie gesagt auch eine Stammesgesellschaft sind? Wenn ja, sind diese noch zeitgemäß oder bewahrenswert? Welche Aspekte einer Minderheitenkultur sind überhaupt bewahrenswert - und welche nicht? Und ist es, bei aller “politischen Korrektheit”, nicht irgendwie etwas anachronistisch, daß es überhaupt noch so etwas wie “Stämme” in einer modernen Demokratie gibt? Ich z.B. bin lediglich Bürger der Republik Österreich und der Europäischen Union; aber ich fühle mich hinsichtlich meiner politischen Loyalität sicherlich keinem “Stamm” zugehörig - schon gar keinem germanischen und übrigens auch keinem anderen.
Nach meinem von Karl Popper geprägten Demokratieverständnis ist dies auch ein Ideal, denn politische Loyalitäten sollten demnach von in Verfassungen gegossenen Wertsystemen abhängig sein und ausdrücklich nicht von ethnischen Verwandtschaftsverhältnissen! Beinhaltet der “ethnische Boom” in den heutigen westlichen Demokratien, der v.a. in der Betonung der Bedeutung der Minderheiten liegt (bei all seiner Berechtigung wegen des Kampfes gegen sicherlich ebenfalls undemokratische Diskriminierungen), nicht auch teilweise bedenkliche Aspekte - v.a. wegen des ihm innewohnenden wenig “aufgeklärten”, sondern fast schon “archaischen” Konzepts von Politik?
Man soll sich - bei allem Respekt vor stark benachteiligten Menschen - nicht scheuen, auch kritische Fragen zu stellen. Kritik ist nicht automatisch Rassismus! Dabei muß man natürlich immer auf dem Boden der Wissenschaft bleiben; man wird sich auch vor einer Abgleitung in Klischees hüten und Rücksicht auf Gefühle von Minderheiten nehmen müssen. Diese Rücksicht darf allerdings nicht dazu führen, daß man nicht mehr wirklich kritisch denkt und forscht. Alles in allem hat das Referat über die Roma zwar einen sehr guten Eindruck hinterlassen, aber es war im Endeffekt doch eher eine “offizielle” Darstellung der Situation durch eine Roma-Interessensvertreterin.
Nach dem “österreichischen” begann der ebenfalls lang erwartete “internationale” Teil des Symposiums: Herr Prof.Gary Bittner, Vorstandsmitglied des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF), referierte über die Situation der Minderheiten in seinem Heimatland, den USA, die ein multiethnisches Land sind. Auf sehr lebendige und anschauliche Art stellte er die allgemeine Situation dar: Die Wurzeln der USA liegen eigentlich in Europa, und noch heute sind ca. 2/3, also die überwiegende Mehrheit der Amerikaner, “weiße Europäer”, wovon es wiederum einen traditionell “privilegierten”, einstmals als “Ideal” geltenden Menschentypus gibt, nämlich die WASPs (white anglo-saxon protestants). Mittlerweile verändert sich das Bild insoferne, daß die Einwanderung von Menschen aus nicht-europäischen Ländern das Gesamtbild verschiebt und bereits verschoben hat. Zu den schon länger in den USA ansässigen nicht-europäischen Minderheiten (z.B. Indianer, welche die eigentlichen Ureinwohner sind oder Schwarze, die von früheren Sklaven abstammen) gesellen sich neue Minderheiten hinzu, wobei v.a. Hispanics Bedeutung haben, also Spanisch sprechende Menschen z.B. aus Jamaica. Auch Chinesen sind wichtig; diese scheinen es überhaupt zu bevorzugen, in ihren eigenen Vierteln zu leben und “unter sich” zu bleiben. Viele der Minderheiten verweigern die Assimilation und betonen den Wert ihrer nicht-europäischen Kultur gegenüber der “weißen” Mehrheit; auch die nicht-weißen Minderheiten haben miteinander viele Konflikte. Es zeigen sich also starke Tendenzen zu einer Art Ethnozentrismus. Die, wenn man so will, “philosophische” Frage, die sich in diesem Zusammenhang in den USA stellt, ist jene nach dem Spannungsfeld zwischen erwünschter Freiheit, die immer auch Pluralität bedeutet, und notwendiger Einheit, die es geben muß, damit ein Land zusammenhält und sich nicht in kleinlichen ethnischen Streitigkeiten selbst zerfleischt. Wie dieses Spannungsfeld aufgelöst wird, ist gegenwärtig die große Frage; wüßte man eine eindeutige Antwort, dann wäre alles klar.
Der danach vorgesehene Vortrag von Herrn Prof.Leo Fretz, Vorstandsmitglied des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) über “Minderheiten in den Niederlanden” mußte krankheitshalber leider ausfallen.
Tief beeindruckt hat mich persönlich der anschließende Vortrag des kurdischen Referenten Herrn Hüseyin Karabulut, v.a. seine eigene Lebensgeschichte, die er an den Anfang setzte. Eigentlich war der junge Mann Student der Kunstgeschichte an der Universität Istanbul gewesen und hatte sich für die Rechte des kurdischen Volkes engagiert - nicht gewaltsam, denn Gewalt lehnte er immer ab, was er auch im persönlichen Gespräch mit mir glaubhaft versicherte. Er sprach übrigens hervorragend Deutsch und machte einen äußerst gepflegten Eindruck. Sein einziges “Verbrechen” bestand damals darin, daß er nicht einsehen wollte, daß die Kurden in der Türkei nicht z.B. ihre eigenen Sprache verwenden dürfen.
Nach kritischen Äußerungen verbot man ihm die Beendigung seines Studiums und sperrte ihn ins Gefängnis, heute lebt er - im Prinzip aus seiner Heimat verbannt - in Österreich. Sein Vortrag prangerte v.a. eine empörende Tatsache an, nämlich die, daß die Existenz des kurdischen Volkes, das in Wahrheit ein schon in der Antike nachweisbares Kulturvolk ist, von der türkischen Obrigkeit einfach dreist geleugnet wird. Dieses Problem zog sich überhaupt wie ein roter Faden durch das ganze Symposium: In der Forderung, daß man Minderheiten zu schützen hat, sind sich alle Staaten einig, hier besteht perfekte Harmonie, kein Mißklang stört das Konzert der Staatengemeinschaft. Aber jene Staaten, die Minderheiten haben, leugnen oftmals einfach, daß auf ihrem Staatsgebiet Minderheiten existieren; daraus leiten sie die Rechtfertigung ab, keine Schutzmaßnahmen einführen zu müssen. Die Kurden nennt man in der Türkei nur “Bergtürken”.
Das Empörende an solchem Leugnen ist meiner Meinung nach die damit verbundene Unaufrichtigkeit; denn die entsprechenden Obrigkeiten wissen wohl, daß die “geleugneten” Völker existieren. Und diese Vorgehensweise ist - aus meiner Perspektive - eine gewisse Vorstufe zum Genozid. Durch die Leugnung der Existenz eines Volkes wird ihm die Existenzberechtigung “in der sprachlichen Welt” abgesprochen; der Schritt zum Absprechen der Existenzberechtigung “in der wirklichen Welt” scheint mir klein.
Momentan gibt es aber wenig Hoffnung für die Kurden, die ein von der Geschichte offenbar vergessenes und um ihren eigenen Staat betrogenes Volk sind, obwohl dieses Volk nach realistischen Schätzungen 20-30 Mio. Menschen zählt. Insbesonders die Verhaftung des Kurdenführers Öcalan hat die Situation nach Angabe des Referenten im anschließenden Gespräch mit mir sehr verschlimmert; die Chancen für Widerstand sind geringer denn je. Wir sprachen auch darüber, daß die Ansicht, die Durchsetzung von Menschenrechten gehe vor der Souveränität und dem Prinzip der Nicht-Einmischung, offenbar nur für Nicht-NATO-Mitglieder wie Serbien gilt; in die inneren Angelegenheiten des NATO-Mitgliedes Türkei wagt sich allerdings keiner wirklich einzumischen - Humanitäre Interventionen beruhen also, wie man in diesem Fall deutlich sieht, auf einer doppelten Moral.
Nach diesem menschlichen Höhepunkt gab es noch ein unerfreuliches Nachspiel.
Das Referat trug den Titel “Sprachliche Minderheiten in Spanien und Frankreich”. Dieser brisanteste aller Vorträge wurde zurecht als eine Art Höhepunkt an den Schluß gesetzt. Das Publikum harrte aus, gespannt, trotz einer gewissen Ermüdung, die sich selbst beim interessantesten Kongreß im Laufe eines ganzen Tages einstellt, in dem ein volles wissenschaftliches Programm durchgenommen wird. Dieser Wille zum Durchhalten wird verständlich, wenn man sich vor Augen hält, daß es im Prinzip eine ganz bestimmte sprachliche Minderheit gibt, die sowohl in Frankreich, als auch in Spanien lebt, mit der wirklich große Probleme vorhanden sind - die Basken. Gerade zum Zeitpunkt des Symposiums war die Gewalt in Spanien wieder eskaliert; alle wollten nun eine fundierte Analyse im Sinne der Friedens- und Konfliktforschung über das Baskenproblem hören, wie es dem Rahmen der Veranstaltung angemessen gewesen wäre.
Jeder möge angesichts der Vorgangsweise des Referenten Herrn Prof.Peter Cichon vom Institut für Romanistik der Universität Wien selbst beurteilen, ob er dem Thema gerecht wurde oder nicht. Er projizierte eine linguistische Karte Frankreichs (per Overhead), welche die neben dem Französischen traditionell existierenden Sprachen zeigte.
Besonders lange hielt er sich mit der Besprechung des Okzitanischen auf, das v.a. im Süden Frankreichs Verbreitung findet. Er begann, die Sprachgeschichte des Okzitanischen auseinanderzusetzen und das französische Schul- und Universitätssystem in Hinblick auf seine Berücksichtigung v.a. dieser Sprache darzustellen. Langsam näherte sich seine Vortragszeit dem Ende zu. Das Publikum war schon äußerst ungeduldig, denn die Basken waren zu diesem Zeitpunkt nämlich erst einmal in einem Nebensatz erwähnt worden.
Es war richtig und notwendig, daß die Generalsekretärin des UZF den Referenten mehrmals ausdrücklich aufforderte, doch nun endlich zum Baskenproblem Stellung zu nehmen, was er zuerst auf später verschob, um es dann am Schluß seiner Ausführungen widerstrebend in ein paar Sätzen zu tun, die so unverfänglich wie nur irgendmöglich waren; dann beendete er seinen Vortrag. Ich empfand Prof.Cichons Verhalten persönlich als Frechheit.
Das UZF ging hier meiner Meinung nach mit seinen Ermahnungen richtig vor; aber ich verstehe nicht, warum einige der externen Referenten und insbesonders dieser eigentlich so dermaßen feige waren. Ein Professor der Romanistik, der das Thema “Sprachliche Minderheiten in Spanien und Frankreich” wählt, muß zum Baskenproblem Stellung nehmen; und da er ohne Zweifel die fachliche Kompetenz besitzt, es zu tun (er kann wohl nicht Romanistik-Professor sein mit dem Spezialgebiet sprachliche Minderheiten, ohne sich zu diesem Thema eine Meinung gebildet zu haben), kann seine Verweigerung einer Stellungnahme nur am mangelndem Willen gelegen haben; wahrscheinlich hatte er Angst davor, Flagge zu zeigen.
Wer sich zu einem brennend aktuellen Problem in einem Vortrag zum Thema nicht äußern will, der soll meiner Meinung nach die Konsequenzen ziehen und gleich ganz daheim bleiben. Aber er soll nicht das Publikum “sekkieren” durch Anlockung durch den verheißungsvollen Titel “Sprachliche Minderheiten in Frankreich und Spanien” (im Rahmen eines Kongresses über Minderheitenprobleme, veranstaltet von einem universitären Friedens- und Konfliktforschungszentrum), um danach lang und breit über die okzitanische Sprachgeschichte zu referieren, die wirklich niemanden interessiert, während er so tut, als würde es keine Basken geben.
Soweit kommt es noch, daß man den Terrorismus der ETA nicht öffentlich als das bezeichnet, was er ist, nämlich als ungerechten und empörenden Akt der Barbarei, der nicht auf Unterdrückung zurückzuführen ist (Das Baskenland hat in Spanien eine großzügige Autonomieregelung und die Mehrheit seiner Bevölkerung steht zur Einheit des spanischen Staates, worauf auch die jüngsten Wahlergebnisse hinweisen! Das unterscheidet die Situation der Basken auch grundlegend von jener der Kurden). Es wäre schlimm, wenn all jene, die den Frieden lieben, vor der Gewalt kapitulieren und ihre intellektuelle Redlichkeit aufgeben, indem sie sich weigern, die Dinge beim Namen zu nennen.
Abschließende Kritik
Mein persönlicher Eindruck war, daß die Organisation des Symposiums eine sehr arbeitsaufwendige, gründliche und engagierte gewesen sein muß - und ohne jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet des Kongreßmanagements wohl kaum in dieser Form möglich. Die Veranstaltungskompetenz des UZF im allgemeinen und speziell der Generalsekretärin zeigte sich deutlich; ich habe aber auch nichts anderes erwartet von jener Dame, die jahrelang für die Organisation des oben dargestellten “Friedensdialoges zwischen Christen und Marxisten” verantwortlich gewesen ist. Daß der Kongreß relevanten Niederschlag in der Berichterstattung einer großen österreichischen Tageszeitung fand, zeigt, daß sich die Medien für das Thema prinzipiell interessieren, was meiner Ansicht nach u.a. auf die brennende Aktualität der Minderheitenprobleme zurückzuführen ist. Man sollte sich daher aus P.R.-Sicht auf jeden Fall weiter und noch intensiver mit diesem Thema befassen.
Gerade im ersten Block ist es den UZF-Mitarbeitern gelungen, mit vereinten Kräften einige prinzipielle und zweifellos vorher genau überlegte “messages” ihrer Organisation dem Publikum anschaulich zu vermitteln; eine solche vorherige Festlegung der hinter der taktischen Kommunikationsmaßnahme stehende Strategie bzw. der im Namen der Organisation zu vermittelnden vier oder fünf Hauptaussagen, sollte Vorbildcharakter für die Zukunft haben.
Die externen Referenten waren in der Regel hochrangig, fachlich fundiert und haben klar und eindeutig im Sinne ihrer Werte Stellung bezogen, sieht man von der letzten Enttäuschung ab; aber da kann das UZF wenig dafür, solche unerfreulichen Dinge passieren eben. Es gab wirkliche Höhepunkte, z.B. das Roma- und das Kurdenreferat, die das Symposium zu einem positiven wissenschaftlichen Erlebnis für mich und nach meinem Eindruck auch für alle anderen machten.
Gelungen ist aus meiner Perspektive insgesamt die Mischung zwischen Theorie und Praxis sowie zwischen Österreich-Bezug und Internationalität. Es konnte eine große Menge an Information anschaulich und verständlich transportiert werden; und trotz der ganztägigen Dauer fand ich die Veranstaltung persönlich spannend und aufschlußreich. Sie war geeignet, für ein nicht unbeträchtliches Problem der Gegenwart zu sensibilisieren, nämlich für den Anstieg der potentiell und tatsächlich gewaltsam ausgetragenen Konflikte zwischen Mehrheiten und Minderheiten in den europäischen Staaten.
Als Kritikpunkt, der allerdings den positiven Gesamteindruck genausowenig trüben kann wie alle im obigen Text genannten, möchte ich jedoch anführen, daß v.a in den Referatsblöcken über Österreich die autochthonen Volksgruppen, also z.B. Slowenen, Roma u.a. sehr stark, die Einwanderungsminderheiten aber überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Die wahren ethnischen Konflikte hierzulande gibt es aber meiner Ansicht nach nicht mit den seit über hundert Jahren ansässigen Minderheiten, sondern eben mit den vor nicht allzu langer Zeit eingewanderten - der bereits genannte Streit rund um den Abriß der “Trauner Moschee” möge hier wiederum als Beispiel dienen. Scheuten sich die Referenten hier wiederum, ein “heißes Eisen” anzupacken (z.B. die islamische Minderheit in Österreich)? Es ging nach meinem Eindruck ein leichtes Murren durch das fachlich nicht unbewanderte Publikum, als z.B. der Referent aus dem Bundeskanzleramt meinte, er interessiere sich nicht für Einwanderungsminderheiten, sondern nur für die hier schon lange ansässigen Volksgruppen, begründet mit einem wohl nur Verwaltungsbeamten einleuchtenden Hinweis, das andere fiele nicht in seinen Kompetenzbereich.
Ich bin aber zuversichtlich, daß man bei den geplanten Fortsetzungen des Symposiums (und zudem im Rahmen des gegenwärtigen Buchprojektes der Generalsekretärin über Minderheiten) auch gebührend auf die Chancen und Probleme des multikulturellen Zusammenlebens mit Einwanderungsminderheiten eingeht - nicht zuletzt deshalb, weil sich die Verantwortlichen als Experten ohne Zweifel darüber bewußt sind, daß man nur so langfristig dem Thema, nämlich der Behandlung von Minderheitenproblemen in Österreich aus der Sicht der Friedens- und Konfliktforschung, fachlich gerecht werden kann. Da sie dies wissen, werden sie noch stärkere Mahner sein und noch beharrlicher intellektuelle Redlichkeit einfordern - und darüberhinaus den Mut, auch heikle Themen nicht einfach auszusparen, sondern gerade bei der Behandlung dieser Fragen für den Frieden und die Menschlichkeit eindeutig Stellung zu beziehen!
2. Forschungsgespräch gegen den Europäischen Integrationsprozeß
Bericht über das Forschungsgespräch mit Prof.Dr.Erwin Weissel zum Thema “Integration versus Desintegration in Europa aus der Sicht der politischen Ökonomie” am 23.4.2001
Vorbemerkung
Am 23.April 2001 fand im Arbeitsgruppenraum 1 des Instituts für Philosophie der Universität Wien ein Forschungsgespräch mit Herrn Prof.Dr.Erwin Weissel statt. Weissel ist politischer Ökonom und außerordentlicher Universitätsprofessor für Wirtschaftswissenschaft im Ruhestand; er hat in früheren Jahren u.a. ein Lehrbuch für Volkswirtschaft geschrieben; unlängst ist er durch sein Buch “EUphemismus” als EU-Kritiker aufgefallen. Weissels Vortrag trug den Titel “Integration versus Desintegration in Europa aus der Sicht der politischen Ökonomie”.
Die Themenwahl erklärt sich folgendermaßen: Wir beobachten heute in Westeuropa Integrations- und am Balkan Zerfallsprozesse, worauf z.B. das jüngste Wahlergebnis in Montenegro (wo die Separatisten massive Zugewinne verzeichnen konnten) hindeutet. Und auch innerhalb der EU, die europäische Integrationsbemühungen repräsentiert, gibt es möglicherweise Zerfallsprobleme, z.B. im Baskenland, auf Korsika oder in Belgien. Europa ist also durch diese verschiedenen Vereinigungs- und Zerfallsphänomene geprägt und es macht unbedingt Sinn, diese Prozesse im Rahmen der verschiedenen Wissenschaften, auch der politischen Ökonomie, zu durchleuchten.
Veranstalter des Forschungsgespräches war das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) im Rahmen der “Arbeitsgemeinschaft Friedensforschung”. Die Gesprächsleitung hatte Herr Prof.Dr.Erwin Bader inne, der 1.Vorsitzende des UZF.
Der Beitrag der politischen Ökonomie zur Analyse gesellschaftlicher Probleme
Es gibt viele gesellschaftliche Probleme, die entweder objektiv ökonomische Probleme sind oder zumindest als solche interpretiert werden können. Ohne die Wirtschaftswissenschaft kann man manche Facetten der Gesellschaft nicht erklären; die ökonomische Perspektive ist oft unverzichtbar. Vielfach kann die politische Ökonomie auch einen Beitrag zu einer umfassenden interdisziplinären Sichtweise eines Problems leisten. Politische Ökonomie hat nach Weissel v.a. gegenüber der Rechtswissenschaft den Vorteil, daß sie mit exakten empirisch-mathematischen Methoden operiert und dadurch Denkfehler und falsche Annahmen enttarnen kann. Politische Ökonomie hat seiner Meinung nach aber auch die möglicherweise nachteilige Eigenschaft, “amoralische” Standpunkte einzubringen. Z.B. gab es unlängst einen Streit großer Pharmakonzerne mit Südafrika, ob der besagte Staat billige Medikamentenkopien unter Verstoß des Patentrechtes importieren dürfe, um seinen AIDS-Kranken zu helfen. Jeder Mensch würde wahrscheinlich aus moralischen Gründen die südafrikanische Position unterstützen, die politische Ökonomie würde aber wahrscheinlich feststellen, daß durch Umgehung des Patentrechtes die Preise für Medikamente auf dem Weltmarkt gedrückt würden und es wohl die logische Folgehandlung der Großkonzerne wäre, mehr Geld z.B. bei Arbeitsplätzen oder auf dem Gebiet der Forschung einzusparen. Diese Kritik mag grausam erscheinen (wie kann man sich dem Leid so vieler Menschen verschließen und solche Gegenargumente formulieren?). Aus Sichtweise der politischen Ökonomie ist dieser Kritikpunkt aber zutreffend.
Weissel ging als politischer Ökonom von einem sehr schlechten Menschenbild aus und bekannte sich auch dazu. Man müsse aus Sicht des politischen Ökonomen zumindest damit kalkulieren, meinte er, daß jeder nach rein egoistischen Gründen im Sinne seiner Gewinnmaximierung handelt - und selbst, wenn er es dann faktisch nicht tun sollte, täte man schlecht daran, dies nicht ständig zu erwarten. Es stellt sich die Frage, ob die Annahme von der radikalen Schlechtigkeit des Menschen wirklich so wissenschaftlich-realistisch oder nicht eine simple und nicht unbedingt sympathische Ideologie ist, die mit der Realität genausoviel oder genausowenig zu tun hat wie die sicherlich ebenso unzutreffende radikale Annahme, daß die Menschen keinen anderen Gedanken hätten, als sich bedingungslos für andere aufzuopfern.
Was ist Integration?
Integration ist nach Weissel ein (zumindest im Falle der EU-Staaten) ständig wachsendes Netzwerk an Vereinbarungen bzw. Verträgen zwischen Staaten. Diese Vereinbarungen können bi- oder multilateral sein. Das Wachsen wird bedingt durch die immer größere Teilnehmerzahl einerseits und die Zunahme an Regelungen andererseits. Es geht in diesen Vereinbarungen entweder um den Umgang der Staaten miteinander oder den Umgang mit Dritten. Desintegration ist der gegenteilige Prozeß, also die Zerreißung solcher Netzwerke. Integration kann von oben (TOP-DOWN-Prozeß) oder von unten (BOTTOM-UP-Prozeß) ausgehen. Im Europäischen Integrationsprozeß sind historisch beide Elemente vorhanden.
Weissels EU-Kritik
Prof.Weissel verwendete nach diesen eher “trockenen” Einleitungen den Hauptteil seines restlichen Vortrages damit, seine Ablehnung zur Europäischen Union zu begründen und legte so richtig los; mein subjektiver Eindruck war, daß lang Aufgestautes aus ihm hervorbrach.
Er wies zunächst u.a. darauf hin, daß man “Europa” nicht mit der “EU” verwechseln dürfe, genausowenig wie “Amerika” mit den “USA”, womit er, muß man sagen, recht hat. Es ist wirklich diskussionswürdig, ob die OSZE mit ihrem offeneren Ansatz eines Europa von “Vancouver bis Wladiwostock”, wie es in ihrem Selbstverständnis heißt, nicht der EU in dieser Hinsicht überlegen ist (die OSZE bindet z.B. auch die USA, Kanada, Rußland und die Kaukasus-Staaten in den europäischen Sicherheitsdialog mit ein, daher die auf den ersten Blick etwas befremdliche Formulierung des Selbstverständnisses).
Andererseits ist die OSZE eben nur ein sehr loses Bündnis, das einen weitaus geringeren Grad an Integration aufweist, was Weissel, obwohl er sich zur OSZE nicht äußerte, wahrscheinlich bevorzugen würde. Weissel nahm zu der Beobachtung Stellung, daß wir seit ca. 50 Jahren sowohl Frieden in Europa, als auch einen europäischen Einigungsprozeß haben. Dies sei rein methodisch gedacht noch kein Beweis dafür, daß die EU den Frieden zwischen den Staaten sichert (denn Korrelation ist nicht gleich Kausalität); vielmehr könnte es auch so sein, daß der Friede zwischen den europäischen Staaten, der aus irgendwelchen anderen Gründen entstanden ist, den Bestand der EU sichert. Daß vorher die heutigen EU-Länder jahrhundertelang ständig Krieg hatten und seit dem Entstehen der Europäischen Integration (und damit einer den Nationalstaaten doch in einigen Gebieten übergeordneten Macht) plötzlich nicht mehr, kam Weissel keineswegs komisch vor. Er erklärte dies durch die spezifisch historischen Umstände z.B. des Kalten Krieges, durch die NATO etc. Weissels Ansicht ist natürlich mindestens ebensowenig beweisbar wie die von ihm kritisierte.
Die Europäische Union ist für Weissel ein Projekt gegen die Globalisierung, mit dem Ziel, sich von dieser “abzukapseln”. Dieses Ziel sei anhand von Aussagen “führender Funktionäre” dokumentiert - leider sagte er nicht, wer diese Funktionäre seien, sodaß es dem Publikum unmöglich war, festzustellen, ob Weissels Argument zutreffend oder eine Art Weltverschwörungstheorie ist. Dieses Ziel der Abschottung, meinte Weissel, könne aber aufgrund wirtschaftlicher Druckmechanismen niemals gelingen, womit er sicherlich recht hat - wenn dies wirklich das angestrebte Ziel der EU sein sollte. Weissel sollte seine Ansicht auf jeden Fall den Globalisierungsgegnern mitteilen, die dann wohl in Hinkunft die Staats- und Regierungschefs der EU bejubeln werden, anstatt, wie jüngst im durch ihre Demonstrationen verwüsteten Genua, lautstark gegen sie Stellung zu beziehen und dabei eine ganze Region in den militärischen Ausnahmezustand zu versetzen. Ich persönlich halte die EU im Gegensatz zu Weissel eher für eine Antwort auf das zunehmende Versagen der Nationalstaaten in Zeiten der Globalisierung und insoferne als Eingehen auf diesen “Trend” durch zunehmende internationale Vernetzung und Kooperation auf immer mehr Gebieten; Isolationswünsche aller Art scheinen mir hingegen tendentiell eher auf der nationalstaatlichen Ebene zu liegen.
Auch eine Stärkung Europas durch Vereinigung kann Weissel nicht erkennen. Es macht seiner Meinung nach keinen Unterschied, ob sich Europa vereint oder nicht. Mit anderen Worten: Ob der Welt also z.B. eine EU mit 400 Mio. Einwohnern gegenübersteht oder viele Kleinstaaten zwischen 250.000 und 80 Mio. Einwohnern ist seiner Meinung nach angeblich bedeutungslos! Er begründet diese etwas seltsam erscheinende Ansicht mit dem Hinweis darauf, daß die USA trotz europäischer Einigung eine übermächtige Position einnehmen. Die EU könne den U.S.-Amerikanern sowieso nicht den Marktzugang verweigern, meinte Weissel, weil die USA dann dasselbe gegenüber der EU tun würden. Die EU könne daher den USA keinen Schaden zufügen, genausowenig wie ein Kleinstaat. Daß die U.S.-Amerikaner nach dieser Logik der EU aber dann auch nicht den Marktzugang verweigern können, weil die EU ein Druckmittel dagegen hat, ein Kleinstaat aber nicht, ist Weissel offenbar nicht aufgefallen. Die USA seien auch militärisch völlig überlegen, daher können sie von Europa auch nicht unter Druck gesetzt werden. Eine militärische Emanzipation Europas hält Weissel also offenbar auch für unmöglich; meiner Meinung nach könnte sie aber mittel- bis langfristig bevorstehen. Interessant erscheint mir an Weissels Gedankenexperimenten übrigens, daß die U.S.-Amerikaner darin tendentiell eher eine Bedrohung darzustellen scheinen.
Außerdem meine ich, daß es doch noch andere Staaten als die USA gibt, gegenüber welchen Europa durch Einigung zweifellos eine stärkere Position erlangen könnte, was z.B. andere EU-Gegner wie den von mir persönlich sehr geschätzten Diskussionleiter Prof.Bader in seinen ebenfalls EU-kritischen Publikationen eher veranlaßt - wahrscheinlich nicht zu Unrecht - die Wünschbarkeit der europäischen Machtanhäufung in Frage zu stellen, die ja auch mißbrauchsanfällig erscheint. Ähnliche nicht gänzlich von der Hand zu weisende Befürchtungen äußerte mir gegenüber erst jüngst im persönlichen Gespräch auch der renommierte Friedensforscher Johan Galtung. Ich möchte nebenbei ausdrücklich bemerken, daß ich Prof.Bader auch hinsichtlich seiner EU-Kritik (in der z.B. die bisher einseitig kapitalistische Ausrichtung des Integrationsprojektes oder die mögliche Kollision des Beitritts mit der österreichischen Neutralität, deren Beibehaltung man dem Volk vor dem Beitritt eigentlich von offizieller Seite eigentlich zugesagt hatte, eine Rolle spielt; man könnte zu dieser Kritik auch das Demokratiedefizit der EU-Institutionen hinzufügen), ob man nun insgesamt seine Meinung über die EU teilt oder nicht, sehr wohl als einen seriösen Forscher einschätzen würde. Er vertritt auch nicht jenen dumpfen Radikalismus, in den Weissel sich im Laufe seines Vortrages immer mehr - auch emotional - hineingesteigert hat; zu den schlimmsten verbalen Entgleisungen des Gastredners komme ich noch.
Ich hatte den subjektiven Eindruck, daß Weissels gesamter folgender Vortrag von einem ungelösten Widerspruch durchzogen wurde. Einerseits sah er die Europäische Integration (im Rahmen der EU) als “Scheinintegration” an, andererseits aber beklagte er immer wieder den Verlust nationalstaatlicher Kompetenz und Souveränität. Z.B. meinte er, die EU würde die Souveränität überhaupt nicht oder nur scheinbar angreifen; und er führte einige mehr oder weniger plausible Beispiele dafür an (plausibles Argument: die bei vielen Materien geforderte Einstimmigkeit im Rat setzt die Souveränität jedes Staates voraus; unplausibles Argument: die Rückseite der Euro-Münze wird von jedem Staat selbst gestaltet, was nach Weissel ein Zugeständnis an seine Souveränität sei, das den ganzen Integrationsprozeß quasi ad absurdum führe, weil dann jeder Staat erst wieder so etwas wie eine eigene Währung hätte. Das Argument ist falsch, weil das ja nur scheinbare Zugeständnisse an die Nationalstaaten sind. Denn man kann ja dann mit allen Euro-Münzen, egal welche Bildchen sie hinten haben, überall bezahlen, was Weissel als Ökonom sehr wohl weiß). Andererseits beklagte Weissel, daß die Staaten z.B. im Währungsbereich ihre Souveränität verlieren würden. Liegt also jetzt ein Eingriff in die Souveränität vor oder eine bloße “Scheinintegration”?
Weissel schien den Begriff der Souveränität, die ihm als unbedingter Wert erscheint, übrigens niemals kritisch hinterfragt zu haben. Er war ganz erstaunt, als aus dem Publikum der Einwand kam, der Verlust nationalstaatlicher Souveränität sei möglicherweise gut, denn die Souveränität diene ohnehin zu oft als ein Deckmantel für Verstöße gegen die Menschenrechte, eine ungerechte Kriegsführung oder die rücksichtslose Gefährdung anderer Länder durch ökologische Risken wie den Bau von Atomkraftwerken an ihrer Grenze. Natürlich könnte man dieser Feststellung auch andere legitime Argumente entgegenhalten, aber Weissels sichtliche Überraschung und Sprachlosigkeit darüber, daß man den Wert der Souveränität überhaupt anzweifeln kann, der aber in der heutigen Völkerrechtsdiskussion längst nicht mehr unbestritten ist, zeigt, daß er als Vortragender zum Thema einfach nicht “up to date” war. Die Frage, ob Österreich, das seine ganze Wirtschaft seit Jahrzehnten auf Deutschland ausgerichtet und jede Auf- und Abwertung der Deutschen Bundesbank nachvollzogen hat, nicht durch den Euro sogar an Währungssouveränität gewinnt, blieb leider unerwähnt (Österreich hat keine Interessensvertretung im Führungsgremium der Deutschen Bundesbank, im Rat der Europäischen Zentralbank aber schon).
Darüberhinaus nannte Weissel als eines der Hauptargumente gegen den EU-Beitritt, daß die Regierung während der Volksabstimmung zum EU-Beitritt in vielerlei Hinsicht gelogen hat, was auch durch meine persönlichen Erinnerungen eher bestätigt als widerlegt wird. Außerdem glaube er nicht, daß die Projekte und Pläne der EU, gesetzt, sie seien erstrebenswert, wirklich realisierbar wären. So kam er z.B. auf den Euro zu sprechen. Die Argumente der Euro-Befürworter hält Weissel für grundlegend falsch. Er hielt sich lange mit der Besprechung des Arguments auf, daß der Euro die bessere internationale Vergleichbarkeit der Preise garantiert, weil man nicht mehr umrechnen muß.
Er meinte dazu wörtlich: “Die Information, daß eine Sache irgendwo billiger ist, nützt doch niemandem etwas. Denn wenn jemand in Berlin einen Kaffee trinkt und weiß, daß er in Wien billiger ist, fährt er dann tausend Kilometer nach Wien und kauft sich einen Kaffee? Außerdem hat einer, der nicht umrechnen kann, sowieso nichts in der Außenwirtschaft verloren.”
Weissel hat sicherlich recht, daß hier ein angreifbares Argument der Euro-Befürworter vorliegt, denn eine Umrechnung von Schilling oder Mark in eine andere Währung ist wirklich nicht schwer. Das Beispiel in seinem Wortlaut ist dennoch verfehlt. Weissel kam nämlich weder auf den Gedanken, daß nicht nur Außenhandelsspezialisten im Ausland einkaufen, sondern auch einfache Menschen, die nicht so gut im Rechnen sind und lieber alles auf einen Blick sehen, noch auf den, daß die Leute nicht nur eine Tasse Kaffee kaufen, sondern auch z.B. Autos, Fernseher, Computer etc. Möglicherweise zahlt sich eine Fahrt ins billigere Ausland bei solchen Einkäufen sehr wohl aus. Diese Aussage ist eines der vielen Weissel-Zitate, die eher einen seltsamen Eindruck vom Referenten hinterließen, v.a. stellte sich die Frage, ob er bei so naiven Vorstellungen - das “Kaffee”-Argument ist doch nur mehr lächerlich - wirklich ein studierter Volkswirt wäre (er ist es tatsächlich, ich habe seinen Namen im Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, Wintersemester 2001/2002, unter dem aufgelisteten Personal des Instituts für Wirtschaftswissenschaft gefunden, über das man sicher auch in Kontakt mit ihm treten kann, wenn man seine Ansicht zur EU noch genauer kennenlernen will).
Die Zielsetzung der EU, einen einheitlichen Zinssatz zu schaffen, bezeichnete er als “Wahnsinn”, denn manche Staaten brauchen einen höheren, andere mit einer verschiedenen Wirtschaftsstruktur und Situation einen niedrigeren, Gleichmacherei sei verfehlt. Warum ein einheitlicher Zinssatz in den USA funktioniert, in denen die Wirtschaftsstruktur in den einzelnen Bundesstaaten auch oft grundverschieden ist, erklärte Weissel nicht, wobei man fairerweise sagen muß, daß dieses Argument aus dem Publikum leider nicht fiel und es vielleicht tatsächlich Unterschiede zwischen der U.S.-amerikanischen und der europäischen Situation gibt. Ich bin aber dennoch überzeugt, daß sein sehr festgefügtes Weltbild in der EU-Frage ohnehin durch kein noch so gutes Gegenargument zu erschüttern gewesen wäre. Er meinte auch, daß die einheitlichen Umwechslungskurse des Euro wirtschaftspolitisch nicht richtig wären und berief sich dabei auf Ausführungen des Nobelpreisträgers Milton Friedmans, der tatsächlich als prominenter Wirtschaftswissenschaftler die Sinnhaftigkeit des Euro mit berücksichtigungswürdigen Argumenten anzweifelt. Ein wichtiges Pro-Argument der Befürworter der fixen Wechselkurse, daß durch diese einerseits Spekulationen der Boden entzogen würde und man andererseits auch die Verunsicherung der Bürger, wann sie nun ihr Geld umtauschen sollen, gar nicht aufkommen läßt, kam im Forschungsgespräch leider nicht zur Sprache.
Dem Stabilitätspakt vertraut Weissel nicht, weil er davon ausgeht, daß ihn einige europäische Staaten früher oder später sowieso brechen werden - so wie in seiner Sicht überhaupt die meisten Verträge gebrochen werden, denn “die Staaten sind Gauner und ehrliche Gauner gibt es nicht”. Dieses wörtliche Zitat brachte wiederum sein von der politischen Ökonomie geprägtes und oben erwähntes negatives Menschenbild zum Ausdruck. Die Sanktionen, die der EU zur Garantie des Stabilitätspaktes zur Verfügung stehen, hält er für unzureichend; ohne zureichende Sanktionen, hier ist Weissel sicher, funktioniert kein Vertrag, denn die Menschen sind schlecht und man muß zumindest kalkulieren mit ihrem brutalen Egoismus. Die Frage aus dem Publikum, warum man bei einer solchen Sichtweise überhaupt Verträge abschließt und ob nicht der Abschluß eines jeden Vertrages (auch in der Geschäftswelt) nicht wenigstens ein gewisses Maß an Vertrauen voraussetzt, beantwortete Weissel nicht wirklich zufriedenstellend.
Auf jeden Fall bekräftigte Weissel seine Überzeugung, daß die EU sowie langfristig scheitern wird, worin ihm der Gesprächsleiter prinzipiell beizupflichten schien. Prof.Bader richtete die Frage an das Publikum, wer eigentlich die Risken des Experiments des Europäischen Integrationsprozesses übernimmt, was wirklich eine gute Frage ist; um darauf gleich zu antworten: das werden wohl, wie leider meistens bei politischen Grundsatzentscheidungen, die Völker Europas und nicht primär die Politiker tun müssen.
Dennoch stellt sich die ebenfalls legitime Frage, wer umgekehrt die Verantwortung für den Nicht-Beitritt zur EU übernommen hätte und für die Nachteile, die aus ihm möglicherweise erwachsen wären. Immerhin hatte Österreich 1994, im Gegensatz zu dem, was bei der Veranstaltung suggeriert wurde, nach meinem Dafürhalten nicht wirklich die Wahl, ein unabhängiger Staat zu bleiben oder stattdessen zur Europäischen Union beizutreten, sondern nur die, entweder ein wirtschaftlich von der auch ohne Österreich bestehenden EU weitgehend abhängiger Satellitenstaat zu sein oder eben - freilich in sehr bescheidenem Ausmaß, aber immerhin - in den Gremien jener Organisation mitbestimmen zu können, von der man de facto ohnehin abhängig ist. Die Schweiz, für die ältere Generation in Österreich oftmals ein politisches Vorbild, wird vielleicht auch eines Tages dahinterkommen, daß der von ihr momentan eingeschlagene Isolationskurs auch nichts an ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit von der EU ändert, welche die Schweizer Neutralität wohl auch so oder so langfristig aushebeln wird - die Frage ist für mich eigentlich nur, wann.
Doch zurück zum Referat des Gastredners: Weissels diskussionswürdigstes und bestes Argument war aus meiner Sicht, daß er meinte, es gäbe kein europäisches Denken, vielmehr nur ein nationalistisches. Er führte als Beleg dafür Werbekampagnen zu Europawahlkämpfen in Österreich an, die keineswegs mit dem “Besten für Europa”, sondern dem “Besten für Österreich” warben. Die Botschaft, das europäische Gesamtinteresse auch auf Kosten des nationalstaatlichen Einzelinteresses zu verteidigen, sei den Menschen (noch) nicht vermittelbar. Die Menschen eines Nationalstaates wollen noch immer, daß die Interessen des Nationalstaates verteidigt werden, nicht jene Gesamt-Europas. Entsprechend werden sich die Politiker in Europa auch in Zukunft blind egoistisch verhalten, wie Weissel dies auch bei vielen Verhandlungen diagnostiziert. Fragwürdig scheint nur sein Schluß aus dieser ohne Zweifel richtigen Beobachtung: Er schloß nicht, daß man den Menschen schon von Kindesbeinen an beibringen sollte, vom Interesse “ihres” Nationalstaates zugunsten der Union abzusehen, sondern, daß Europa angesichts des blanken nationalen Eigennutzes hoffnungslos verloren ist.
Abschließende Kritik
Ich habe mehrere schwerwiegende Kritikpunkte an Herrn Prof.Erwin Weissels Ausführungen; viele wurden schon im Text erwähnt, ich wiederhole sie daher nicht. Aber einige weitere dürfen an dieser Stelle nicht verschwiegen werden. Zunächst waren viele von Weissels Aussagen zur EU einfach polemisch und unseriös.
Es folgen einige Beispiele:
“Die Europäische Union ist bekanntlich eine Raubritterburg.”
“Die Entscheidungsträger der EU sind unqualifizierte drittklassige Leute, die zweitklassige Entscheidungen für erstklassige Gehälter treffen.”
“Die Politiker der EU haben selber Maul- und Klauenseuche, zumindest haben sie Klauen, mit denen sie das Geld der Bürger zusammenraffen.”
Ich glaube nicht, daß solche Aussagen in eine wissenschaftliche Veranstaltung gehören. Dies ist die Sprache, die in diversen politischen Veranstaltungen in Bierzelten üblich ist, aber nicht an der Universität Wien. Aber ich muß auch sagen, daß ich selbst eine parteipolitische Veranstaltung in der Regel zu verlassen pflege, wenn ein solch unseriöser Ton angeschlagen wird. Es gibt einen Unterschied zwischen einer seriösen und zulässigen Kritik an der EU und einem unseriösen Generalangriff nach dem Muster der obigen Zitate, in den Weissel oftmals verfiel. Das UZF nimmt für sich Wissenschaftlichkeit und Objektivität in Anspruch. Aber im Rahmen der hier besprochenen Veranstaltung wurde einem Referenten - neben dem Vorbringen seiner durchaus diskussionswürdigen Thesen - erlaubt (auch von der Gesprächsleitung unwidersprochen!) “Ideologie pur” zu vertreten. Oder was ist die Aussage von der Raubritterburg sonst als Ideologie? Etwa objektive Wissenschaft? Oder die von Weissel selbst vielgepriesene empirisch-mathematische Methode der politischen Ökonomie?
Eine bemerkenswerte Frage kam gegen Ende der Veranstaltung aus dem Publikum. Sie lautete in etwa: “Nun gut, Herr Professor, Sie haben nun festgestellt, daß die EU aus Ihrer Sicht vollkommen schlecht ist, der Inbegriff des Bösen sozusagen. Nehmen wir nun einmal an, Ihre Sichtweise sei zutreffend. Was soll man jetzt Ihrer Meinung nach tun? Die EU auflösen?” Prof.Weissel mußte zugeben, daß dies nicht durchsetzbar wäre. Er wußte im Prinzip auf die berechtigte Frage nach den praktischen Konsequenzen seiner Ausführungen keine wirkliche Antwort. Er hielt lediglich eine Werberede für das Volksbegehren für den Austritt Österreichs aus der EU, das meiner Meinung nach mindestens ebenso chancenlos ist wie das Projekt der EU-Auflösung. Ist eine solche Kritik sehr sinnvoll? Dem Leser mag das Urteil selbst überlassen bleiben.
Es stellt sich auch die Frage, ob es wirklich ausschließlich negative Seiten am Europäischen Integrationsprozeß gibt. Ist es nicht vielmehr erfahrungsgemäß so, daß es in jedem politischen Gebilde und jeder politischen Entscheidung Vor- und Nachteile gibt? Ich persönlich empfehle, beide Seiten zu sehen und weder in eine unreflektierte Beweihräucherung, noch in eine polemische Fundamentalopposition à la “Die EU ist eine Raubritterburg” zu verfallen.
Man sollte darüberhinaus auch selbst bei der zutreffendsten Kritik nicht vergessen, daß sich die EU erst im Aufbau befindet und bestimmte Fehler, so sie existieren, tendentiell korrigiert werden können. Das Argument eines Demokratiedefizits der EU-Institutionen ist z.B. richtig; dennoch zeigt der Trend der letzten fünfzig Jahre eine zunehmende Aufwertung des europäischen Parlaments, die freilich fortgesetzt werden muß. Es geht also meiner Ansicht nach vieles in die richtige Richtung. Auch die bisher einseitig kapitalistische Ausrichtung der EU scheint mir ein echter und legitim zu beklagender Mangel zu sein; durch die Schaffung einer “Sozialunion” als, wenn man so will, “4.Säule”, könnten sozial gesinnte Politiker aller Parteien dem aber langfristig begegnen. Die EU ist sicherlich noch Stückwerk, eine große Baustelle. Für mich sind diagnostizierte Defizite daher eher eine Aufforderung, in Richtung ihrer Korrektur zu arbeiten, anstatt alles gleich pauschal abzulehnen.
Ich denke, daß Prof.Weissel in manchem recht hatte und in einigem auch nicht; oftmals schoß er aber auch mit seinen legitimen Argumenten einfach weit über das Ziel hinaus, v.a. mit seiner Polemik.
Das Publikumsinteresse an der Veranstaltung wäre wahrscheinlich größer gewesen, wenn man einen etwas plakativeren Titel als “Integration versus Desintegration in Europa aus der Sicht der politischen Ökonomie” gewählt hätte. Man sollte in Hinkunft auf das Design des Veranstaltungstitels größeres Augenmerk legen und ihn so gestalten, daß er der berühmten KISS-Formel der Werbung gehorcht (“keep it short and simple”). Ein Titel muß ansprechen, aufrütteln, unter die Haut gehen, Interesse wecken, gut einprägsam und leicht merkbar sein; natürlich muß in einer wissenschaftlichen Institution dabei eine gewisse Seriosität gewahrt bleiben, was nicht zuletzt aus Image-Gründen sehr wichtig ist (“In den Klauen der EU” eignet sich daher z.B. trotz Plakativität nicht). Aber der faktisch gewählte Titel war meiner Ansicht nach viel zu kompliziert und langweilig, um begeistern zu können.
Abschließend möchte ich sagen, daß mir die Veranstaltung persönlich alles in allem (d.h. trotz der im Text genannten Kritikpunkte) gut gefallen hat, weil es mir interessant erschien, daß man einen anderen Standpunkt als den in den Medien und den wissenschaftlichen Lehrbüchern üblicherweise kolportierten zu hören bekam; manche Einseitigkeiten der “offiziellen” vielleicht zu schönfärberischen Version konnten dadurch teilweise korrigiert werden. Es könnte einerseits durchaus ein Erfolgsrezept sein, wenn das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) in der Öffentlichkeit in Hinkunft weiterhin “querdenkerisch” agiert.
Andererseits findet Engagement gegen die EU nach dem Ergebnis meiner Expertengespräche nicht die Unterstützung der Gesamtorganisation und ist daher, trotz des Ehrenschutzes, den alle führenden UZF-Mitarbeiter auf der Einladung offenbar übernommen haben, eigentlich mehr als eine “Privatinitiative” des 1.Vorsitzenden im Rahmen des UZF zu werten, was auch wiederum auf gewisse Art und Weise kritikwürdig erscheint, wäre doch umfassende Unterstützung aller P.R.-Aktionen ebenfalls wichtig.
Schritt 2:
Programmerstellung
Überlegungen zu einem Leitbild
1. Formulierung der Zielvorstellungen als Voraussetzung für konsequente Öffentlichkeitsarbeit
So trivial es ist, so oft wird es vergessen: Bevor man in die Öffentlichkeit geht, muß man wissen, was man eigentlich will und wofür man eigentlich steht; man muß sich das, was man zu sagen hat, vor einem Medienauftritt überlegen, nicht währenddessen oder nachher. Welche Ziele, welche Werte vertritt die eigene Organisation? Öffentlichkeitsarbeit macht nur Sinn, wenn es solche Ziele und solche Werte gibt. P.R. muß dann im Rahmen dieser stattfindet.
Eine Erfahrung der P.R.-Praxis ist, daß man, um Klarheit über Ziele und Werte zu schaffen, diese schriftlich ausformulieren sollte; das erhöht die Eindeutigkeit. Ohne dieser liegt vielleicht eine Öffentlichkeitsarbeit ohne einheitlichen Plan vor - und Mißerfolg wird wahrscheinlicher.
Auch die Autoren des amerikanischen Standardlehrbuches “Effective Public Relations” vertreten diese Ansicht, wenn sie schreiben:
“Most organizations have a written statement of goals and objectives, long-range and immediate. The purpose is to state (...) why an organization exists (...) In short, (mission statements) are idealistic and inspirational statements designed to give those in the organization a sense of purpose and direction. (...)
Mission statements of organizational goals, obligations, values, and social responsibility serve two important purposes in public relations: First, they commit the whole organization to accoutability, and that means visibility or communication of some sort. Second, the attitudes expressed provide a framework in which public relations can devise its goals and objectives, build its budget, direct its talents, devise its programs, and assess its impacts.”
Und weil effiziente Öffentlichkeitsarbeit eben auf einem ausformulierten Unternehmensleitbild beruhen muß, fügen die Autoren hinzu: “In organizations where no such statements have been set down, there is an urgent need for the top public relations officer to propose one.”
2. Corporate Identity
2.1. Begriffserklärung und Relevanz
Corporate Identity (CI) ist das “Erkennen, Gestalten, Verwirklichen und Prüfen der Identität eines Unternehmens”. Durch die Nutzung der Disziplin der CI soll sich das Unternehmen “nach innen und nach außen wie aus einem Guß präsentieren”. Das Wort “corporate” bedeutet auf Englisch soviel wie “vereint, gemeinsam, gesamt”, “identity” ist die Identität, d.h. das Selbstverständnis der Organisation. Es geht also um das Selbstverständnis der Organisation als Ganzes und natürlich um die Kommunikation desselbigen nach außen und innen. Corporate Identity ist das “Management von Identitätsprozessen einer Organisation”. Die Disziplin soll Unternehmen bei der Definition, Entwicklung und Kommunikation ihrer Identität unterstützen.
In unserer heutigen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung wird es immer wichtiger, daß eine Organisation, die sich behaupten will, eine unverwechselbare Identität aufbaut. Studien zeigen, daß Corporate Identity und Unternehmenserfolg hoch korrelieren; andere, daß die überwiegende Anzahl der Top-Manager CI für wichtig halten.
Dies hat auch Gründe: Zwei von drei Käufern einer Ware interessieren sich beim Kauf für das Image des Produzenten. Man kauft heute nicht einfach Schuhe oder Zahncreme. Man kauft auch eine Marke, die z.B. gewisse Werte oder ein Lebensgefühl signalisiert. Auf einer rein materiellen Ebene gedacht sind die verschiedenen Produkte einander ja ziemlich ähnlich. Es wird daher immer wichtiger, ein Produkt oder eine Dienstleistung mit Identität quasi “aufzuladen”. Wenn es dennoch wirkliche Unterschiede gibt, verschafft man sich angesichts der großen Konkurrenz Marktvorteile, wenn man sich über sie bewußt wird und sie ständig ausdrücklich betont.
Ein Kunde will eine Antwort auf die Frage, warum er gerade in einem bestimmten Gasthaus und nicht woanders sein Bier trinken oder Kunde gerade dieses und nicht eines anderen Handwerkers werden soll etc. Die Definition und Einhaltung grundlegender Werte wird darüberhinaus heutzutage auch insoferne immer wichtiger, weil Medien und große Gruppen der Gesellschaft sie ständig einmahnen und auch ihr Verhalten - etwa ihr Kaufverhalten - daran orientieren.
Neben der Relevanz für die externe Kommunikation ist CI auch intern relevant. Wenn Unternehmen große Veränderungen durchmachen, entsteht Unsicherheit über die Identität unter Mitarbeitern. Diese Unsicherheiten gilt es zu beseitigen.
CI macht Unternehmen effizienter. Ist die Identität klar definiert, dann wissen Mitarbeiter, was von ihnen erwartet wird und können besser auf das Ziel hinarbeiten. Es entsteht optimalerweise ein “Wir-Gefühl”, das die Motivation und Leistung erhöht sowie den Auftritt nach außen vereinheitlicht und damit seine Wirkung verstärkt.
Alles was hier über den Profit-Bereich gesagt wurde, kann sinngemäß auf den Non-Profit-Bereich übertragen werden, dem Konkurrenz ja ebenfalls nicht fremd ist. Gerade für eine Non-Profit-Organisation ist es unumgänglich, die Methoden der CI zu nutzen, um “Marktvorteile” gegenüber anderen zu erlangen.
Auch die Größe eines Unternehmens, ob im Profit- oder Non-Profit-Bereich aktiv, spielt hinsichtlich der Wichtigkeit der Corporate Identity keine Rolle: “Der Verein mit 50 Mitgliedern hat auch seine Identität, ebenso wie der Konzern mit 500.000 Mitarbeitern.” Hier zeigt sich aber folgendes Gefälle: Große Unternehmen wie Coca Cola, IBM, Sony etc. legen auf Corporate Identity größten Wert, kleine Betriebe nützen die Möglichkeiten dieser Disziplin kaum. Aber auch ein mittelständischer Handwerksbetrieb kann sich als unverwechselbar in der Öffentlichkeit positionieren; und auch eine kleine Gemeinde sollte erklären können, warum es sich auszahlt, sie zu besuchen oder seinen Urlaub gerade in ihrem Ortsgebiet zu verbringen.
Corporate Identity ist nicht der einzige, aber ein wichtiger und unverzichtbarer Faktor in der Schaffung eines Corporate Image, also eines eindeutigen, konsistenen und widerspruchsfreien Bildes, das sich die Öffentlichkeit vom Unternehmen macht. Heutzutage gilt: Image ist alles. Man kann das eigene Image zwar nicht hundertprozentig kontrollieren, aber doch durch CI maßgeblich beeinflussen.
2.2. Die Unternehmenskultur
In Unternehmen prägen spezifische Werte und Normen sowie Denk- und Verhaltensmuster die Entscheidungen, Handlungen und Aktivitäten der Mitarbeiter; oft ohne, daß sie bewußt reflektiert werden. Häufig hatte der Gründer eines Betriebes solche Werte vor dem Hintergrund seiner Zeit vor Augen. Diese wurden an die nachfolgenden Generationen weitergegeben und “selbstverständlich”; auch andere Werte wurden im Laufe der Zeit von außen in das Unternehmen hineingetragen. Aus all dem entsteht die Unternehmenskultur.
Woran zeigt sich die Unternehmenskultur? Z.B. daran, wie man mit Kritik umgeht, wie man Entscheidungen trifft, wie man miteinander spricht, ob man vergangenheits- oder zukunftsorientiert denkt, konservativ oder modern, welche Rituale man praktiziert und ob Hierarchie viel oder wenig bedeutet. Die Identität eines Unternehmens kann nicht beliebig konstruiert werden, sondern muß auf Bestehendes aufbauen.
Organisationen können sich trotzdem oft ganz grundlegend ändern, meist durch den Zwang der Verhältnisse, aber auch aufgrund von Offenheit und Flexibilität. Letztere ist wichtig, um sich im Konkurrenzkampf behaupten zu können; dennoch sollte man darauf achten, alle eventuellen Veränderungen kulturverträglich zu gestalten. Eine Unternehmenskultur ist immer vorhanden. Es ist nicht möglich, daß es keine solche gibt.
2.3. Das Leitbild
Das Leitbild - auch Vision, Mission oder Unternehmensphilosophie genannt - formuliert die angestrebte Identität des Unternehmens. Basis dafür ist die gelebte Unternehmenskultur, die Erwartungen der Belegschaft und externen Bezugsgruppen. Auch die Ideen des Gründers spielen eine Rolle. Leitbild und Unternehmenskultur stehen in einem Wechselverhältnis zueinander: Das Leitbild entspringt einer gewissen Kultur, wirkt aber auch auf diese zurück.
Ein ausformuliertes Leitbild bietet u.a. - aus CI-Perspektive - folgende Vorteile:
Es informiert die Führungskräfte und Mitarbeiter über die gewünschten Werte, Normen und Grundprinzipien des Unternehmens. Dies schafft eine Grundlage für einheitliches Verhalten auf allen betrieblichen Ebenen.
Das Leitbild unterstützt Geschäftsleitung und Führungskräfte bei zeitgemäßer und der Situation angepaßter Führung. Fehler werden erkennbar und können korrigiert werden. Unsicherheiten werden ausgeräumt, die das optimale Erfüllen von Aufgaben verhindern.
Ein Leitbild zeigt jedem Mitarbeiter eines Unternehmens, wie er durch sein persönliches Verhalten zum Erreichen der Unternehmensziele und damit zum Erfolg des Unternehmens beitragen kann.
Es ermöglicht den Bereichen einer Organisation (v.a. für große Organisationen relevant) detaillierte Vorgaben für die Mitarbeiter abzuleiten, die nicht beliebig sind, sondern die aus einem übergeordneten gemeinsamen Selbstverständnis stammen.
Das Leitbild wirkt nach außen, indem es wichtige Bezugsgruppen über die Werte und Normen des Unternehmens informiert sowie Wünsche und Erwartungen an die Zusammenarbeit trifft.
Wenn das Unternehmen stärker als Ganzes wirken soll, müssen gemeinsame Spielregeln bekannt sein und eingehalten werden. Das Leitbild gibt hierfür den Orientierungsrahmen vor, der je nach Situation und Problem ausgefüllt werden kann.
Die drei Teilkomponenten eines Leitbildes sind:
Leitidee
Fast jedes Unternehmen, auch jeder Verein, begann mit einer großen Idee - egal, ob es sich um den Gedanken handelt, Tiere oder die Umwelt zu schützen, die Musik zu fördern oder gute Haushaltgeräte zu produzieren, um der Hausfrau die Arbeit zu erleichtern.
Der Gründer schuf dann eine Organisation, die seine Idee in die Praxis umsetzen sollte. Die Idee steht dann über der Vereinigung und wirkt in ihr immer noch nach, selbst wenn sie nach Jahrzehnten fast verschüttet ist. Später können auch noch andere Werte hinzukommen, aber eine Besinnung auf die ursprünglichen Werte kann eine Organisation besonders stärken.
Die Leitidee des UZF ist in diesem Zusammenhang natürlich klar: Es ist Leo Gabriels Konzept der “Wahrheit des Ganzen”.
Leitsätze
Es kann die Effizienz des Leitbildes erhöhen, wenn die Hauptaussagen nochmals schlagwortartig zusammengefaßt werden, sodaß eine etwas plakativere Wirkung entsteht. Man formuliert dann entsprechend sogenannte Leitsätze.
Motto
Ein Motto bringt das Leitbild zuletzt noch auf den Punkt. Es ist kurz, prägnant und leicht zu merken, was ein nicht unbeträchtlicher Vorteile ist. Man kann mithilfe dieses “Slogans” kurz und allgemein verständlich deutlich machen, wofür man steht, weswegen sich die Annahme eines Mottos für jede Organisation empfiehlt.
Im folgenden einige Beispiele für Unternehmensmottos:
AEG: AUS ERFAHRUNG GUT
AUDI: VORSPRUNG DURCH TECHNIK
AVIS: WE TRY HARDER
ADIDAS: FEET YOU WEAR
BERTELSMANN: FASZINATION DER MEDIEN
BMW: FREUDE AM FAHREN
BOSCH: DIE VERBINDUNG STIMMT
DUPONT: TEIL UNSERES LEBENS
GRUNDIG: MADE FOR YOU
HYPO BANK: UNSERE ENERGIE IST IHR KAPITAL
OPEL: WIR HABEN VERSTANDEN
PHILIPS: LET’S MAKE THINGS BETTER
RENAULT: AUTOS ZUM LEBEN
SONY: IT’S A SONY
2.4. Instrumente der Corporate Identity
Die drei Instrumente der Corporate Identity sind:
Corporate Design
Corporate Communications
Corporate Behavior
Das Corporate Design vermittelt die Firmenidentität durch ein einheitliches visuelles Erscheinungsbild. Durch ein solches Erscheinungsbild kann die eigene Identität für alle gut erkennbar an die Öffentlichkeit transportiert werden. Damit steht ein hervorragendes Instrument zur Verfügung, um diejenigen Werte und Ziele allgemein verständlich auszudrücken, für die man steht.
“Corporate Design ist visuelles Konzentrat eines inhaltlichen Konzeptes, einer Weltanschauung, eines gesellschaftlichen Auftrages, eines Parteiprogrammes, eines Unternehmensleitbildes, kurzum: eines formulierten Selbstverständnisses.”
Der wichtigste Teil eines Corporate Designs (das man in größeren Unternehmen auch z.B. in der Architektur umsetzen kann), ist das Logo. Man unterscheidet bei Logos allgemein:
Bildmarken
Wortmarken
Kombinierte Marken
Bildmarken sind (bildhafte) Symbole, die untrennbar mit einem Unternehmen verbunden sind. Dazu gehört z.B. der berühmte Stern von Mercedes. Sie beinhalten keine Schrift. Eine Wortmarke ist im Prinzip ein Schriftzug mit einem speziellen Design, als Beispiel möge die Aufschrift “Coca Cola” dienen. Der Vorteil von reinen Wortmarken ist, daß sie nicht verwechselt werden können; kleinere Unternehmen, die eine reine Bildmarke verwenden, werden oft nicht eindeutig zugeordnet. Wortmarken erfordern allerdings eine höhere Aufmerksamkeit. Kombinierte Marken bieten Wort- und Bildelemente und sind dadurch insoferne ideal, weil sie die Vorteile von Wort- und Bildmarke zur gleichen Zeit aufweisen.
Corporate Communications bedeutet nichts anderes, als daß man seine gemeinsame Identität dann auch kommuniziert, u.a. auch durch P.R.-Maßnahmen.
Wichtig ist aber v.a. das Corporate Behavior. Eine gemeinsam ausformulierte Corporate Identity z.B. in Form eines Unternehmensleitbildes muß auch in der Praxis des Betriebes gelebt werden, sonst ist sie nur schmückendes Beiwerk ohne Bezug zur Realität und damit ohne den gewünschten Effekt. Allgemein gilt: “Nicht an dem, was eine Firma sagt, wird sie gemessen, sondern daran wie sie handelt.”
2.5. Probleme der Corporate Identity
In jedem Bereich des Managements kann man Fehler begehen, so auch hier. Corporate Identity soll nicht von oben verordnet, sondern in einem möglichst breiten Konsens festgelegt werden. Denn die Mitarbeiter sollen sich nicht fremdbestimmt fühlen; eine wirkliche Identifikation der Mitarbeiter wird nur erfolgen, wenn sie auch bei der Gestaltung der CI mitwirken konnten - es soll ja “ihre” Corporate Identity sein, nicht die eines anderen.
Corporate Identity soll auch genügend Freiraum für individuelle Entfaltung und Meinungsvielfalt belassen. Es soll ein gewisser Grundkonsens über Werte bestehen - wenn es wirklich gar keinen Konsens gibt über irgendetwas, kann man wohl auch kaum von einem Unternehmen sprechen -, aber individuelle Freiheit bei der Umsetzung dieses Grundkonsenses ist zur Mitarbeitermotivation ebenfalls wichtig. Dieses Spannungsfeld von notwendiger gemeinsamer Einheit und erwünschter individueller Freiheit gilt es zu bewältigen.
Ein häufiges Problem ist auch folgendes: Manchmal wird einem Unternehmen ein Leitbild “übergestülpt”, das gar nicht zu ihm paßt. Das passiert z.B., wenn die P.R.-Agentur nur das Leitbild eines anderen Unternehmens übernimmt und vorher vielleicht ein wenig umschreibt. Gründliche Recherchen, etwa in der Form von mehrstündigen Interviews mit hochrangigen Funktionären wie im Rahmen der vorliegenden Arbeit, sind aber genauso Voraussetzung für die Erstellung einer guten CI wie eine “Spezialanfertigung” für jedes Unternehmen. Corporate Identity hat eben gerade den Sinn, die Einzigartigkeit eines Betriebs zu kommunizieren. Die einfache Übernahme eines bereits vorhandenen Leitbilds ist vollkommen unsinnig, ja kontraproduktiv.
In manchen Betrieben existieren dermaßen unterschiedliche Vorstellungen über Werte und Ziele, daß man sich z.B. im Konsens nur auf nichtssagende Phrasen einigt. Diese sind dann meistens so selbstverständlich, daß sie in die Trivialität absinken. Manche Aussagen sind überhaupt so allgemein, daß man sich in der Praxis wieder gar nicht nach ihnen richten kann oder daß sie für viele Betriebe gelten, nicht aber einen ganz bestimmten (nämlich den eigenen) auszeichen, was ja Sinn der Sache ist. Ein Beispiel: Philips gab 1996 u.a. folgenden Leitsatz an die Belegschaft aus: “Erfreuen Sie die Kunden.” Sieht man davon ab, daß dies eher wie eine Aufforderung an eine Prostituierte klingt, stellt sich die Frage, was das denn heißt - und zwar umgesetzt in konkrete Handlungen. Soll man den Eintretenden etwas vorsingen? Oder einen Witz erzählen? Die CI der Firma Pana, eines Herstellers von Badezimmereinrichtung, ist da schon konkreter und damit auch besser, wenn es in einer Anweisung an die Mitarbeiter heißt: “Wie kalkulieren unsere Preise fair und ehrlich. Bei uns gibt es keine künstlich erhöhten Abgabepreise, um später einen falschen Ausverkauf durchzuführen.” An einer solchen Regelung kann sich ein Mitarbeiter wirklich orientieren, vorausgesetzt, sie ist ehrlich gemeint.
Und hier liegt eben ein springender Punkt: Corporate Identity muß auch im Corporate Behavior wirklich gelebt werden. Daher ist, bei allem Ideal, beim Design der CI auch ein gewisser Realitätssinn gefragt. Was ist tatsächlich durchsetzbar und was nicht? Es bringt nur einen zusätzlichen Verlust an Glaubwürdigkeit, wenn sich das Unternehmen als innovativ, modern und dynamisch öffentlich präsentiert, in Wahrheit aber auf Anfragen nur sehr schwerfällig reagiert oder Entscheidungsprozesse viel zu lange dauern. Die CI muß zum Unternehmen passen, die Realität widerspiegeln.
Sie will ein Unternehmen aber auch manchmal zum Besseren ändern, z.B. indem Frauenförderung betont wird, die bis zur Gegenwart nicht wirklich vorhanden war. Und hier liegt eben die Kunst: Die Wünsche und Werte der Mitarbeiter, die Ziele des Gründers und der gegenwärtigen Geschäftsführung, die oft hochgesteckten moralischen Erwartungen der Gesellschaft im allgemeinen und der Medien sowie der angesprochenen Zielgruppen im besonderen zu erkennen, diese in ein angemessenes, ausgewogenes und glaubwürdiges Verhältnis zur Realität der Organisation zu bringen und danach auszuformulieren. Das Spannungsfeld zwischen Ideal und Realität ist hierbei ebenso zu bewältigen wie das oben erwähnte Spannungsfeld zwischen Einheit und Freiheit.
3. Anwendung des Gesagten auf das UZF
3.1. Erstellung eines Unternehmensleitbildes und eines Corporate Designs
Es ist nicht einfach, die Ziel- und Wertvorstellungen des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) herauszufinden. Es gibt kein Unternehmensleitbild, das diese eindeutig und klar definiert. Die Zielvorgaben der Statuten, die formal noch immer gelten, sind hoffnungslos veraltet, weil sie noch aus der Zeit stammen, da das UZF ein bloßer Förderverein war und ihre Formulierung entsprechend nicht mehr mit der sozialen Realität übereinstimmt.
Aus den Überlegungen aus den vorigen beiden Abschnitten folgt, daß das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) seine Ziel- und Wertvorstellungen in einem Unternehmensleitbild ausformulieren sollte.
Das würde - siehe Punkt 1 - einen eindeutig festgelegten, verbindlichen Rahmen für die Öffentlichkeitsarbeit abstecken, nach dem man sich richten könnte; der Auftritt würde somit klarer, vereinheitlichter und effizienter. Außerdem würde - siehe Punkt 2 - ein solcher ausformulierter Grundkonsens der Corporate Identity im oben beschriebenen Sinne dienen.
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) sollte überhaupt die Disziplin der Corporate Identity für sich nutzen. Dies ist v.a. aus mehreren Gründen wichtig. Nach der Einschätzung einiger der befragten Experten ist die große Konkurrenz auf dem Non-Profit-Sektor (v.a. im Friedensbereich) ein Hauptproblem der Organisation. Gerade diese große Konkurrenz macht aber eine klar ausformulierte eigene Identität umso wichtiger. Man muß Interessierten erklären können, warum sie gerade im UZF und nicht bei einer x-beliebigen anderen Friedensorganisation Mitglied werden oder warum sie gerade Veranstaltungen des UZF und nicht andere besuchen sollen. Man muß die eigenen Stärken erkennen und klar betonen, man muß sich als unverwechselbar und einzigartig profilieren. Man muß sagen, wo man steht, Flagge zeigen. Ein wesentlicher Faktor zur Formung eines Images ist eben die Corporate Identity.
Dazu kommt: Zweimal in seiner Geschichte mußte das UZF wesentliche Veränderungen durchmachen: Das erste Mal 1981, als es von einem bloßen Förderverein zu einer Friedensforschungsinstitution umgebaut wurde, das zweite Mal 1995, als die bereit ausführlich besprochene Krise zu massiven fachlichen Umorientierungen im Sinne einer Hinwendung zu den Human- und Sozialwissenschaften und einer Abwendung von der in erster Linie theologischen Ausrichtung führte. Obwohl sich die Organisation seit seiner Gründung im Jahre 1973 faktisch sehr stark geändert hat, wurde die Art dieses Wandel nie konkret definiert und offiziell dokumentiert.
Es ist längst überfällig, durch ein Unternehmensleitbild extern und intern Klarheit zu schaffen, um eindeutig zu signalisieren, wo man heute eigentlich steht bzw. stehen will. Ich habe Anzeichen in meinen Interviews gefunden, daß sich nicht alle über Werte und Ziele der Organisation im Klaren sind (ich möchte hier nicht zitieren, um niemanden für ehrliche Eingeständnisse zu diskreditieren). Manchmal gab es, dies fiel mir bei den unabhängig voneinander durchgeführten Befragungen der Mitarbeiter auf, auch wieder sehr heterogene Auffassungen zu Werten und Zielen der Vereinigung, die nur schwer miteinander in Einklang zu bringen waren. In vielem scheint aber Konsens möglich und ist vorhanden; es sollte eine konkrete Ausformulierung des Konsenses geben.
Wenn man eine solche Ausformulierung nicht trifft, wäre es nicht zuletzt deshalb schade, weil doch das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) nicht nur eine einzigartige Geschichte und Unternehmenskultur, sondern auch einige echte Stärken und Kompetenzen besitzt, welche die Organisation tatsächlich unverwechselbar machen. Man müßte eigentlich nur alle ohnehin intern vorhandenen Erkenntnisse der Mitarbeiter einmal zusammenschreiben.
Ich versuchte, einen Vorschlag zu einem solchen Unternehmensleitbild auszuarbeiten, indem ich einerseits die Geschichte der Organisation erforschte (hierbei war v.a. die Gründerpersönlichkeit Leo Gabriel prägend, der “Friedensdialog zwischen Christen und Marxisten” sowie die Probleme mit besagtem Militärbischof, die zu bestimmten Grundsatzentscheidungen hinsichtlich Bindung an die Universität und Verhältnis zum Militär geführt haben).
Zudem mußten die Stärken der Vereinigung betont werden, die ich - siehe oben - aufgearbeitet habe.
Außerdem sollten mir die teilnehmenden Beobachtungen an Veranstaltungen Aufschluß geben über die Unternehmenskultur; ich achtete z.B. während meiner Teilnahme an der letzten Generalversammlung genau darauf, wie man miteinander umging und fand etwa heraus, daß man nach umfassendem Konsens bei den Entscheidungen strebt und Kampfabstimmungen meidet. Die Selbstdarstellung im Internet belehrte mich über das Streben nach Unabhängigkeit von allen Parteien und Interessensgruppen.
Zentral für meine Recherchen waren v.a. die Interviews mit hochrangigen Funktionären der Vereinigung. In jedem Gespräch fragte ich z.B. den Experten nach Werten, Zielen und Aufgaben der Organisation - wobei ich, so gut es ging, um Präzisierung bat (wenn man mir z.B. entgegnete “Wir sind für den Frieden”, was ja alles und nichts heißen kann, ließ ich es natürlich nicht darauf beruhen, sondern fragte lästigerweise nach: “Warum sind Sie eigentlich für den Frieden? Was verstehen Sie darunter? Gibt es noch andere, mit dem Frieden verknüpfte Werte, für die Sie einstehen?” etc.), wodurch ich vielen Befragten sichtlich auf die Nerven ging, wofür ich mich entschuldigen möchte; es war diese Vorgangsweise aber zur Erreichung des Forschungszieles in diesem Fall leider notwendig.
Kurz zusammengefaßt waren die Standpunkte folgende:
Der Präsident Herr Prof.Leser verstand unter “Frieden” zunächst Einstehen für soziale Gerechtigkeit d.h. vor allem Demokratie, ferner Einmahnen von Dialogbereitschaft und Toleranz sowie einen christlichen Werthintergrund. Den “Friedensdialog der Weltreligionen” bezeichnete er als “die wichtigste Veranstaltungsreihe” des UZF, woraus ich u.a. schließe, daß ihm die Vermittlung zwischen verschiedenen Religionen, aber auch sicherlich Ideologien, sozialen Gruppen etc. ein Anliegen ist. Er meinte, es sei auch die Aufgabe der Vereinigung, in der Öffentlichkeit zu kontroversiellen Themen Stellung zu nehmen, was ich u.a. so interpretiere, daß er der Öffentlichkeitsarbeit einen zentralen Stellenwert einräumt.
Der 1.Vorsitzende Herr Prof.Bader betonte - neben vielen bereits genannten Punkten - v.a. die Wichtigkeit besagter Vermittlung zwischen Weltreligionen in einem Friedensdialog, was in Anknüpfung an die Forschungsergebnisse Samuel Huntingtons insoferne notwendig sei, weil dadurch religiöse und kulturelle Konflikte entschärft werden könnten, die auf diesem Planeten immer mehr zunehmen. Das UZF müsse außerdem Informationen zum Frieden verbreiten bzw. der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen - auch er hält also, das geht aus dieser Aussage zweifelsfrei hervor, Öffentlichkeitsarbeit für zentral. Er betonte mir gegenüber auch die Bedeutung der Wissenschaftlichkeit auf höchstem Niveau und größtmöglicher Objektivität. Interdisziplinäre Forschungsansätze und internationale Kooperationen hielt er ebenfalls für wichtig. In einem Zeitschriftenartikel, der wesentliche Vorarbeit zur vorliegenden Studie leistete, betonte er ebenfalls die Bedeutung einer Rückbesinnung auf die “Leitidee” Leo Gabriels bei der Gründung des UZF, die “Wahrheit des Ganzen”, wobei Baders Meinung diesbezüglich aus P.R.-Sicht zu 100% geteilt werden kann, ja sogar muß. Aus der Perspektive der Corporate Identity spielen die Ideen des Gründers immer eine bedeutende Rolle, weil sie geeignet sind, eine Art “Gemeinschaftsgefühl” zu stiften, sagen sie doch etwas aus über den gemeinsamen Ursprung der Organisation aus; man muß sie an zentraler Stelle berücksichtigen und immer wieder in Erinnerung rufen. Ich habe ferner im Gespräch herausgefunden, daß er u.a. gegenüber der Friedensdenkerin Bertha von Suttner große Bewunderung empfindet; ich bin der Meinung, man sollte diese große und bedeutende Philosophin ebenfalls berücksichtigen, schon alleine, um ein bewußtes Gegengewicht zu diversen Verleumdungen von Seiten der Militärgeistlichkeit zu setzen.
Die Generalsekretärin Frau Hofrat Pöllinger verwies mich einerseits auf den “positiven” Friedensbegriff im Sinne Johan Galtungs (was im Prinzip bedeutet, daß wahrer Frieden nur beim Vorliegen sozialer Gerechtigkeit und hier v.a. einer demokratischen Gesellschaft erreicht werden kann). Sie meinte andererseits, der Friede sei schwer bis gar nicht zu begründen und führte dies sinngemäß darauf zurück, daß er Zweck, nicht bloß Mittel des menschlichen Zusammenlebens darstellt. (Diese letztgenannte Meinung vertrat übrigens auch Hannah Arendt, die im Gespräch aber nicht ausdrücklich zitiert wurde.)
Auf jeden Fall hätte der Friede viel mit dem Schutz des Lebens zu tun, was besonders wichtig sei (es gibt ein Menschenrecht auf Leben). Die Generalsekretärin betonte außerdem die Wichtigkeit von Friedensdenkern wie z.B. Immanuel Kant und die Bedeutung Internationaler Organisationen wie der OSZE. Minderheiten in Europa hätten deshalb Einfluß auf Krieg und Frieden, weil es gegenwärtig und künftig wahrscheinlich keine größere gewaltsame Auseinandersetzung mehr geben wird, die nicht irgendetwas mit einem ethnischen Konflikt zu tun hat bzw. aus ihm erwächst. Der Schutz des Kulturgutes einer Minderheit und ihre politische Partizipation seien die wichtigsten Voraussetzung für den Frieden in einem multikulturellen Staat, wobei es in Europa ja praktisch keinen nicht-multikulturellen Staat, also keinen Staat ohne ethnische Minderheiten gibt.
Sie präzisierte ferner die Aussage ihres Präsidenten zum christlichen Werthintergrund des UZF dergestalt, daß sie meinte, innerhalb der Organisation gäbe es völlige Religions- und Gewissensfreiheit; und es würde auch niemandem die Mitgliedschaft verweigert, der eine andere Weltanschauung als den römisch-katholischen Glauben hat.
Der 2.Vorsitzende Herr Botschafter Liedermann mahnte v.a. die praktische Friedensarbeit beim UZF ein, welche die Friedensforschung unbedingt ergänzen müsse, damit sie nicht nur “graue Theorie” bliebe. Praktische Friedensarbeit hat für ihn v.a. zwei Ausprägungen: Einerseits kann man in der Diplomatie viel bewegen, andererseits kann man die Öffentlichkeit für die Problematiken um Krieg und Frieden sensibilisieren. Er bestätigte, daß dies bedeute, daß die Öffentlichkeitsarbeit eine Hauptaufgabe des UZF ist und sein muß. Aus anderem Zusammenhang (u.a. von seinen Publikationen) weiß ich zudem, daß ihm die Internationalen Organisationen wie die OSZE, der Einsatz für Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Landminen wichtige Anliegen sind.
Der Kassier Herr Prof.Kaiser betonte neben vielen bereits genannten Punkten v.a. die Wichtigkeit des sparsamen bzw. effizienten Umgangs mit den vorhandenen finanziellen Ressourcen, was man dem zukünftigen Bestehen der Organisation sowie auch der Gesellschaft schuldig sei, die diese Mittel zur Verfügung stellt.
Vorstandsmitglied Herr Prof.Böhm meinte, daß die Friedensforschung dazu beitragen muß, daß bestehende Konflikte reduziert oder - wenn sie nicht vermeidbar sind - wenigstens reflektiert werden. Dies sei eine Voraussetzung dafür, daß besagte Konflikte nicht gewaltsam, sondern auf zivilisiertere Art und Weise ausgetragen werden. Zu diesem Zwecke müsse es eine Verstärkung der Forschung nach den Ursachen von Konflikten geben. In diesem Zusammenhang nannte er u.a. die allgemein anerkannten Autoren Dieter Senghaas und Otfried Höffe.
Der Schriftführer Herr Sticklberger meinte, daß der Einsatz für den Frieden für ihn v.a. eine Form von sozialem Engagement ist und einen Beitrag zum besseren Zusammenleben der Menschen darstellt.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Funktionären und Mitarbeitern des UZF entschuldigen, die ich aus Zeitgründen zu diesen Fragen nicht interviewen konnte. Diese Vorgehensweise soll nicht als Geringschätzung interpretiert werden; ich finde, daß sich natürlich auch alle anderen in die Formulierung eines Leitbildes einbringen sollen und müssen; aber eine Diplomarbeit kann ohnehin nur Vorarbeit für einen entsprechenden Prozeß leisten, der erfahrungsgemäß längere Zeit in Anspruch nimmt.
Ich habe mich aber auf jeden Fall bemüht, die Perspektiven der von mir interviewten hochrangigen Funktionäre in einem Vorschlag zu einem Unternehmensleitbild zusammenzufassen und gemeinsam mit den in den früheren Kapiteln nachzulesenden historischen Forschungsergebnissen, den teilnehmenden Beobachtungen und den von mir herausdestillierten Stärken des UZF sozusagen “unter einen Hut zu bringen”.
Das Ergebnis meiner Bemühungen sind die
“Sieben Thesen zur Corporate Identity”.
Die “Sieben Thesen” haben lediglich Vorschlagscharakter. Sie sollen, einmal in einer Rohfassung niedergeschrieben, eine interne Diskussion im UZF zu einem Leitbild in Gang setzen. Zweifellos sind sie nicht perfekt; manch einem wird noch manches einfallen, was er mir im Interview zu sagen oder ich niederzuschreiben vergaß; außerdem waren überall starke Kürzungen notwendig, wofür ich um Verständnis bitte; man kann ferner über Reihenfolge und Gewichtung der Aussagen streiten, wobei es meiner Meinung nach aber nicht darauf ankommt, wo, wie oft und wie ausführlich etwas gesagt ist, sondern darauf, daß es gesagt ist. Aus den “Sieben Thesen” kann sich vielleicht einmal ein Unternehmensleitbild entwickeln.
Die umstrittenen Fragen mußte ich natürlich ausklammern, d.h. ich habe nur dasjenige geschrieben, von dem ich zumindest glaube, daß ein breiter Konsens besteht oder bestehen könnte. Umstrittene Fragen sind: NATO oder Neutralität, Pro oder Contra EU, Friedensdialog Islam Ja oder Nein.
(Ich möchte in diesem Zusammenhang ausdrücklich betonen, daß intern nicht umstritten ist, ob “Friedensdialoge der Weltreligionen” allgemein stattfinden sollen oder nicht, sondern ob und wann sie mit dem Islam stattfinden. Es ist auch nicht umstritten, daß Internationale Organisationen im Sinne Kants, insbesonders OSZE, UNO oder Europarat, einen wertvollen Beitrag zum Frieden leisten, sondern ob NATO und EU Organisationen im Sinne Kants und des Friedens sind oder nicht, wobei es sich im Fall der EU eigentlich nicht um eine “lose” internationale, sondern in politikwissenschaftlicher Begrifflichkeit um eine “supranationale” Organisation handelt - der Unterschied liegt im höheren Grad der Integration. Diese Vorbemerkung ist wichtig, weil die Ausformulierung relativ geschickt so getroffen wurde, daß, so hoffe ich, möglichst alle mit ihr leben können und trotzdem noch eine Aussage vorhanden ist.)
Jeder Außenstehende kann sich nach Lektüre der “Sieben Thesen” ein gutes Bild von der Organisation machen, es ist eine Positionierung in der Öffentlichkeit und eine Betonung der Stärken gegenüber anderen Institutionen vorhanden. Ich habe bereits vorhandene, professionelle Unternehmensleitbilder zum Vergleich herangezogen, um gewisse formale Aspekte einzuhalten (z.B. Sprachduktus). Die “Sieben Thesen” sind aber individuell und organisationsbezogen “angefertigt”.
Ich möchte noch darauf hinweisen, daß manche Dinge, die ich geschrieben habe, über die genannten Quellen hinausgehen (z.B. die absichtlich auffällig starke Betonung der Wichtigkeit der Philosophie im Rahmen der Friedensforschung), aber keineswegs auf Willkür oder auch nur persönlicher Ansicht beruhen, sondern sehr wohl auch in anderer Hinsicht durchdacht sind; eigentlich gibt es keinen hier genannten Absatz ohne dahinterliegenden P.R.-Grund, was man bei eventuellen Änderungen berücksichtigen muß. Manches davon wird erst verständlich, wenn man die vorliegende Arbeit von Anfang bis zum Ende gelesen hat, d.h. man soll sich erst dann ein endgültiges Urteil bilden.
LEITBILD
des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF)
These 1 (Leitidee, Werte)
DIE LEITIDEE: “WAHRHEIT DES GANZEN”
FÜR DIALOG, VERSÖHNUNG, INTEGRATION, TOLERANZ, DEMOKRATIE, FRIEDEN
ZENTRALE BEDEUTUNG DER MENSCHEN- UND MINDERHEITENRECHTE
FÜR ABRÜSTUNG, GEGEN LANDMINEN
FÜR INTERNATIONALE ORGANISATIONEN
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) wurde im Jahre 1973 vom österreichischen Philosophen Leo Gabriel zum Zwecke der Verankerung der Friedensforschung an der Universität Wien gegründet, an der er u.a. als Professor und Vorstand des Instituts für Philosophie wirkte.
Die im Österreich der Zwischenkriegszeit als Kampfpositionen formulierten politischen Ideologien, die damals vorherrschende Intoleranz und die Lagerkämpfe, die das Land spalteten und schließlich in den Untergang trieben, sowie seine prinzipielle Gegnerschaft zum Nationalsozialismus brachten Leo Gabriel zur Formulierung einer Philosophie der Toleranz, der Offenheit und des Dialoges, die zur Versöhnung einstmaliger Gegner und zu einer Stärkung der Demokratie führen sollte.
Diese Philosophie, die den Titel “Wahrheit des Ganzen” trägt, ist bis heute die Leitidee des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF). Ihr Grundgedanke lautet zusammengefaßt folgendermaßen: Jeder Mensch erkennt aufgrund seiner speziellen Perspektive einen Teil der umfassenden Wahrheit; in jeder ehrlichen Überzeugung, Meinung, Weltanschauung - selbst in der prinzipiell irrenden - ist wenigstens ein kleiner Teil derselben zu finden. Die “Wahrheit des Ganzen” erkennt man durch angemessene Berücksichtigung der verschiedenen, einander zunächst widersprechenden Standpunkte und der Herbeiführung einer Synthese. Zur Erkenntnis der “Wahrheit des Ganzen” muß man offen gegenüber anderen Meinungen sein und Toleranz üben, sowie die Bereitschaft besitzen, in einen Dialog mit Andersdenkenden einzutreten. Die Integration aller Gruppen überwindet die Spaltung, entschärft die Gewalt und dient so nicht nur der Wahrheitserkenntnis, sondern auch dem Frieden.
Der Frieden ist nach Hannah Arendt ein Zweck, nicht bloßes Mittel des menschlichen Zusammenlebens. Er ist darüberhinaus ohne Zweifel wichtig für den Schutz des hohen Gutes des Lebens, auf das jeder Mensch ein Recht hat.
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) bekennt sich in diesem Zusammenhang uneingeschränkt zur Geltung der angeborenen, unveräußerlichen und unteilbaren Menschenrechte, ohne die es keinen wahren Frieden geben kann. Insbesonders die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) und die KSZE-Schlußakte von Helsinki (1975) waren Meilensteine auf dem Weg der Ausformulierung und Umsetzung dieser Idee, welche allein der Würde der menschlichen Person angemessen ist. Kein Staat kann sich auf seine Souveränität und das Prinzip der Nicht-Einmischung berufen, wenn er auf seinem Gebiet systematisch Menschenrechte verletzt und diese Verletzungen kritisiert werden.
Dauerhafter Frieden kann nur in einer gerechten Gesellschaftsordnung realisiert werden (“positiver Friedensbegriff” im Sinne Johan Galtungs). Eine Gesellschaft ist nach unserem Verständnis v.a. dann gerecht, wenn sie demokratisch ist und die besagten grundlegenden Menschenrechte respektiert.
Gegenwärtig kommt den Minderheitenrechten v.a. hinsichtlich der Entschärfung der zunehmenden ethnischen Konflikte weltweit allergrößte Bedeutung zu. Nur wenn das Kulturgut einer Minderheit geschützt ist und diese an der Politik eines Staates partizipieren darf, wird sie sich mit diesem langfristig identifizieren können. Wer Minderheiten unterdrückt und ihrer Rechte beraubt, schürt gewaltsam ausgetragene Konflikte. Wie ein Staat mit seinen Minderheiten umgeht, ist ein Indikator für seine zivilisatorische und demokratische Reife. Minderheiten sind eine kulturelle Bereicherung jedes Staates, keine Bedrohung der Mehrheit. Das UZF setzt sich ein für das friedliche und gleichberechtigte Zusammenleben der Völker ein, innerstaatlich wie international.
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) plädiert für umfassende und allseitige Abrüstung. Nach dem Ende des Kalten Krieges, in dem es v.a. um den Abbau der atomaren Waffenarsenale beider Blöcke ging, ist heute dabei insbesonders die Frage nach der Bekämpfung der Landminen in das öffentliche Bewußtsein getreten. Das UZF sieht Landminen als heimtückische Waffen an, die ohne Unterscheidung von Soldaten und Zivilisten Menschen töten oder verstümmeln; den heute nach Schätzung der UNO weltweit ca. 100 Mio. vergrabenen Landminen fallen u.a. unschuldige Kinder zum Opfer. Jede geeignete Maßnahme zur Bekämpfung dieser spätestens seit dem Vertrag von Ottawa (1997) völkerrechtswidrigen Waffe erfährt die Unterstützung des UZF.
Internationale Organisationen im Sinne von Immanuel Kants Schrift “Zum ewigen Frieden” (wie UNO, Europarat, OSZE etc.) leisten aufgrund ihres Engagements für Menschenrechte und Völkerverständigung einen unverzichtbaren Beitrag zum Frieden in Europa und der Welt. Die Gedanken Bertha von Suttners sind für das UZF ebenfalls von allergrößter Bedeutung.
These 2 (Universität, Bildung)
FORSCHUNGSSTELLE AN DER UNIVERSITÄT WIEN
BILDUNGSAUFTRAG
EINZIGE VERANKERUNG DER FRIEDENSFORSCHUNG AN EINER
ÖSTERREICHISCHEN UNIVERSITÄT
GEMEINNÜTZIGKEIT DURCH EFFIZIENZ UND SPARSAMKEIT
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) ist eine Forschungsstelle an der Universität Wien und an diese gebunden. Es ist einerseits eine Plattform, die es Professoren und Mitarbeitern der Universität Wien ermöglicht, ihre wissenschaftliche Arbeit zum Frieden zu koordinieren und ihre Forschungsergebnisse zu verbreiten. Es geht aber andererseits auch darum, Praktiker aus Politik, Diplomatie, Wirtschaft, Medien etc. sowie Interessierte aller Bereiche für die aktive Unterstützung des Friedens und der Friedensforschung zu gewinnen.
An der Universität Wien wird ein Bildungsauftrag wahrgenommen, der sich u.a. in der Organisation und Durchführung von Lehrveranstaltungen zur Friedensforschung äußert. Dies ist insbesonders deshalb wichtig, weil junge Leute, hierbei v.a. Studenten, für Themen der Friedensforschung sensibilisiert werden sollen. Die Nachwuchs- und auch die Frauenförderung sind vorrangige Anliegen des UZF.
Die Organisation ist - so der gegenwärtige Stand - einzigartig in Österreich. Sie ist die einzige Verankerung der Friedensforschung an einer staatlich anerkannten, österreichischen Universität. Die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) ist zudem landesweit die einzige wissenschaftliche Fachzeitschrift zum Fachgebiet (“Wiener Blätter zur Friedensforschung”).
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) ist eine Non-Profit-Organisation. D.h. es ist nicht auf Gewinn ausgerichtet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige Ziele. Friedensforschung (und auch Friedensarbeit) ist vorrangig soziales Engagement, das dem besseren Zusammenleben der Menschen dient - und nicht dem Gelderwerb.
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und effizienter Einsatz der vorhandenen Ressourcen haben trotz und gerade wegen der erstrebten optimalen Erreichung der gemeinnützigen Ziele allergrößte Bedeutung.
These 3 (Ethos der Forschung)
FRIEDENSFORSCHUNG AUF HÖCHSTEM WISSENSCHAFTLICHEN NIVEAU
OBJEKTIVITÄT, SERIOSITÄT, AKTUALITÄT
INTERDISZIPLINÄR UND INTERNATIONAL
ZENTRALE BEDEUTUNG DER PHILOSOPHIE
FRIEDENSFORSCHUNG ALS “ANGEWANDTE ETHIK” UND “SOZIALPHILOSOPHIE”
BEDEUTUNG DER FORSCHUNG NACH KONFLIKTURSACHEN
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) betreibt Friedens- und Konfliktforschung auf höchstem wissenschaftlichen Niveau. Das bedeutet insbesonders, daß man möglichst große Objektivität und Ausgewogenheit anstrebt und niemals die Seriosität der Forschung aufzugeben bereit ist.
Es ist gerade für eine praxisbezogene Wissenschaft wie die Friedensforschung unerläßlich, daß sie immer am Puls der Zeit bleibt und den letzten Stand der internationalen und innerstaatlichen Politik reflektiert. Die Aktualität der Forschung ist daher ein wichtiges Prinzip der Arbeit des UZF.
Internationale Kooperationen bei der Forschungsarbeit heben einerseits das wissenschaftliche Niveau und dienen andererseits ebenfalls auf ihre Art der Völkerverständigung. Die Friedensforschung ist zudem ihrem Wesen nach interdisziplinär, d.h. es müssen Wissenschaftler der unterschiedlichsten Fächer in die Arbeit des Universitätszentrums eingebunden werden.
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) ist an der “Human- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät” der Universität Wien untergebracht und berücksichtigt v.a. Methoden und Ergebnisse dieser Fächer, ohne sich deshalb anderen Ansätzen zu verschließen.
Eine besondere Bindung besteht zum Fach Philosophie; dies ist deshalb sinnvoll, weil die Geistesgeschichte eine große Fülle von Friedensdenkern aufweist, deren Erkenntnisse nutzbringend angewendet werden können. Auch der bekannte Friedensforscher Johan Galtung hebt in seinem Buch “Strukturelle Gewalt” die Bedeutung der Philosophie im interdisziplinären Fächerkanon hervor, dessen sich die Friedensforschung bedient.
Im Rahmen der Philosophie kann man Friedensforschung als einen Ansatz der Sozialphilosophie, aber auch als “Angewandte Ethik” verstehen.
Genauso wie die Medizinethik im Gesundheitsbereich, fordert die Friedensforschung Werte in der Politik ein. Durch ihre Bedeutung z.B. im den Bereichen Diplomatie und Journalismus bemüht sie sich um die Sicherung des Praxisbezuges der akademischen Ausbildung am Institut für Philosophie der Universität Wien.
Der Forschung nach den Ursachen von Konflikten kommt besondere Bedeutung zu, weil die Reflexion von Konflikten der erste Schritt zu ihrer Entschärfung ist.
These 4 (Sicherheitsbegriff)
ZIVILE ORGANISATION MIT UMFASSENDEM SICHERHEITSBEGRIFF
WEDER MILITÄRFEINDLICH, NOCH MILITÄRVERHERRLICHEND
INSTITUTIONELLE UNABHÄNGIGKEIT VOM MILITÄR
Das “Universitätszentrum zur Friedensforschung” (UZF) ist eine zivile Organisation, die einen umfassenden Sicherheitsbegriff vertritt. Neben militärischen Aspekten umfaßt dieser z.B. politische, ökologische etc. Faktoren. Die nicht-militärischen Aspekte der Sicherheit haben insoferne an Bedeutung gewonnen, weil z.B. im Falle Österreichs keine direkte und greifbare militärische Bedrohung im klassischen Sinne mehr vorliegt (z.B. drohende Invasion durch angrenzende Staaten). Den Methoden der Diplomatie kommt besondere Bedeutung bei der Lösung neuartiger Sicherheitsprobleme zu.
Das UZF ist pazifistisch, aber nicht militärfeindlich. Vielmehr werden auch hochrangige Offiziere eingeladen, im Rahmen der Veranstaltungen und Publikationen des Universitätszentrums ihre Meinungen und Einschätzungen einzubringen, was als Bereicherung empfunden wird.
Dennoch legt das UZF auf seine institutionelle Unabhängigkeit von militärischen Organisationen aller Art größten Wert und behält sich, was für eine Friedensorganisation selbstverständlich sein muß, im Falle von Mißbräuchen militärischer Macht im In- und Ausland das Recht und die prinzipielle Möglichkeit vor, diese öffentlich zu kritisieren.
These 5 (Zur Unternehmenspolitik nach innen und außen)
UNABHÄNGIGKEIT VON ALLEN POLITISCHEN PARTEIEN
IMMER INTEGRITÄT BEWAHREN
SOWOHL MEINUNGSVIELFALT, ALS AUCH STREBEN NACH KONSENS
EINHEITLICHER ÖFFENTLICHER AUFTRITT
Zu jeder Zeit bewahrt das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) seine Unabhängigkeit von sämtlichen politischen Parteien und Interessengruppen. Die Aufrechterhaltung von Autonomie ist wichtig, weil die Forscher des UZF zu jeder Zeit ihre wissenschaftliche Integrität bewahren wollen und zur Erreichung ihrer gemeinnützigen Ziele auch müssen.
Innerhalb der Organisation ist Meinungsvielfalt erwünscht. Für von der Gesamtorganisation zu treffende Entscheidungen wird umfassender Konsens angestrebt, der nicht durch Zwang und Autorität, sondern durch das Eingehen aufeinander bzw. die Einigung im Dialog zustandekommen soll. Es ist bei Bewahrung der inneren Freiheit allerdings danach zu streben, daß der Auftritt nach außen ein möglichst einheitlicher ist - ein Spannungsfeld, das es mit vereinten Anstrengungen zu bewältigen gilt.
These 6 (Praxisbezug)
PRAKTISCHE FRIEDENSARBEIT WICHTIG
EINSATZ VON DIPLOMATIE UND PUBLIC RELATIONS
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) versucht nach Kräften, seine Werte und die Ergebnisse seiner Forschung in die Praxis umzusetzen, bekennt sich also zur praktischen Friedensarbeit. Diese erfolgt einerseits im Rahmen der Diplomatie, andererseits durch aktive Öffentlichkeitsarbeit.
Im Zusammenhang mit der Diplomatie ist wichtig, daß die Vereinigung von der UNO als NGO anerkannt worden ist. Als solche versucht sie im Sinne des Friedens zu wirken. Gegenwärtig sind viele Mitarbeiter des UZF im Bereich der Diplomatie tätig, z.B. im Rahmen der OSZE, von Botschaften etc. Diese Form der praktischen Tätigkeit ist ausdrücklich erwünscht, weil sie ein Bereicherung der Arbeit des Universitätszentrums darstellt.
Öffentlichkeitsarbeit bzw. Public Relations ist eine Form von praktischer Friedensarbeit, weil durch sie eine breite Öffentlichkeit für die Ziele der Organisation sensibilisiert und gewonnen werden kann. Das “Universitätszentrum zur Friedensforschung” (UZF) bekennt sich zu einer konsequenten, professionellen, mit Offenheit, Ehrlichkeit und im Dialog mit den jeweiligen Zielgruppen geführten Public Relations. Es ist eine Hauptaufgabe der Organisation, P.R. für den Frieden und die Friedensforschung zu betreiben.
These 7 (Religion)
CHRISTLICHER WERTHINTERGRUND
ABER KEIN AUSSCHLUSS ANDERER KONFESSIONEN UND ÜBERZEUGUNGEN
RELIGIONS-, MEINUNGS- UND GEWISSENSFREIHEIT
FRIEDENSDIALOG DER WELTRELIGIONEN
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) besitzt einen christlichen Werthintergrund, nimmt aber auch Menschen anderer Konfessionen und Überzeugungen als Mitglieder auf. Innerhalb der Organisation herrscht Religions-, Meinungs- und Gewissensfreiheit; diese Werte werden vom UZF auch in der Gesellschaft eingemahnt.
Jede der großen Philosophien und Religionen enthält - im Sinne der oben skizzierten Leitidee der “Wahrheit des Ganzen” - einen individuellen und berücksichtigungswürdigen Zugang zur Wahrheit. Besonders in einer Zeit der eskalierenden Religionskonflikte sollen Anstrengungen unternommen werden, zwischen den verschiedensten Religionen, Kulturen, Meinungen, Weltanschauungen, politischen Ideologien etc. Brücken zu schlagen.
Früher, in der Zeit des Ost-West-Konfliktes, veranstaltete das Universitätszentrum “Friedensdialoge zwischen Christen und Marxisten”. Heute, nach Ende des Kalten Krieges, werden Anstrengungen der interkulturellen Mediation zur Entschärfung religiöser Konflikte immer wichtiger. Dem vom UZF veranstalteten “Friedensdialog der Weltreligionen” kommt dabei besondere Bedeutung zu. Insbesonders die großen Religionen sollten nicht so sehr auf das sie Trennende, sondern vielmehr auf das ihnen Gemeinsame reflektieren.
Es kann niemals im Sinne einer wahren Religion sein, wenn in ihrem Namen Gewalttaten begangen oder Unmenschlichkeiten gerechtfertigt werden. “Kreuzzüge”, “Heilige Kriege” und religiös bemäntelte Terroranschläge aller Art sind daher klar, eindeutig und grundsätzlich abzulehnen.
* * *
Soweit meine Überlegungen zum Leitbild, in das als Überschriften bereits die Leitsätze integriert wurden.
Als Motto des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) würde sich der einprägsame Titel der Philosophie seines Gründers Leo Gabriels förmlich anbieten:
“WAHRHEIT DES GANZEN”
Dieses Motto hat Tradition, Niveau und drückt alles aus, wofür das UZF steht und stehen kann.
Zum Corporate Design: Ein solches gibt es im gegenwärtigen UZF eigentlich gar nicht. Damit verzichtet man auf ein ungemein wertvolles Kommunikationsmittel.
Dabei ist ein Aspekt des Corporate Designs besonders defizitär: Das UZF hat kein Logo! Ein solches vergrößert aber die Wiedererkennbarkeit einer Organisation in der Öffentlichkeit; und es gibt gegenwärtig wohl kaum ein Unternehmen in Österreich, das auf diese Möglichkeit der Kommunikation verzichten würde. Von Austrian Airlines bis zu Shell, von Greenpeace bis Amnesty International, vom Souveränen Malteser Ritter-Orden bis zur Universität Wien, vom Französischen Kulturinstitut bis zur Burg Schlaining, alle haben hervorragende Logos - und das ist keine bloße Modeerscheinung, dafür gibt es gute, im obigen entsprechenden Kapitel dargestellte Gründe. Das UZF braucht aus P.R.-Perspektive unbedingt ein Logo!
Ich schlage für das Design des Logos, das letztlich, wie allgemein beim Corporate Design üblich, ein externen und professioneller Graphiker konkret gestalten wird müssen, folgende Kriterien vor, welche die Güte desselben (die v.a. aus anschaulicher Darstellung einerseits und Transportierung der Wert- und Zielvorstellungen des Unternehmens resultiert), meiner Meinung nach sicherstellen sollten:
Man sollte sich für eine “kombinierte Marke” entscheiden, in der sowohl Text-, als auch Bildelemente vorhanden sind, und zwar aus folgendem Grund: Bildelemente sind sehr einprägsam, aber ohne Text werden sie v.a. bei kleineren Organisationen oftmals falsch zugeordnet. Text allein ist, selbst wenn er ein spezielles Design aufweist, eher langweilig und die Wiedererkennung fordert höhere Aufmerksamkeit; gerade die Wiederkennung will man aber durch ein Logo erleichtern.
Das bildhafte Element sollte, wie oben besprochen, die Leitidee der Organisation - im vorliegenden Fall ist es Leo Gabriels Konzept der “Wahrheit des Ganzen” - in irgendeiner Form symbolisieren. Ich denke, daß sich dies auch deshalb anbieten würde, weil es für einen Graphiker gut umsetzbar wäre. Das “Ganze” läßt sich optimalerweise in einem Kreis darstellen, der ein uraltes Symbol für das umfassende Ganze ist. Der Sinn der Botschaft “Wahrheit des Ganzen” ist wie oben besprochen der, daß man verschiedene Standpunkte, Perspektiven, Meinungen, die alle einen Teil der “ganzen” Wahrheit darstellen, adäquat berücksichtigt, durch einen Dialog in eine Synthese bringt und zu einem “Ganzen” zusammensetzt. Um dies zu symbolisieren, könnte der Kreis (das Ganze) verschiedenste Unterteilungen (Teile) besitzen, entweder wie eine zerschnittene Torte, wie ein Puzzle oder wie ein Bild à la Pit Mondrian etc.
Welche Möglichkeit man aber letztlich auch immer wählen mag, auf jeden Fall muß es wohl von der Leitidee des UZF-Gründers sachlich vorgegeben ein “Ganzes” geben, das aus verschiedenen “Teilen” zusammengesetzt ist.
In der Mitte des Kreises, also zentral, könnte in großen Lettern und in speziellem Design “UZF” stehen. In Verbindung mit dem Logo muß auch die noch nicht allgemein geläufige Abkürzung UZF in voller Länge als “Universitätszentrum für Friedensforschung” erklärt werden.
Das Logo sollte wegen der niedrigeren Druckkosten auf schwarz-weiß angelegt sein und in diesem Druck gut aussehen, wobei es für alle Fälle, wenn sich die Finanzen in Zukunft gut entwickeln sollten, auch eine Version in Farbe geben sollte. Die Hauptfarben sollten einerseits wissenschaftliche Seriosität (nüchtern und seriös), andererseits Aktualität der Forschung (aktuell und modern) in gleichem Ausmaß betonen. Das Logo müßte bis zu einem gewissen Grad auch vergrößert bzw. verkleinert gut aussehen, was am Computer ganz leicht abgetestet werden kann.
Es ist aus juristischen Gründen sehr wichtig, sich an eventuellen Logos und anderen graphischen Darstellungen das “Recht auf wirtschaftliche Verwertung ohne zeitliche und räumliche Grenzen” - in genau dieser Formulierung - schriftlich zu sichern (das “Urheberrecht” ist rechtlich nicht übertragbar, daher sind entsprechende Verträge ungültig; bezahlt man bloß für die “Gestaltung des Logos” ist über die Erlaubnis einer Verwendung der Darstellung noch nichts ausgesagt; solche juristischen Spitzfindigkeiten werden oft von Graphikern genützt, um mehr Kapital aus dem Kunden zu schlagen). Überhaupt empfiehlt es sich, bei Verhandlungen zum Logo jene Leitfäden zu berücksichtigen, die diesbezüglich in einschlägigen P.R.-Büchern genannt sind.
3.2. Vereinheitlichung des öffentlichen Auftrittes
“Eine wichtige Aufgabe der Unternehmenskommunikation ist (...), den Prozessen der naturwüchsigen Desintegration des Unternehmensbildes (Anm. das sich die Öffentlichkeit macht, P.H.) im Sinne von Einheitlichkeit entgegenzuwirken.”
Eine Herausforderung für die Zukunft wird die Vereinheitlichung des öffentlichen Auftrittes des UZF sein, und das bei gleichzeitiger Bewahrung der inneren Meinungsfreiheit und -vielfalt. Man könnte dieses Spannungsfeld zwischen notwendiger Einheit und erwünschter Freiheit lösen, indem man in der Kommunikation nach außen ausschließlich Schwerpunkte hinsichtlich jener Themen setzt, bei denen Chancen auf breiten, internen Konsens bestehen.
Man wird aber auch zu einem gewissen einheitlichen Verfahren gelangen müssen, wie man mit strittigen Punkten in der Öffentlichkeit umgeht. Wie soll sonst sinnvoll P.R. betrieben werden? Man stelle sich vor, ein P.R.-Beauftragter müßte z.B. beim Schreiben einer Presseaussendung zu einem aktuellen Thema einander vollkommen widersprechende Meinungen berücksichtigen! Solche Situationen muß man von vornherein ausschalten.
Es ist durchaus legitim, daß es Meinungsverschiedenheiten innerhalb einer Organisation gibt, aber ich hielte es für einen Fehler, sie in die Öffentlichkeit zu tragen und über die Medien auszudiskutieren. Man muß sich auf eine Vorgangsweise einigen, wie man mit diesen Problemen umgeht, bevor man mit konsequenter Öffentlichkeitsarbeit überhaupt beginnen kann. Ich möchte dazu mögliche Lösungen für den “gordischen Knoten” der unterschiedlichen Zielvorstellungen vorschlagen.
Zur ersten Streitfrage, dem Problem “NATO oder Neutralität”, wird es auf absehbare Zeit wohl keinen Konsens unter führenden Funktionären geben. Es spricht vieles dafür, daß alle in dieser Frage der Stellungnahme des Präsidenten des UZF, Herrn Prof.Norbert Lesers, folgen sollten. Er meinte im Gespräch mit mir, es gäbe diese interne Meinungsverschiedenheit; und daher könnten er sowie alle anderen UZF-Funktionäre im Namen des Universitätszentrums eben keine Aussage zu diesem Punkt treffen, sondern sich dazu höchstens als Privatleute äußern. Er meinte auch, eine Organisation müsse ja nicht zu jedem Thema Stellung beziehen - und hier hat er aus Sichtweise der P.R. vollkommen recht. Man muß nicht “Hansdampf in allen Gassen” sein; einige Schwerpunkte reichen durchaus, um sich als unverkennbar in der Öffentlichkeit positionieren zu können.
Es stellt sich auch die Frage, ob man sich bei öffentlichen Äußerungen zu diesem parteipolitisch heftig umstrittenen Thema nicht auf jeden Fall bei zwei der vier Parlamentsparteien vollkommen unbeliebt macht und diskreditiert (egal, welche Meinung man vertritt) und ob das gewünscht bzw. riskiert werden soll. Direkt angesprochen von z.B. einem Journalisten könnte man ja im Namen der Organisation zur Not eine ausgewogene Meinung vertreten, indem man sagt, daß es Pro- und Contra-Argumente zu beiden Optionen gibt, was ja fachlich auch richtig ist; diese könnte man dann referieren.
Ansonsten bliebe noch der Ausweg, daß der jeweilige Funktionär, der Stellung bezieht, feststellt, sich zu dieser Frage nur als Privatmann bzw. als Funktionär einer anderen Organisation, nicht als UZF-Vertreter äußern zu können, verbunden mit dem Hinweis, daß das UZF genauso wie die gesamte österreichische Gesellschaft in dieser Frage eben gespalten ist, in zahllosen anderen Fragen aber natürlich Konsens besteht.
Der 1.Vorsitzende Prof.Bader, glühender Befürworter der österreichischen Neutralität, betonte mir gegenüber in einem persönlichen Gespräch am 25.10.2001, daß es im wissenschaftlichen Bereich wohl keine Denkverbote geben darf (was unbedingt richtig ist), aber er versteht, daß die Öffentlichkeitsarbeit auf Einheitlichkeit Wert legen muß. Ich sehe nicht ab, warum er sein starkes politisches Engagement für die Neutralität, wenn es von vielen UZF-Funktionären nicht in seinem Sinne mitgetragen werden kann, nicht verstärkt z.B. im Rahmen der Internationalen Bertha-von-Suttner-Friedensmission betreiben sollte, bei der er zugleich Generalsekretär ist, und sich im Rahmen des UZF nicht v.a. in optimaler Ausnutzung seiner einzigartigen Qualifikationen auf seine zahlreichen anderen Spezialgebiete, etwa die interreligiöse Vermittlung konzentrieren könnte, denen spätestens nach den Terroranschlägen in New York zentrale Bedeutung zukommt. Man muß nicht alles überall machen, sondern man kann gezielt Schwerpunkte setzen, sodaß die eigenen Überzeugungen nicht aufgegeben oder verraten werden müssen, aber trotzdem gewisse Realitäten respektiert werden. Ein Friedensdialog mit einer bestimmten oder gar mehreren Religionen ist zudem nicht nur im Rahmen eines einzigen Symposiums sinnvoll und dann niemals mehr wieder, sondern erscheint mir eher eine langfristige Lebensaufgabe im Rahmen zahlloser Forschungsgespräche und Symposien zu sein; und ehrenwert ist ein solches Friedensprojekt dazu.
Kein Konsens besteht in der Haltung zur EU. Zu diesem Problem kann man aber aus der Sichtweise der P.R., so meine ich, wirklich eindeutig Stellung nehmen. Dabei geht es überhaupt nicht um die Frage, ob die EU gut ist oder schlecht, die Kritik an ihr politisch richtig oder falsch etc., sondern nur, ob Anti-EU-Engagement aus Perspektive der P.R. im Rahmen des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) Sinn macht oder nicht.
Ich stelle fest:
1.) Es ist - historisch gesehen - nicht das ursprüngliche Anliegen des UZF, Anti-EU-Engagement zu betreiben; ich habe dafür keinerlei Anhaltspunkte in meiner Forschung gefunden. Natürlich liegt das u.a. auch daran, daß die EU eine ziemlich neue Erscheinung auf der politischen Landkarte und jünger als das UZF ist; aber auch die führenden Funktionäre der Gegenwart stehen nach meinem Eindruck alle (bis auf den 1.Vorsitzenden Prof.Bader, der die EU stark ablehnt) dem Europäischen Integrationsprozeß positiv oder zumindest ausgewogen gegenüber, d.h. anerkennen positive und negative Seiten an der EU. Der Kampf gegen die EU kann daher wohl nicht Zielsetzung des UZF sein. Wenn Anti-EU-Engagement dennoch im Rahmen des UZF betrieben wird, handelt es sich um eine Fremdbestimmung der Organisation; also um eine Zielsetzung, die “von außen” herangetragen wird und nicht mit der des UZF übereinstimmt.
2.) Entsprechend liegt, wie oben festgestellt, in dieser Frage kein einheitlicher Auftritt in der Öffentlichkeit vor. Die beiden Veranstaltungen des UZF im Sommersemester 2001 sendeten einander widersprechende Signale in die Welt: Beim Symposium wurde z.B. die EU-Kommission von UZF-Funktionären lobend erwähnt für ihr Engagement für Minderheiten. Beim Forschungsgespräch wurde die EU hingegen als “Raubritterburg” verteufelt; die Kommission wurde zudem, das muß man noch nachtragen, vom Referenten als aufgeblähter und Mißwirtschaft verschuldender Machtapparat dargestellt. Dieser widersprüchliche Auftritt ist natürlich ineffizient, was soll unter diesen Bedingungen für ein Image des UZF entstehen - außer das eines uneinigen, zerstrittenen Haufens, der nicht weiß, was er will? Hier ist, wie bereits mehrfach bemerkt, eine Lösung zu finden.
3.) Es bleibt noch ein “materialistisches” Argument, für das mich sicherlich alle “idealistischen” Philosophen des UZF rügen werden, das aber nichtsdestotrotz berücksichtigenswert ist: Eine mit der P.R. verwandte Disziplin ist das Fund Raising, eine Wissenschaft (oder Kunst?), die sich im Prinzip mit dem Finden von Subventionsgebern und Sponsoren beschäftigt. Es erscheint aus Sichtweise dieses Ansatzes nicht gerade ratsam, massive Fundamentalopposition gegen die EU zu vertreten. Auf diese Aspekte werde ich im “Schritt 3: Umsetzung” in den Kapiteln über Fund Raising noch genauer eingehen.
Ich meine daher, daß Anti-EU-Engagement im Rahmen des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) - aus P.R.-Perspektive und ohne, daß die Frage nach Richtigkeit oder Falschheit des Europäischen Integrationsprozesses überhaupt tangiert wird - keinen Platz hat. Daher schlage ich vor, daß auch alle politischen Aktivitäten in dieser Richtung eindeutig vom UZF getrennt und auch in andere Plattformen verlegt werden.
Was die dritte Streitfrage (den “Friedensdialog mit dem Islam”) betrifft, wäre es aber gut, wenn man zu einem Kompromiß finden könnte. Als einen solchen schlage ich - auch angesichts der Ereignisse in New York und der immer offener zutage tretenden Notwendigkeit von interreligiösen Vermittlungsbemühungen - vor, daß man den Dialog mit der Einschränkung zuläßt, daß die historisch vom UZF entwickelten und von mir oben dargestellten “Sieben Regeln des Friedensdialoges” strikt angewendet werden. Damit könnte man den berechtigten Sorgen wegen möglicher propagandistischer Mißbräuche des Dialoges und Verharmlosungen während der Gesprächsführung entgegenkommen, ohne den Weg der Dialogverweigerung wählen zu müssen, der einfach nicht zum Ethos des UZF, seiner Geschichte und bereits getroffenen Grundsatzentscheidungen paßt. Mit diesem historisch im “Friedensdialog zwischen Christen und Marxisten” bewährten Instrumentarium hat man schon einmal bewiesen, daß man in der Lage ist, solche Mißbräuche von vornherein einzudämmen. Man soll also meiner Ansicht nach den Dialog führen, aber man soll ihn klug führen.
Zu den anderen Facetten dieses Problems habe ich ansonsten bereits Stellung genommen.
Es sei noch hinzugefügt, daß eine Organisation, die das Image eines Vermittlers zwischen Weltreligionen anstrebt (was das UZF ja offenbar tut, denn der “Friedensdialog der Weltreligionen” ist nicht nur gegenwärtig allgemein unbestritten, sondern die Vermittlung zwischen Weltreligionen ist seit Leo Gabriel auch ein ursprüngliches Anliegen der Vereinigung), sich langfristig wohl kaum einem Gespräch mit einer der vier nicht-christlichen Weltreligionen prinzipiell verschließen wird können, ohne daß dies langfristig öffentlich als widersprüchlich wahrgenommen würde. Eine solche Wahrnehmung wäre aber eine Hypothek für die künftige Öffentlichkeitsarbeit des UZF.
In Falle einer prinzipiellen Verweigerung von Gesprächen mit Moslems kann man langfristig übrigens das Thema “Minderheitenkonflikte” auch gleich aufgeben, denn man wird sich spätestens nach den Attentaten von New York wohl kaum als Experte auf diesem Gebiet öffentlich profilieren können, wenn man den Islam nicht thematisieren und Vertreter der islamischen Gemeinde nicht einladen und um ihre Meinung fragen darf, was man schon alleine im Zuge von Recherchen aber seriöserweise tun muß.
Man kann überhaupt dann auch das Thema “Friedensforschung” aufgeben, denn es zeichnet sich immer mehr ab, daß für den Weltfrieden der Zukunft unser Verhältnis mit dem Islam entscheidend sein wird, so wie es in Zeiten des Kalten Krieges unser Verhältnis zum Kommunismus gewesen ist.
Heute als Friedensforschungsstelle nicht über den Islam zu forschen (und dies setzt zur Gewinnung seriöser Informationen u.a. voraus, daß man mit Moslems auch reden muß, schon alleine um Vorurteile und Mißverständnisse zu klären) wäre in etwa genauso absurd, wie wenn man während des Ost-West-Konfliktes nicht über den Kommunismus geforscht hätte. Man mußte damals auch mit Kommunisten reden und konnte es sich nicht aussuchen; man kann sich überhaupt im Bereich Friedensforschung und -arbeit seine Verhandlungspartner nicht immer aussuchen - ja, es ist sogar genau das Gegenteil der Fall: Man wird sogar mit Leuten verhandeln müssen, die einem möglicherweise außerordentlich unsympathisch sind.
Formulierung des P.R.-Programmes
1. Reaktive versus proaktive Strategie
Auf den Unterschied zwischen “offenen” und “geschlossenen” Systemen bin ich bereits zu sprechen gekommen. Eng damit zusammen hängt die Unterscheidung zwischen “reaktiven” und “proaktiven” P.R.-Strategien.
Komplexe und relativ offene Organisationen beobachten die Entwicklungen ihrer Umwelt; sie erkennen Trends und nehmen Veränderungen vorzeitig wahr. Dann initiieren sie Handlungen, bevor sich die Trends zu riesigen Problemen auswachsen. Eine solche Vorgangsweise ist eine “proaktive”.
Demgegenüber steht die - zumeist praktizierte - rein “reaktive” Strategien, die meist in geschlossenen Systemen zu finden sind. Kritik wird in solchen Systemen nicht zugelassen, Änderungen oder innere Reformen werden aus Dogmatismus heraus nicht getroffen, höchstens nach Ausbruch einer Katastrophe, auf die natürlich nicht vorsorglich reagiert worden ist. Typisch für eine “reaktive” Öffentlichkeitsarbeit ist, daß die P.R. nur als Verkündigung eines vorher ohne Rücksicht auf Publikumsinteressen, gesellschaftliche Veränderungen der letzten Jahrzehnte etc. festgesetzen Programmes, das niemals verändert werden darf, gesehen wird; typisch ist auch der Einsatz des Gerichtsverfahrens, um unliebsame Gegner in der Öffentlichkeit zum Schweigen zu bringen (eine Methode, die in einer Demokratie nicht wirklich funktioniert, sondern nur “böses Blut” schafft). Typisch ist auch das unausgesprochene Vorurteil, man müsse immer nur die Welt verändern, aber niemals das eigenen Unternehmen.
Die reaktiven Strategien sind den proaktiven langfristig unterlegen; Unternehmen, die sich ihnen verschreiben, sterben aus wie die Dinosaurier, die auf den Wandel ihrer Umwelt ebenfalls nur ungeeignet reagiert haben. Jedes professionelle P.R.-Konzept muß die Adaptierung proaktiver Strategien vorschlagen.
2. Innere Voraussetzungen für effiziente P.R. schaffen
Bevor Ziele nach außen verfolgt können, muß das UZF einige innere Probleme in Angriff nehmen. Dies ist die Voraussetzung für konsequente Öffentlichkeitsarbeit. Folgende leicht evaluierbare Ziele sollten für diese “Maßnahmen im Inneren” gesetzt werden.
Das UZF in seiner Gesamtheit soll danach streben, binnen vier Jahren (=zwei Vorstandsamtszeiten)...
...den Beschluß eines Frauenförderungsplanes zu treffen und den Frauenanteil im Vorstand durch Hinzunahme neuer Mitglieder von gegenwärtig 7,7% auf ca.15% zu erhöhen, was wohl auch nur ein erster Schritt sein kann.
...den Beschluß eines Nachwuchsförderungsplanes zu treffen und das Durchschnittsalter des Vorstandes durch Hinzunahme neuer Mitglieder (nicht durch Ausschluß verdienter) um mindestens fünf Jahre zu senken.
...zur Festlegung eines für alle im Rahmen ihrer UZF-Funktion Sprechende verbindlichen Unternehmensleitbildes im Konsens und innerer Meinungsfreiheit zu gelangen, wobei ich als Diskussionsgrundlage auf die “Sieben Thesen zur Corporate Identity” verweise.
...zur (am besten schriftlich fixierten) Festlegung eines Verfahrens zu gelangen, wie man mit Fragen in der Öffentlichkeit umgeht, von denen man vorher weiß, daß sie intern umstritten sind, wobei ich als Diskussionsgrundlage auf meine Anregungen aus dem vorigen Kapitel verweise.
...weitere Maßnahmen zu setzen, die geeignet sind, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter (Corporate Identity) und die Einheitlichkeit des Auftrittes nach außen wahrscheinlicher zu machen. In der vorliegenden Arbeit wurden u.a. vorgeschlagen die Implementierung eines die Leitidee der Organisation (“Wahrheit des Ganzen”) repräsentierenden Logos im Sinne eines Corporate Designs sowie die würdige Begehung des 100.Geburtsjahres des Gründers Leo Gabriel 2002, des dreißigsten Geburtsjahres des “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) 2003 und des dreißigsten Geburtsjahres der “Wiener Blätter zur Friedensforschung” 2004.
3. P.R.-Zieldefinition
Kriterien zur P.R.-Zieldefinition
Nach Cutlip, Center und Broom müssen P.R.-Ziele wissenschaftlich evaluierbar sein; nur so, meinen die Autoren, kann Erfolg oder Mißerfolg der Öffentlichkeitsarbeit seriös festgestellt werden. Daraus wiederum leiten sie die Forderung ab, P.R.-Ziele “objektiviert” zu formulieren, d.h. am besten unter Berücksichtigung eines quantitativen Indikators.
P.R.-Zielsetzungen müssen u.a. folgenden Eigenschaften genügen:
Ein zeitlicher Rahmen ihrer Erfüllung muß festgelegt werden.
Die Formulierung muß sehr konkret und nachvollziehbar sein, zudem keine bloße Tätigkeitsbeschreibung, sondern resultatsorientiert. Was will man im Endeffekt erreichen? Es gibt hier im Prinzip drei Möglichkeiten: Eine Erhöhung, eine Beibehaltung oder eine Verringerung einer Einstellung.
Das Ausmaß besagten Wandels muß quantifiziert werden.
Eine Einstellung besitzt eine kognitive (d.h. Wissens-) Dimension, ferner eine emotionale und eine auf konkrete Handlungen bezogene. Entsprechend unterscheidet man:
“Knowledge outcome”. Beispiel: Bis 1.Juli soll die Zahl der lokalen Hausbesitzer von 13% auf 27% erhöht werden, die wissen, daß Buschbrände 2.500 Häuser in den letzten drei Jahren zerstört haben.
“Predisposition outcome”. Beispiel: Bis 15.Jänner soll das Vertrauen der benachbarten Grundstücksbesitzer in die Sicherheit unserer Produkttests von einem Mittelwert auf der zur Überprüfung verwendeten fünfstufigen Skala von 2,7 auf 3,5 gesteigert werden.
“Behavorial outcome”: Innerhalb von 30 Tagen soll der prozentuelle Anteil unserer angestellten Lastkraftwagenfahrer, die während ihrer Arbeit den Sicherheitsgurt benutzen, von 51% auf 70% erhöht werden.
Probleme in der Anwendung auf das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF)
Ich verhehle nicht, daß diese zuvor genannten Anforderung an ein P.R.-Konzept mir im konkreten Fall immense Schwierigkeiten bereitet hat. Es existieren meines Wissens im UZF keinerlei sozialwissenschaftliche Daten, Untersuchungen etc. in Hinblick auf die Zielsetzung, auf die ich zurückgreifen kann. Wenn man aber den gegenwärtigen Bekanntheitsgrad der betreffenden Forschungsstelle z.B. bei Studenten eines bestimmten Faches nicht kennt, kann man nicht die von diesem Ausgangspunkt angestrebte Steigerung desselben quantifizieren; bei jeder Zielgruppe selbst Erhebungen durchzuführen hätte aber den Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit endgültig gesprengt. In Zukunft Meinungsumfragen bei allen erstrebten Zielgruppen durchzuführen wäre auch wahrscheinlich angesichts des knappen Budgets der Organisation kaum finanzierbar.
Dieses Problem der P.R.-Evaluation besteht nach Dörrbecker in der Praxis häufig. In diesem Fall geht man nach seinen Angaben folgendermaßen vor: Der P.R.-Konzeptionierer muß unter Anwendung seiner Kreativität Hilfsziele definieren, die auch quantifizierbar sind und die zumindest eine teilweise Evaluation (im Sinne von festgestellten Indizien) möglich machen. Entsprechend bin ich hier verfahren, um anschließend noch Hinweise zu geben, in welche Richtung die P.R.-Zielformulierung bei einer größeren Organisation gehen könnte.
Mit einfachen Methoden evaluierbare Hilfsziele
Das UZF in seiner Gesamtheit soll danach streben, binnen vier Jahren (=zwei Vorstandsamtszeiten)...
...die Mitgliedszahl des UZF um ein Fünftel zu erhöhen.
...die Gewinnung von mindestens zehn “strategisch wichtigen Personen” als Mitglieder des UZF zu erreichen.
...das Budget durch Fund Raising-Aktivitäten um ein Fünftel zu vergrößern. Maßnahmen zur Lukrierung einer dritten Subvention sollten zumindest versucht werden.
...den Bekanntheitsgrad des UZF unter Mitarbeitern des Instituts für Philosophie auf nahezu 100% zu erhöhen und Maßnahmen zu setzen, die geeignet sind, möglichen Imagedefiziten entgegenzuwirken.
...zu erreichen, daß mindestens 20 österreichische Journalisten verschiedenster Medien das UZF als Informationsquelle zu aktuellen Friedensthemen bei ihren Recherchen in Anspruch nehmen
...eine möglichst häufige Erwähnung des UZF in den zielgruppenadäquaten Medien zu erreichen und danach die Zahl der Nennungen durch eine Medienresonanzanalyse zu erheben. Diese letztere Formulierung ist eigentlich nicht resultatsbezogen, sondern eine bloße Tätigkeitsbeschreibung und genügt den strengen Kritierien für P.R.-Zielsetzungen daher streng genommen nicht. Dennoch sollte dieser neue Kanal aufgebaut werden, dessen konkreter Erfolg oder Nicht-Erfolg aber für mich nicht abschätzbar ist.
Möglichkeiten der Zielformulierung bei Einsatz komplexerer Evaluationsmethoden (Umfragen)
Das UZF in seiner Gesamtheit soll danach streben, binnen vier Jahren (=zwei Vorstandsamtszeiten)...
...den Bekanntheitsgrad des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) bei den jeweiligen Zielgruppen zu erhöhen. Objektiviert heißt das z.B. den Anteil jener Personen zu erhöhen, denen das UZF bekannt ist (wobei man Fragen nach dem Bekanntheitsgrad sozialwissenschaftlich “hart” oder “weich” formulieren kann; beides ist interessant).
...das - Bekanntheit voraussetzende - Image des “Universitätszentrums für Friedensforschung” zu verbessern. Objektiviert heißt das z.B., den prozentuellen Anteil jener Personen an den Zielgruppen zu erhöhen, die eine “sehr gute” oder “gute” Meinung von UZF haben. U.a. folgende Werte bzw. Eigenschaften sollten von den Befragten mit dem “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) assoziiert werden: Demokratie, Soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Toleranz, Dialogbereitschaft, Einsatz für Minderheiten, Vermittlungskompetenz.
...den Anteil jener Personen aus den Zielgruppen zu erhöhen, die bestimmten aus den P.R.-Botschaften abgeleiteten Aussagen Zustimmung entgegenbringen.
Man könnte die Gelegenheit einer Umfrage auch nutzen, um thematische Interessensschwerpunkte der einzelnen Zielgruppen aus dem Bereich Friedensforschung zu erfahren.
Definition der Zielgruppen
1. Allgemeines zur Zielgruppendefiniton
P.R.-Experten sind sich darüber einig, daß der Definition der Zielgruppen - auch Dialoggruppen oder Teilöffentlichkeiten genannt - große Bedeutung zukommt. Die Erfahrung zeigt, daß die globale Zielgruppe “alle” unzureichend ist. Mit dem unbestimmten Begriff “die größere Öffentlichkeit” ist es im Prinzip genauso. Obwohl wir im Alltag mit solchen Begriffen immer umgehen und sie wie selbstverständlich verwenden, muß man sagen, daß es die “Öffentlichkeit” streng genommen eigentlich gar nicht gibt. Es gibt im Prinzip eine große Ansammlung von Menschen (d.h. von Individuen) mit unterschiedlichen Anschauungen, Sozialisierungen, Wertvorstellungen etc., die allerdings miteinander in vielfältiger Interaktion stehen. Wenn man ein unbeschränktes Budget und grenzenlose Zeit zur Verfügung hätte, würde es sich durchaus empfehlen, alle Menschen der Welt individuell, z.B. im persönlichen Gespräch (dem effizientesten und überzeugendsten Kommunikationsmittel) anzusprechen; man könnte bei unbegrenzten Ressourcen auch für jeden Menschen ein eigenes Medium anfertigen, das ausschließlich seinen höchstpersönlichen beruflichen und privaten Informationsbedarf befriedigt - so ähnlich wie jene streng geheime Zeitung, die der CIA mit einem riesigen Mitarbeiterstab täglich exklusiv für den Präsidenten der USA anfertigt, mit am Vortag von diesem bestellten Schwerpunkt. Das ist aber natürlich wenig praktikabel. Das umgekehrte Extrem, alle verschiedenen Menschen “über einen Kamm zu scheren”, ist aber auch nicht gerade erfolgsversprechend.
In der Praxis beschreitet man einen Mittelweg: Es ist durchaus gerechtfertigt, vereinzelte strategisch wichtige Personen individuell anzusprechen, aber in der Regel wird man die Vielzahl von Menschen nach bestimmten Merkmalen zu Gruppen zusammenfassen. Diese Gruppen kann man dann mit den geeigneten Medien gezielt “anvisieren”. Ein fiktives (eher verkaufsorientiertes) Beispiel: Eine Firma, die Skateboards herstellt, will die Zielgruppe der 14-25jährigen Wiener Jugendlichen beider Geschlechter erreichen. Um dies zu schaffen, könnte sie versuchen, durch verschiedenste Werbe-, aber auch P.R.-Maßnahmen präsent zu sein in einem lokalen Jugendradiosender, z.B. Radio Energy 104,2, um ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen und ein gewisses Image zu festigen. Sendungen wie den “Seniorenklub” am ORF wird sie tendentiell weniger berücksichtigen, weil 60 bis 80-jährige in der Regel keine Skateboards für den Eigenbedarf kaufen (außer man käme in einer Meinungsumfrage dahinter, daß Skateboards als Geschenke für die Enkel vielleicht gefragt sind, dann würde es auch wiederum Sinn machen). An diesem fiktiven Beispiel kann man auch gut illustrieren, daß man je nach Zielgruppe seine eigene Botschaft hinsichtlich gewisser Schwerpunkte modifizieren wird (selbstredend, ohne sich in vollkommen widersprüchliche und einander entgegengesetzte Aussagen zu verwickeln). Ich könnte mir z.B. intuitiv vorstellen, daß man gegenüber den Jugendlichen eher die Modernität dieses Fortbewegungsmittels hervorstreicht, gegenüber Senioren das Augenmerk aber auf maximale Sicherheit für den Benutzer legt, was wichtig ist, damit sich das Kindlein nicht verletzt.
Natürlich sollte man bei Einschätzung des Lebensstils und der Vorlieben der Zielgruppen aber nicht - wie im obigen Beispiel - rein intuitiv vorgehen, sondern wissenschaftlich. D.h. idealerweise knüpft die Formulierung eines P.R.-Konzeptes an bereits vorhandene Markt- und Meinungsforschungsdaten an, die es einem ermöglichen, sich auf die betreffenden Gruppen optimal einzustellen. Außerdem ist das oben genannte Beispiel insoferne ergänzungsbedürftig, weil die P.R. nicht rein absatzorientiert vorgehen sollte, wie z.B. im Bereich Marketing, sondern zur Imagebildung auch mit Gruppen Dialog führen sollte, die für den Verkauf nicht unbedingt entscheidend sind, wohl aber für eine Imagebildung in der Öffentlichkeit.
Zielgruppen nennt man in einer alternativen Bezeichnung auch “Dialoggruppen”, um - im Sinne eines auf Dialog ausgerichteten P.R.-Modells - eben den rein instrumentellen Ansatz zu vermeiden. Auch die Bezeichnung “Teilöffentlichkeiten” hat sich eingebürgert, aufbauend auf die hier skizzierte sozialwissenschaftliche Erkenntnis, daß die Öffentlichkeit keine homogene Masse, sondern auf vielfältige Art differenziert ist.
Einige “klassische” Kriterien einer Zielgruppenerfassung im Marketingbereich stellen z.B. dar: Geschlecht, Altersgruppe, Lebensphase (z.B. junge Mütter, Senioren etc.), Wertetypologien, Information über Lebensstil, Freizeitgestaltung und Mediennutzungsverhalten, Bildungsgrad, Wohnort etc.
Nach Benno Signitzer kann man sich dem Begriff der Teilöffentlichkeit in der Public Relations nicht nur nach den genannten Kritierien, sondern auch insbesonders über das “Problembewußtsein” annähern. In Anknüpfung an Grunig und Hunt versteht er eine Teilöffentlichkeit als eine Gruppe von Menschen, die...
a.) ...“objektiv” einem ähnlichen Problem gegenübersteht,...
b.) ...“subjektiv” auch erkennt, daß dieses Problem besteht und...
c.) ...sich organisiert, um mit diesem Problem umzugehen.
Aufgrund dieser Konzepts kann man folgende Typen von Teilöffentlichkeiten unterscheiden:
Nicht-Teilöffentlichkeit. Es besteht objektiv kein Problem, die Punkte a.) bis c.) treffen nicht zu.
Latente Teilöffentlichkeit. Das Problem ist da, wird aber noch nicht erkannt, nur a.) trifft zu.
Bewußte Teilöffentlichkeit. Das vorhandene Problem wird als solches erkannt, a.) und b.) treffen also zu.
Aktive Teilöffentlichkeit. Man beginnt, sich zu organisieren, um mit dem Problem umzugehen, und zu handeln. Alle drei Punkte a.) bis c.) treffen zu.
Signitzer führt ein anschauliches Beispiel für die oben genannte Einteilung an: Nehmen wir ein Universitätsinstitut, das in finanziellen Schwierigkeiten ist und die Ausbildung der Studenten nur mehr schlecht gewährleisten kann. Die Eltern der Studenten sind von dem Problem betroffen, sind sie doch interessiert an der guten Ausbildung ihrer Kinder. Wenn sie sich aber nicht über das objektive Problem bewußt sind, dann liegt nur eine “latente Teilöffentlichkeit” vor. Wenn sie sich über das Problem bewußt werden, haben wir eine “bewußte Teilöffentlichkeit”, wenn sich die Eltern z.B. zu einer Organisation zusammenschließen, die etwas gegen den Mißstand unternimmt, existiert eine “aktive Teilöffentlichkeit”. Die P.R. hat die Aufgabe, durch Kommunikation aus der latenten eine bewußte und aus der bewußten eine aktive Teilöffentlichkeit zu machen.
Auch z.B. die Umweltbewegung hat sich nach und nach über die oben skizzierten Stufen entwickelt. Es ist wichtig, daß die P.R. solche gesellschaftlichen Trends aufspürt und sich ihrer annimmt, besonders in der prägenden Phase der ersten allgemeinen Bewußtseinswerdung des Problems; dann kann die eigene Organisation so etwas wie Meinungsführerschaft übernehmen und einen wichtigen Einfluß in der Diskussion ausüben. Die Öffentlichkeitsarbeit muß idealerweise ihrer Zeit immer ein wenig voraus sein.
Hier kann man u.a. sehen, was man im “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) z.B. zur Zeit meiner Recherchen falsch gemacht hat: Obwohl man, wie in der Situationsanalyse ausführlich beschrieben, einen Forscher hatte, der im Mai 2001 auf die zunehmenden Spannungen zwischen Westen und Islam hinwies (dies war anhand vieler Fakten belegt, die aber noch nicht in das allgemeine Bewußtsein eingetreten waren; es gab also eine latente Teilöffentlichkeit der von den Spannungen Betroffenen), griff man das Thema nicht auf, sondern lehnte es massiv ab, sich mit dem Islam in Form von Dialogen zu beschäftigen. Im September 2001 krachte ein von moslemischen Extremisten gesteuertes Flugzeug in das World Trade Center; ab diesem Zeitpunkt war der Umstand der zunehmenden Konflikte und der Notwendigkeit von Konfliktabbau praktisch jedem klar (es entstanden überall bewußte Teilöffentlichkeiten, die für das Problem sensibilisiert warten). Nach einer Auskunft vom Dezember 2001 gab es Monate später aber noch immer keine UZF-interne Einigung, ob man nun einen “Friedensdialog mit dem Islam “ abhalten sollte oder nicht, während zu diesem Zeitpunkt schon zahlreiche andere Organisation das Thema aufgegriffen hatten, zuletzt sogar die Pfarre in meiner Nachbarschaft (Uhlplatz 6, 1080 Wien) in einer Vortragsveranstaltung “Begegnungen mit dem Islam”; in besagter Pfarre sind normalerweise keine wirklichen Kompetenzen für Internationale Politik vorhanden. Es entstanden aber, wie man anhand des Beispiels illustrieren kann, in ganz Österreich aktive Teilöffentlichkeiten, die sich des Themas annahmen.
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) hätte damals nach den ihm rechtzeitig zur Verfügung stehenden Informationen seiner Zeit voraus sein und die Diskussion zum Thema vielleicht sehr prägen und beeinflussen können. Man stelle sich vor, man wäre im Mai in die Medien gegangen und hätte solche Spannungen vorausgesagt, dann sofort nach dem Anschlag Kommentare in der Öffentlichkeit abgegeben und gleich eine Veranstaltungsreihe zum Thema initiiert, als allgemein in der schweren Krise ein riesiger Informationsbedarf bestand - das wäre der Weg gewesen, um sich in der Öffentlichkeit profilieren zu können. Mittlerweile hinkt man vergleichbaren Organisation bei diesem Thema nach, das in der kurzlebigen Medienwelt langsam zum “alten Hut” wird (um freilich mit Sicherheit bald wieder aufzuflammen), trotz ursprünglichen Informationsvorsprunges, den man nicht nutzte. Das nächste Mal muß man natürlich schneller auf entsprechende Themen eingehen und diese sofort aufgreifen; man muß, um in der Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich zu sein, die Bewegungen und Trends erkennen, die sich in Politik und Gesellschaft abzeichnen, sich ehestbaldigst darauf einstellen, zahlreiche Kommunikationsmaßnahmen setzen und nach Möglichkeit mit aller Macht die Meinungsführerschaft in der Öffentlichkeit an sich reißen. Kurzum: Das UZF muß schneller, flexibler und aufgeschlossener für manche aktuellen Trends werden. Beim Aufgreifen der gegenwärtig sehr brisanten Flüchtlingsproblematik und anderer aktueller Themen ist man aber sicherlich auf dem richtigen Weg.
2. Schwäche und Stärke der Zielgruppenerfassung durch das UZF
Die bisherige Zielgruppenerfassung des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) hat aus meiner Sicht eine Schwäche und eine Stärke. Als die Schwäche sehe ich, daß ich den Eindruck habe, daß bisher keine detaillierten Überlegungen bezüglich der Kommunikation mit Zielgruppen in der Organisation vorhanden sind. Auf bereits vorhandene Markt- und Meinungsforschungsdaten bezüglich Lebensstil, Präferenzen etc. der Zielgruppen konnte ich entsprechend auch nicht zurückgreifen; solche Daten sind bei größeren Institutionen in der Regel durchaus vorhanden. Die vorliegende Diplomarbeit kann solche Daten nicht ersetzen, denn die Erforschung jeder einzelnen Zielgruppe wäre vom Aufwand her wohl eine eigene Diplomarbeit. Aufgrund dieser schlimmen Ausgangslage, die auch mit den beschränkten Finanzen der Organisation zu tun hat, sind meine Möglichkeiten hinsichtlich der Bestimmung und Abgrenzung der einzelnen Zielgruppen bzw. der Ausarbeitung konkreter Pläne ihrer Ansprache naturgemäß von vornherein beschränkt, was aber nicht heißt, daß nicht doch einige Erkenntnisse möglich sind.
Es gibt aus meiner Sichtweise aber auch eine Stärke im bisherigen Umgang mit seinen Zielgruppen: Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) ließ in der Vergangenheit durch seine Taten erkennen, daß eine grundlegende Erkenntnis der P.R. schon lange praktiziert wird, nämlich die “zweistufige Kommunikation”, die letztendlich auf die Ideen des Wiener Sozialforschers Paul Lazarsfeld zurückgeht. Diese folgt folgendem Grundgedanken: Es gibt gewisse Personen, die in der jeweiligen Zielgruppe eine hervorragende Stellung genießen. Diese Personen werden heute u.a. in drei Gruppen unterschieden:
Opinion Leaders. Dies sind Personen, “auf die man hört”, und zwar in ihrem Wirkungsfeld. Ein Primararzt ist z.B. Opinion Leader in seiner Abteilung, ein Nationalratsabgeordneter in seiner Partei, ein Universitätsprofessor an seinem Institut etc. Man kann ein Opinion Leader aufgrund der hohen Stellung sein, die man in einem sozialen System bekleidet, aber auch aufgrund der eigenen Persönlichkeit oder Fachkompetenz; Mischformen sind häufig.
Multiplikatoren. Dies sind Personen, deren Job darin besteht, Informationen zu verbreiten. Das typische Beispiel dafür sind v.a. Journalisten, aber durchaus auch Universitätsprofessoren, Lehrer etc.
Fashion Leaders. Diese dritte Gruppe, auch “Neophile” oder “Trendsetter” genannt, lieben das Neue um des Neuen willen. Sie wenden sich dem Neuen sehr schnell zu, z.B. im Bereich Mode.
Da man nicht alle Personen einer Zielgruppe ansprechen kann, greift man sich, so die Idee der “zweistufigen Kommunikation”, gerade diese strategisch wichtigen Personen heraus und spricht sie an. Dann verläßt man darauf, daß diese Personen in ihrem Wirkungsfeld die Botschaft weiterkommunizieren. Man kann auf diese Art über wenige ganz wichtige Menschen viele andere erreichen.
Die erwähnte Gruppe der “Fashion Leaders” hat nach meiner Einschätzung nicht die vorrangige Bedeutung für eine universitäre Friedensforschungsstelle (sondern eher für Modehäuser), aber die ersten beiden Gruppen sind sehr wichtig. Man bemüht sich im “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) seit jeher z.B. “Opinion Leaders” zum Fachgebiet anzusprechen, etwa Professoren, Diplomaten etc. Das Modell “zweistufige Kommunikation”, einer Kommunikation, die sich zuerst an Eliten wendet und durch diese Eliten in einer “zweiten Stufe” an einen größeren Kreis an Rezipienten, ist auch deshalb für das UZF wichtig, weil es die Natur einer universitären Einrichtung verlangt, Inhalte auf gewissem Niveau von sich zu geben, d.h. man kann keine Konzessionen im Verstoß gegen wissenschaftliche Standards machen, nur um bei der breiten Masse anzukommen (was nicht heißt, daß man sich nicht um ansprechende und möglichst allgemein verständliche Präsentation bemüht und bemühen sollte).
Ich möchte zwei Beispiele aus der Vergangenheit anführen, wo “Opinion Leaders” und “Multiplikatoren” erfolgreich angesprochen wurden, was Vorbildcharakter für die Zukunft haben sollte. Im Jahre 1996 wurde ein Symposium mit dem Titel “Bosnien-Herzegowina - quo vadis? Entwicklung nach dem Friedensabschluß nach Dayton” unter Verantwortung der Generalsekretärin Frau Hofrat Pöllinger veranstaltet; man konnte dabei die Teilnahme der Botschafterin von Bosnien in Österreich erreichen - also eines außerordentlich hochrangigen und angesehenen “Opinion Leaders” im Bereich Diplomatie. Ein Beispiel für die gelungene Ansprache von Multiplikatoren lag beim letzten Symposium über Minderheiten im Mai 2001 vor, als u.a. der Schriftführer Herr Sticklberger vor dem Kongreß wichtige Zeitungsredaktion angeschrieben hatte; tatsächlich kam ein Journalist, der an relevanter Stelle im “Kurier” einen Bericht verfaßte. Man sollte nach Kräften danach streben, solche Erfolge nach Möglichkeit zu wiederholen und zu intensivieren.
3. Versuch einer vorläufigen Zielgruppendefinition
Um mich einer Bestimmung der Zielgruppen für das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) anzunähern, entnahm ich eine Liste mit möglichen Zielgruppen aus einem P.R.-Lehrbuch und versuchte sie vor dem Hintergrund meiner Recherchergebnisse und in Hinblick auf die Erfordernisse des UZF zu modifizieren. Aufgrund des bereits besprochenen mangelhaften Vorliegens bisheriger Überlegungen sowie sozialwissenschaftlicher Daten aller Art kann die Ausarbeitung im Rahmen der Möglichkeiten dieser Diplomarbeit nicht perfekt sein, aber sehr wohl als Ausgangspunkt für weitere Forschungen und Diskussionen dienen. Die Liste ist zudem aufgrund der Tatsache, daß mir nicht alle internen Daten zur Verfügung standen, eher allgemein und muß noch weiter ausdifferenziert werden, z.B. um anzuführende genaue und konkrete Personen, Institutionen etc. inklusive Kontaktadressen.
Mitglieder. Dies ist im Prinzip die wichtigste Zielgruppe für die “interne Kommunikation” des UZF. Sie ist genau umgrenzt und auch von den Adressen her bekannt.
Verbände, Interessensvertretungen etc. Auch diese sind als Dialog- und Kooperationspartner interessant, v.a wenn sie auf einem ähnlichen Feld (Friedensbewegung) arbeiten.
Institute und Organisationen (v.a. mit wissenschaftlichem Charakter). Das UZF besitzt zahlreiche Kontakte zu wissenschaftlichen Forschungsinstitutionen im In- und Ausland, v.a. im universitären Rahmen. Diese sollten gepflegt, erweitert und vertieft werden.
Religionsgemeinschaften. Besonders interessant in Hinblick auf den “Friedensdialog der Weltreligionen” sind natürlich Kontakte zu Religionsgemeinschaften bzw. an Religion interessierten Menschen. Das Spektrum reicht von der Katholischen Kirche (Pfarren, Orden, vielleicht sogar Bischöfe) über die evangelische und die orthodoxe Kirche und ihr nahestehenden Institutionen bis hin zu hinduistischen, buddhistischen, islamischen und jüdischen Kultureinrichtungen und Glaubensgemeinschaften. Auch an Religion allgemein interessierte Menschen sind als Zielgruppe interessant; man könnte sie auch vielleicht über Presse- und Medienarbeit ansprechen (z.B. Kirchenzeitungen, Pfarrblätter, katholische Nachrichtenagenturen wie die Kathpress, Mitarbeiterzeitungen von Orden, aber auch Informationsblättern anderer Religionsgemeinschaften, Sendungen wie “Religion aktuell” auf Ö1, der kirchliche Wiener Lokalradiosender “Stephansdom”).
Opinion Leaders. Wie oben besprochen, kommt der “zweistufigen Kommunikation” und hierbei der Erreichung von “Opinion Leaders” im Bereich Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Diplomatie etc. große Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist die eigene diplomatische Tätigkeit z.B. im Rahmen der OSZE wichtig, wo man persönliche Kontakte knüpfen kann. Neben den persönlichen Kontakten, dem Aufbau einer Adressenliste und der Versendung von Einladungen zu Veranstaltungen, der wissenschaftlichen Zeitschrift etc. sehe ich auch eine Möglichkeit der Ansprache in Presse- und Medienarbeit in “elitären” Spezialpublikationen (vom Newsletter der OSZE bis hin zum Cercle Diplomatique).
Universität (Professoren, Studenten). Hier liegt eine ganz wichtige Zielgruppe, weil es den UZF als wissenschaftliche Institution ja v.a. darum geht, Informationen auf hohem Niveau zu verbreiten und an der wissenschaftlichen Diskussion teilzuhaben. Professoren, aber auch Studenten verschiedenster Fächer sind daher eine naheliegende Zielgruppe. Worin die Bedeutung von Professoren als gleichermaßen Opinion Leaders und Multiplikatoren liegt, braucht nicht erklärt werden. Aber auch Studenten kommt eine gewisse Bedeutung zu: Ist doch fast jeder, der später in eine Entscheidungsposition kommt, irgendwann in seinem Leben Student gewesen; es wäre sicherlich nicht schlecht, wenn sich jeder dieser künftigen Entscheidungsträger einmal einige Zeit lang mit dem Frieden beschäftigt hätte. Folgende Studienrichtungen sind für die Friedensforschung besonders wichtig: Philosophie, Politikwissenschaft, Soziologie, Völkerrecht, Psychologie, Geschichte, etc.
Multiplikatoren, v.a. Journalisten. Diese wichtige Zielgruppe darf in keinem Konzept der Öffentlichkeitsarbeit fehlen; ich werde auf die zahlreichen noch ungenutzten Möglichkeiten der Presse- und Medienarbeit für das UZF zu sprechen kommen. Man sollte sich in etwa an folgende Redaktionen wenden (die genaue redaktionelle Einteilung ist selbstredend in jedem Betrieb anders): Außenpolitik, Innenpolitik, Wissenschaft und ferner, wenn - wie beim ORF - vorhanden, Religion. Es kommen folgende Medien in Frage: Tages- und Wochenzeitungen, Nachrichtenmagazine, Nachrichtenagenturen, Fernseh- und Radiosender etc.
Nachbarn und Anrainer. Hier haben meiner Ansicht nach v.a. die Mitarbeiter des Instituts für Philosophie Bedeutung, die dem UZF Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.
Politische Gruppierungen. Kontakte mit Politikern aller im Parlament vertretener Parteien könnten sich als nützlich für die Organisation erweisen.
Mitbewerber. Auch Kontakte zu anderen Friedensorganisationen können gepflegt werden; man kann auch hier durch Vernetzungen und Kooperationen aller Art gewinnen.
Private Sponsoren. Auch um private Sponsoren (z.B. Banken) sollte man sich intensiv kümmern und sie über die eigenen Aktivitäten auf dem laufenden halten.
Ämter und Behörden. Der Kontakt ist v.a. deshalb wichtig, weil sich das UZF u.a. über Subventionen finanziert. Kontakte zu Subventionsgebern sollten intensiv gepflegt und neue erschlossen werden.
Positionierung und Botschaften
Die Positionierung ist die Art und Weise, wie sich ein Unternehmen seinen Kernzielgruppen nach innen und außen darstellt bzw. darzustellen versucht. Im Prinzip ist es das “Wunsch-Image” eines Unternehmens.
P.R.-Botschaften fassen den inhaltlichen Kern der strategischen P.R.-Konzeption zusammen. Sie sagen, welche Inhalte bei den Dialoggruppen ankommen müssen, damit die Ziele der Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden. Diese Botschaften sind es, die nach der Kommunikation “in den Köpfen der Dialogpersonen sitzen soll”.
Im Prinzip ist dies alles ausführlich in der Ausarbeitung des Unternehmensleitbildes besprochen. Aber es soll nochmals “verdichtet” werden (die vorliegende Arbeit kann als ständiger Prozeß der “Verdichtung” aufgefaßt werden. In den Lehrbüchern ist diese Methode vergesehen: Alle Fakten sammeln und dann in mehreren gedanklichen Schritten die wesentlichen Elemente herauszudestillieren).
Ich schlage nochmals folgende Kurzfassung zunächst zur Positionierung des Unternehmens in der Öffentlichkeit vor:
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) ist österreichweit die einzige Friedensforschungsstelle an einer staatlich anerkannten Universität. Als solche bemüht sie sich um Friedensforschung auf höchstem akademischen Niveau, bei Wahrung der drei Grundprinzipien seiner Forschung: Objektivität, Seriosität, Aktualität. Die Idee des Dialoges zwischen verfeindeten Gruppen ist äußerst wichtig, u.a. auch im Anschluß an das Werk seines Gründers Leo Gabriels, eines berühmten Wiener Philosophen. Das UZF entwickelte in der Vergangenheit durch seine Friedensdialoge eine in Österreich einzigartige Vermittlungskompetenz. Die Vereinigung steht darüberhinaus für Demokratie, Soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Toleranz, Dialogbereitschaft und Einsatz für Minderheiten.
Die Botschaften stellen sich meiner Ansicht nach u.a. folgendermaßen dar (kein Anspruch auf Vollständigkeit, Vorschlagscharakter):
LANDMINEN
Landminen sind heimtückische Waffen, die ohne Unterscheidung von Soldaten und Zivilisten Menschen töten oder verstümmeln; den heute nach Schätzung der UNO weltweit ca. 100 Mio. vergrabenen Landminen fallen u.a. unschuldige Kinder zum Opfer. Jede geeignete Maßnahme zur Bekämpfung dieser spätestens seit dem Vertrag von Ottawa (1997) völkerrechtswidrigen Waffe erfährt die Unterstützung des UZF.
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN
Internationale Organisationen im Sinne von Immanuel Kants Schrift “Zum ewigen Frieden” (wie UNO, Europarat, OSZE etc.) leisten aufgrund ihres Engagements für Menschenrechte und Völkerverständigung einen unverzichtbaren Beitrag zum Frieden in Europa und der Welt. Ihre Erforschung ist wesentliche Aufgabe des UZF.
KRISENHERD BALKAN
Der Balkan - schon im ersten Weltkrieg “Pulverfaß Europas” - ist Ende der neunziger Jahre durch den Ausbruch blutiger Bürgerkriege nach dem Zerfall Jugoslawiens in das öffentliche Bewußtsein getreten. Es ist eine wichtige Aufgabe der Friedensforschung, die Entwicklungen am Balkan zu verfolgen. Ziel jedes Stabilisierungsversuches und jeder politisches Lösung der dortigen Konflikte muß das friedliche, multikulturelle Zusammenleben der dortigen Völker sein.
MINDERHEITENKONFLIKTE
Gegenwärtig kommt den Minderheitenrechten v.a. hinsichtlich der Entschärfung der zunehmenden ethnischen Konflikte weltweit allergrößte Bedeutung zu. Nur wenn das Kulturgut einer Minderheit geschützt ist und diese an der Politik eines Staates partizipieren darf, wird sie sich mit diesem langfristig identifizieren können. Wer Minderheiten unterdrückt und ihrer Rechte beraubt, schürt gewaltsam ausgetragene Konflikte. Wie ein Staat mit seinen Minderheiten umgeht, ist ein Indikator für seine zivilisatorische und demokratische Reife. Minderheiten sind eine kulturelle Bereicherung jedes Staates, keine Bedrohung der Mehrheit. Das UZF setzt sich ein für das friedliche und gleichberechtigte Zusammenleben der Völker ein, innerstaatlich wie international.
FRIEDENSDIALOG DER WELTRELIGIONEN
Jede der großen Philosophien und Religionen enthält einen individuellen und berücksichtigungswürdigen Zugang zur Wahrheit. Besonders in einer Zeit der eskalierenden Religionskonflikte sollen Anstrengungen unternommen werden, zwischen den verschiedensten Religionen, Kulturen, Meinungen, Weltanschauungen, politischen Ideologien etc. Brücken zu schlagen. Die Weltreligionen sollten auf das ihnen Gemeinsame reflektieren und sich in Friedensdialogen näherkommen. Religiös motivierte Gewalt ist abzulehnen.
Schritt 3:
Umsetzung
1. Strategie geht vor Taktik
Schon zu Beginn der Arbeit habe ich auf die Unterscheidung zwischen Strategie und Taktik hingewiesen. Die Strategie handelt von den Zwecken bzw. Werten und Zielen einer Vereinigung, die Taktik von den Mitteln der Umsetzung. Das Verhältnis zwischen beiden ist eines der Über- bzw. Unterordnung, d.h. die Taktik bleibt immer von der Strategie abhängig und muß diese lediglich umsetzen. Es ist nach Dörrbecker daher gerechtfertigt, in einem P.R.-Konzept der Strategie wesentlich mehr Raum einzuräumen als der Taktik, weil diese erst aus der Strategie ihre Zielrichtung un Legitimation gewinnt. Tatsächlich bin ich auch im vorliegenden Fall der Meinung, daß die größten Defizite der Öffentlichkeitsarbeit des UZF hinsichtlich Strategiebildung bestehen, während die taktischen Maßnahmen (Fachzeitschrift, Kongresse) oftmals äußerst professionell gehandhabt werden, worauf auch die in der vorliegenden Arbeit vorhandene “Kommunikationsprüfung” hinweist. Dennoch sollen im vorliegenden P.R.-Konzept auch Überlegungen zu taktischen Maßnahmen entfaltet werden.
2. Veranstaltungen
Die Veranstaltungskompetenz im “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) schätze ich - auf aufgrund der bereits vorhandenene jahrzehntelangen Erfahrungen im Kongreßmanagement - als groß ein. Gegenwärtig finden jährlich ein bis zwei größere Symposien zur Friedensforschung an der Universität Wien statt, die danach publizistisch in der Fachzeitschrift aufgearbeitet werden. Ich sehe keinen Grund, warum man diese bewährte Praxis ändern sollte; wenn die Vorbereitung der ein bis zwei Symposien wirklich gründlich und intensiv ist, erscheint auch eine geringe Zahl gerechtfertigt.
Die Zahl der Forschungsgespräche im Rahmen der Lehrveranstaltungen und der Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirates könnte nach meinem Dafürhalten aber relativ leicht vergrößert werden (die Organisationsarbeit für ein Forschungsgespräch ist nicht allzu groß; die Zahl von bloß einem Forschungsgespräch im Sommersemester 2001 halte ich daher für steigerungsfähig). Besagte Veranstaltungen können auch dazu beitragen, den wissenschaftlichen Austausch in der Vereinigung zu beleben.
3. Presse- und Medienarbeit
Leitlinien professioneller Presse- und Medienarbeit
Nach Franz Bogner muß man bei der Aufbereitung der den Medien angebotenen Informationen u.a. nach folgenden Leitlinien vorgehen.
Personalisieren. Medien und Medienkonsumenten lieben Geschichten, die nicht nur an Themen, sondern auch an Personen “aufgehängt” sind. Wenn man z.B. über die Kurdenproblematik berichtet, kann man dies anhand eines ausgewählten Einzelschicksals viel anschaulicher tun als in abstrakten Erörterungen historischer und politischer Konstellationen. Man sollte daher auch immer solche Infos bereitstellen.
Visualisieren. Bilder und visuelle Hilfsmittel können auch dazu beitragen, eine Information anschaulicher darzustellen.
Regionalisieren. Die lokalen bzw. regionalen Medien dürfen nicht gering geschätzt werden; oftmals besitzen Leser, Seher, Hörer eine enge Bindung zu diesen. Die Öffentlichkeitsarbeit sollte dem Medientrend der stärkeren Regionalisierung folgen - u.a. auch, weil es oftmals leichter ist, in diesem Bereich journalistische Ansprechpartner zu finden.
Problematisieren. Mut zum Anpacken “heißer” Probleme ist gefragt und lockt Journalisten an. Diese Themen sollten nicht aus “Feigheit” ausgespart, sondern bewußt gesucht werden, auch auf die Gefahr der Polarisierung hin. Ich möchte hinzufügen, daß eine öffentliche Stellungnahme zu nicht-kontroversiellen bzw. nicht-heiklen Themen fast schon absurd ist, weil sie niemanden interessiert.
Emanzipieren. Es empfiehlt sich ein Blick über den “eigenen Gartenzaun” bei der Wahl der kommunizierten Inhalte, um Medien effizient anzusprechen. Die neuen Büroräumlichkeiten der Firma, und seien sie noch so schön, interessieren einen Journalisten zumeist nicht. Es sollten Trends und Problematiken von allgemeinem Interesse angesprochen werden.
Simplifizieren. Themen und Botschaften müssen stark vereinfacht und in verständliche Worte gekleidet werden; der Journalist, selbst nicht immer Fachmann im Bereich der Organisation des Öffentlichkeitsarbeiters, kann noch weniger bei seinem Publikum umfangreiches Fachwissen voraussetzen.
Exemplarisieren. Schwierige Zusammenhänge können anhand von einfachen Beispiel anschaulich erklärt werden und kommen dann beim Rezipienten besser an.
Aktualisieren. Journalisten sind v.a. an aktuellen Themen interessiert. Man muß bei dem, was man zu sagen hat, daher einen aktuellen Bezug herstellen bzw. solche Themen wählen, bei denen die Aktualität offensichtlich ist.
Emotionalisieren. Themen, die unter die Haut gehen, betroffen machen (z.B. arme Kinder als Landminenopfer) etc., finden bei Journalisten besondere Aufmerksamkeit, weil emotionale Betroffenheit bei Lesern, Sehern und Hörern Mediennachfrage auslöst.
Anwendung auf das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF). Prinzipiell denke ich, daß vom Themenbereich Friedensforschung her ein großes Potential für Presse- und Medienarbeit besteht. Die Forschung ist aktuell, polarisiert oft; zudem sind viele Themen emotional besetzt (z.B. Landminen, Minderheiten). Die Organisation beschäftigt sich auch nicht nur mit Themen die sie selbst betreffen (so wie manche Profit-Betriebe, die nur ihr neues Firmengelände oder ihren neuen Maschinenpark vorstellen wollen), sondern mit den allgemeinen Trends der “großen, weiten Welt”.
Ich denke, dies werden auch die Gründe gewesen sein, warum man auf dem letzten Minderheiten-Symposium Journalisten einer wichtigen Tageszeitung anlocken konnte. Diese Aspekte müssen weiter ausgebaut werden.
Zum Umgang mit Journalisten
Im Umgang mit Journalisten werden von Unternehmen meist zwei simple Fehler begangen. Entweder, man ist (auch aufgrund negativer und meist ungerechtfertigter Vorurteile gegen die Zunft oder schlechten Erfahrungen mit einzelnen) besonders ablehnend und herablassend; daß eine solche Grundhaltung dem Wunsch nach Publizität eher im Wege steht, braucht nicht näher erläutert zu werden. Oder, das ist die andere Möglichkeit, es wird ein fast schon “speichelleckerisches” und übermäßig zuvorkommendes Verhalten an den Tag gelegt. Natürlich spricht nichts gegen Höflichkeit und Freundlichkeit, aber auch zur Übertreibung besteht keine Veranlassung. Die Beziehung zwischen professioneller Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus ist die eines “Geschäfts”; dieses lautet: Information gegen Publizität. Das Unternehmen bietet den Medien Informationen an, z.B. über das Medium einer Aussendung, einer Veranstaltung etc. Der Journalist ist hingegen auf der Suche nach Information, die er weiterkommunizieren kann; wenn ihm die angebotenen Informationen für seine Bedürfnisse (bzw. die Bedürnisse seiner Leser, Hörer, Seher) brauchbar erscheinen, übernimmt er sie, sonst nicht; kein Journalist übernimmt Informationen aus reiner Gefälligkeit, z.B. aus Liebe zum jeweiligen Unternehmen. Daher sollte man auch auf die mediengerechte Aufbereitung der eigenen Informationen großes Augenmerk legen, um jenes zu bekommen, was wiederum der Journalist bieten kann: Wertvolle Publizität in einem Medium und damit eine Möglichkeit, über das Medium viele Menschen mit der eigenen Organisation und ihrer Politik bekannt zu machen.
Auf journalistische Fehlleistungen sollte man in der Regel v.a. mit Gelassenheit reagieren, denn sie beruhen erfahrungsgemäß zu weit mehr als 90% auf Mißverständnissen, nicht auf bösem Willen. Entsprechend sollte man - obwohl das Mediengesetz diese Möglichkeit zur Verfügung hält - nicht sofort mit Gegendarstellungen und Verfahren vor Gericht reagieren, wenn ein berichteter Inhalt nicht dem eigenen Geschmack entspricht. Vielmehr kann oft ein “Gentleman’s Agreement” erreicht werden nach dem Motto: Im nächsten Artikel wird die Fehlinformation richtiggestellt etc. Klagen und Gegendarstellungen erzeugen in der ganzen Redaktion meist “böses Blut” und verhindern den Aufbau langfristiger Beziehungen zum gegenseitigen Vorteil. (In diesem Punkt sind die Juristen und die P.R.-Manager eines Betriebes übrigens - wie so oft - meist völlig verschiedener Meinung. Der Umgang mit Medien über die Rechtsanwälte deutet aber auf jeden Fall auf eine defizitäre Öffentlichkeitsarbeit hin).
Interview
Einige Grundregeln des guten Interviews lauten u.a. (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
Es sollte eine gute Vorbereitung geben; man sollte sich u.a. vorher überlegen, welche Fragen (auch heikle, kritische Fragen etc.) gestellt werden könnten. Man kann von einem seriösen Journalisten nicht verlangen, alle Fragen vorher ohne Ausnahme schriftlich einzureichen (das wird dieser als Angriff auf die Pressefreiheit und seine berufliche Integrität empfinden), aber man kann vorher ungefähre Richtlinien und Schwerpunkte erfragen. Dies liegt auch im Vorteil des Interviewers, trifft er dann doch auf einen besser vorbereiteteren und damit kompetenteren Gesprächspartner.
Es ist keineswegs unbillig, Informationen über den Interviewer einzuholen (frühere Sendungen bzw. Artikel, welches Medium, Stellung in der Redaktion, Interessensschwerpunkte).
Fremdworte sollen möglichst nicht verwendet werden, wenn doch, muß man sie sofort erklären. Man muß ohne Unwillensäußerung akzeptieren, daß weder der Journalist, noch der Leser über ein Fachwissen verfügen, daß dem eigenen im jeweiligen Spezialgebiet genau gleichkommt, und daher geduldig erklären. Grundlegende und vielleicht trivial erscheinende Verständnisfragen des Journalisten sind kein Zeichen von Bosheit, auf die man mit Unwillen reagieren sollte, sondern Teil des journalistischen Berufes.
Besonders im Fernseh- oder Radiointerview sollten ausschließlich kurze und prägnante Sätze fallen, die nicht sinnwidrig geschnitten werden können. Man muß bedenken, daß in elektronischen Medien die Sendezeit sehr kurz ist und durchaus ein mehrstündiges Interview auf wenige Sätze gekürzt werden kann. Jeder Satz muß für sich selbst stehen können.
Journalisten suchen in Interviews nach knappen, kurzen, griffigen “Sagern”, die besonders einprägsam sind. Man soll diesem Bedürfnis - auf überlegte Art, d.h. ohne sich dabei selbst zu schaden - entgegenkommen.
Man soll immer ruhig bleiben und sympathisch, auch bei kritischen und unangenehmen Fragen; in der Frage bzw. in Feststellungen des Journalisten enthaltene Irrtümer oder gar Angriffe kann man dennoch auf souveräne Art richtigstellen (“Ja, das ist Ihre Sichtweise, aber in Wahrheit verhält es sich folgendermaßen...” etc.)
Von völlig absurden und unüblichen Forderungen (z.B. eine Zensur des Artikels vor Abdruck zu verlangen, was ein Journalist nur als Angriff auf seine persönliche Integrität empfinden kann und ablehnen wird), sollte man absehen. Diese Idee ist im UZF, wie ich anhand gewisser Ansinnen in Bezug auf die vorliegende Diplomarbeit weiß, nicht unbeliebt; man wird sie sich im Umgang mit Profis aber rasch abgewöhnen müssen.
Presseaussendung
Die mit Abstand beliebteste, einfachste und auch billigste Form, mit einer Botschaft an die Medien heranzutreten, ist der Weg über die sogenannte “Presseaussendung”. Im Prinzip handelt es sich dabei nur um einen Zettel, gefüllt mit professionell aufbereiteter Information. Das Problem der Presseaussendung ist einzig, daß ein ungeheurer Konkurrenzdruck vorhanden ist: Auf dem Schreibtisch eines Redakteurs landen in der Regel täglich dutzende bis hunderte Presseaussendungen zu den verschiedensten Themen; mehr als einen kurzen Blick als erste Sichtung darf man sich nicht erwarten. Umso wichtiger ist es, die formalen Kriterien für die Gestaltung professioneller Presseaussendungen zu erfüllen, um die Abdruckwahrscheinlichkeit zu erhöhen.
Zunächst sollte man bei der Themenwahl die im vorigen Abschnitt skizzierten Leitlinien beachten. Besonders wichtig dabei ist, daß man nicht nur Themen wählen sollte, die den Firmenchef interessieren, sondern solche, die die Öffentlichkeit interessieren. Es besteht in der Praxis die Gefahr, daß P.R.-Beauftragte aus Angst vor Autorität des Chefs wider besseres Wissen ungeeignete Themen wählen, um intern zu gefallen, was aber dem Unternehmen schadet. Man sollte in das Amt eines P.R.-Managers zum Wohle des Gesamtunternehmens daher keinen Jasager einsetzen, sondern jemanden, der sich auch darauf hinzuweisen traut, daß ein gewisses Thema ungeeignet ist, wenn es ungeeignet ist.
Die Presseaussendung muß spezifisch für die betreffenden Medien gestaltet sein; eine Wirtschaftszeitung interessieren selbstredend andere Themen als ein Kulturblatt etc.; dies ist das Problem der richtigen Verteilung.
Eine Presseaussendung sollte zudem nicht länger als eine Seite sein; mehr eignet sich zum Abdruck in einer Zeitung ohnehin schwer und mehr wird auch nicht von den mit Arbeit überlasteten Journalisten gelesen. Die Aussendung sollte nach Möglichkeit ohne großartige Änderungen und Umarbeitungen in die Zeitung übernommen werden können, d.h. sie sollte entsprechend in einem journalistischen Stil abgefaßt sein. Das bedeutet, daß man nicht die Sprache der Werbung, bestehend aus übertriebenen Superlativen und flotten Sprüchen verwendet, sondern eine nüchterne Sprache der Sachlichkeit, die das Bedürfnis des Journalisten und der Öffentlichkeit nach Information befriedigt. D.h. man schreibt in der Presseaussendung über die eigene Organisation wie über einen Dritten; man erwähnt sie ferner natürlich namentlich, widmet sich aber v.a. dem Inhalt. Kein ernstzunehmender Journalist gibt sich dazu her, reine Werbebotschaften abzudrucken.
Journalistischer Stil bedeutet aber auch folgendes: Ein Journalist folgt in der Abfassung eines Zeitungstextes in der Regel gewissen Kriterien, die im Rahmen jeder Journalistenausbildung nicht ohne Grund vermittelt werden. Heutige Leser sind sehr flüchtig, “springen” von einem Artikel zum anderen; darum stehen die wichtigsten Informationen eines Zeitungsartikel immer kurzgefaßt am Beginn. Der erste Absatz, am besten der erste Satz (so lernt jeder Journalist zu Beginn seiner Ausbildung), muß die fünf “W-Fragen” beantworten (Wer? Was? Wann? Wie? Wo?). Der erste Absatz enthält die Kernbotschaft, ist eine Zusammenfassung des Artikels, der sich nach unten inhaltlich ins Detail verbreitet. Man muß bei Gestaltung einer Presseaussendung diesem journalistischen Stil folgen, um Umarbeitungen unnötig zu machen.
Fremdworte und Fachausdrücke sind zu vermeiden; wo es nicht anders geht, sind sie sofort zu erklären. Ein Auszug aus einer besonders schlecht gemachten Presseaussendung aus der Praxis (Firma Chipcom, ein deutsches Computerunternehmen) soll demonstrieren, wie man es in Hinblick auf Fachausdrücke nicht machen sollte:
“Die Chipcom Deutschland GmbH nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal an der deutschen CeBIT teil und wird die weltgrößte Computermesse zur Vorstellung maßgeblicher Neuheiten nützen. Der Netzwerkhersteller zeigt am Stand F08 in Halle 14 erstmals seine neuen ONcore High-End-Hubs. Die Produkte bieten als technisches Novum unter anderem Port-Switching-Funktionalität für Ethernet und Token Ring-Netze. Ein entsprechendes Port-Switching für FDDI-Netze soll noch in diesem Jahr folgen. Weiterhin werden am Stand von Chipcom mit dem Galactica Network-Switching-Hub und dem StarBridge Turbo-Network-Switch die neuen Packet-Switching-Produkte zu sehen sein. Neue Module für den Online-Systemkonzentrator wie das 3174-Einschubmodell oder die jüngst angekündigte 10BASE-FB-Familie für Glaserfaser-Ethernet runden das Ausstellungsprogramm des Hub-Herstellers ab.”
Jede Presseaussendung sollte zudem einen ansprechenden Titel (eine Schlagzeile) enthalten, die einerseits ein wenig “reißerisch” ist, andererseits auch den Inhalt der Aussendung wirklich klar und eindeutig erklärt. Eine gute Schlagzeile einer Presseaussendung macht es wahrscheinlicher, daß sie im Konkurrenzkampf auf den Tischen der Redaktion überlebt. Wichtig ist auch, daß am Ende jeder Presseaussendung eine Kontaktadresse für Rückfragen steht.
Anwendung auf das Universitätszentrum für Friedensforschung (UZF). Es wäre überlegenswert, das Instrument der Presseaussendung zu benutzen, um in regelmäßigen Kommentaren zu aktuellen Vorfällen aus der Perspektive der Friedensforschung an die Öffentlichkeit heranzutreten.
Pressemappe
Die Pressemappe - meist als ergänzende Unterlage zur Pressekonferenz sinnvoll, aber auch bei anderen Veranstaltungen einsetzbar - ist eine Mappe, gefüllt mit spezifisch an die Zielgruppe Journalist gerichteter Information. Sie stellt ein Service für Journalisten dar. In dieser kann u.a. enthalten sein:
Ein Blatt mit den Namen und der Funktion jener Personen, die am Podium sitzen.
Eine Kurzfassung des bei der Veranstaltung vermittelten Grundgedankens, aufbereitet nach journalistischen Kriterien (danach meist als Presseaussendung an die nicht-anwesenden Medienvertreter verschickt)
Ergänzende Informationen zum Thema
Ein Fact Sheet mit den wichtigsten Unternehmensdaten, vielleicht auch das Unternehmensleitbild
Kontakt bzw. Ansprechpartner für Journalistenrückfragen
Wenn vorhanden: Pressephotos, Broschüren über das Unternehmen etc.
Pressekonferenz
Der ideale Zeitpunkt zur Abhaltung einer Pressekonferenz liegt zwischen 9 und 10 Uhr am Vormittag; vorher wird man entweder alleine im Raum sitzen oder einem verschlafen dreinblickenden Journalistengrüppchen entgegenblicken; Pressekonferenzen am Nachmittag sind in der Regel unüblich, weil sie mit dem Redaktionsschluß kollidieren können. Für den Ablauf einer Pressekonferenz haben sich gewisse Regeln eingebürgert: Ein Moderator (meist der P.R.-Manager) eröffnet die Veranstaltung, begrüßt die Gäste und stellt die Referenten (meist hochrangige Mitarbeiter des Unternehmens) vor. Die Zahl der Referenten liegt üblicherweise zwischen zwei bis vier. Diese halten ein kurzes Statement von jeweils fünf bis fünfzehn Minuten, und zwar natürlich in freier Rede und unterstützt durch visuelle Hilfen (Overhead, Computerprojektion etc.). Insgesamt kann eine Pressekonferenz in einer Stunde erledigt werden; mehr ist aufgrund des dichtgedrängten Terminplanes der Journalisten nicht praktikabel. Die einleitenden Statements sollten in der Gesamtheit nicht die Hälfte der zur Verfügung stehenden Zeit überschreiten. Der Rest der Zeit sollte für Journalistenfragen reserviert sein. Buffet und Pressegeschenke sind Serviceleistungen, die nicht unbedingt notwendig sind; wichtig ist v.a. die präsentierte Information. Unterlagen (Pressemappe) sollten verfügbar sein; der Konferenz sollte auch eine Aussendung an nicht-anwesende Medienvertreter mit der Basisinformation folgen. Eine gute Organisation, die meist viele Wochen in Anspruch nimmt, ist genauso für eine Pressekonferenz wesentlich wie ein bequem erreichbarer Ort, meist im Stadtzentrum.
Die Einladung sollte auf jeden Fall folgende Aspekte beinhalten:
Ort und Zeit der Veranstaltung
Ein grober Abriß des behandelten Themas in wenigen Sätzen (Keine Romane; Journalisten stehen unter Zeitdruck)
Die Nennung der wichtigen Ansprechpartner
Kontaktadresse für Rückfragen
Ansonsten sollte sie möglichst knapp gehalten werden (eine Seite sollte auf keinen Fall überschritten werden) und dennoch freundlich sein. “Nachfassen”, d.h. eine Erinnerung der Eingeladenen ca.1-3 Tage vor der Veranstaltung per Telefon, Fax oder e-mail kann die Teilnehmerzahl nachweislich stark erhöhen.
Anwendung auf das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF). Das Instrument der Pressekonferenz eignet sich meiner Ansicht nach (noch) nicht für das UZF. Pressekonferenzen sind mit großem Organisationsaufwand verbunden, der nur berechtigt ist, wenn man vorher sicher weiß, daß auch wirklich Journalisten kommen. Es gibt Institutionen (wie z.B. wichtige Ministerien, riesige Unternehmen), die sich eines solchen Interesses schon fast gewiß sein können; das UZF muß sich erst einen wirklich umfassenden Namen machen, bevor es meiner Ansicht nach wagen kann, Pressekonferenzen abzuhalten. Pressefahrten im Sinne von Betriebsbesuchen etc. sind natürlich auch nicht anwendbar; die wenigen Büroräumlichkeiten sind nicht sonderlich interessant. Aber zu den Veranstaltungen (d.h. Symposien, Forschungsgesprächen etc.) sollten auf jeden Fall alle wichtigen Redaktionen angeschrieben werden; dies wurde beim Symposium über Minderheiten im Mai 2001 z.B. mit Erfolg praktiziert.
Medienanfrage
Medienanfragen sind Anfragen der Journalisten an das Unternehmen aus eigener Initiative heraus. Wenn sich ein Unternehmen einen Namen gemacht hat als Auskunfts- und Informationsgeber an die Medien, braucht es um geringe Publizität nicht zu bangen; eine Profilierung ist in dieser Hinsicht aber nicht leicht. Prinzipiell sollte im Unternehmen klar sein, wer - je nach Spezialgebiet - Fragen zu welchen Themen beantwortet; dies sollte auch vorher festgelegt werden. Zudem ist eine rasche Beantwortung wichtig: Journalisten müssen aufgrund ihrer Arbeitssituation den Redaktionsschluß beachten; es ist eine Deadline, nach der nichts mehr geht. Man muß sich nach dieser Zeit erkundigen und die Informationen bis zu diesem Zeitpunkt auch wirklich zur Verfügung stellen. Medienanfragen haben absolute Priorität vor anderen Aktivitäten (z.B. Sitzungen etc.) zu geben; der Zeitdruck, unter dem Journalisten stehen, ist enorm; zu späte Information ist zu spät.
Anwendung auf das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF). Wenn ein österreichischer Journalist Informationen zur wirtschaftlichen Konjunkturentwicklung sucht, denkt er reflexartig an das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO); geht es um das Budget, ist z.B. das Institut für höhere Studien (IHS) beliebter Auskunftsgeber. Ziel einer Presse- und Medienarbeit des “Universitätszentrums für Friedensforschung” muß es sein, dem UZF das Image eines professionellen Auskunftgebers zu Friedens- und Konfliktforschungsthemen (bzw. bestimmten Schwerpunkten wie Minderheiten, Landminen etc.) bei der Zielgruppe Journalist zu erarbeiten.
Zu diesem Zwecke wäre es überlegenswert, ein Medien-Informationsservice zu gründen, das in der Lage ist, Medienanfragen im Zuge von Recherchen zu verschiedensten Themen zu beantworten. Zu diesem Zweck scheint es aber zunächst einmal notwendig, Strukturen aufzubauen, die eine ständige Erreichbarkeit von Experten gewährleisten sowie zu einer internen Festlegung zu gelangen, wer im Falle von Medienanfragen zu welchen Themen antworten kann.
Presseverteiler
Der Presseverteiler ist eine Liste, auf der Adressen von Journalisten bzw. Redaktionen stehen. Diese Liste ist die Grundlage der verschickten Aussendungen, Einladungen etc. Regelmäßige Wartung des Verteilers ist wichtig, um ständige Aktualität zu gewährleisten. Der Aufbau eines zuverlässigen Presseverteilers ist eine Hauptaufgabe professioneller Presse- und Medienarbeit. Ausgangspunkt für einen Presseverteiler sind Publikationen wie z.B. das Pressehandbuch oder der Österreichische Journalistenindex, Veröffentlichungen von Landesregierungen zur Medienlandschaft etc. Ein wesentlicher Teil wird darüberhinaus durch die laufenden Kontakte ergänzt bzw. erarbeitet. Für die P.R. einer Organisation ist der gute Presseverteiler fast lebenswichtig. Neben den großen Redaktionen sollten die fachspezifischen Spezialpublikationen nicht unberücksichtigt bleiben. Sie eignen sich gut, eine bestimmte Zielgruppe punktgenau zu erfassen, an die man sonst niemals herankäme.
Anwendung auf das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF). Der Ausgangspunkt für einen Presseverteiler kann im UZF u.a. das eigene Archiv sein. Die Organisation unterhält nämlich zahlreiche Kontakte zu anderen Forschungsinstitutionen und bezieht, wie ich in den Expertengesprächen erfuhr, viele Medien zum Fachgebiet im Austausch für die “Wiener Blätter zur Friedensforschung”, die dann im Archiv abgelegt werden. Ich wollte mir über diese Kontakte einen Eindruck verschaffen.
Aus diesem Grund recherchierte ich Ende Sommersemester 2001 mit Unterstützung von Herrn Sticklberger, Schriftführer des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF), im Archiv des UZF im Neuen Institutsgebäude der Universität Wien (3.Stock) nach jenen Zeitschriften, mit denen ein Austausch mit einem Abonnement der “Wiener Blätter zur Friedensforschung” besteht. Bei der Suche wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:
Der Austausch sollte aktuell sein, d.h. wirklich in der Gegenwart stattfinden, nicht bloß irgendwann einmal stattgefunden haben. D.h. es ging um den momentanen Stand, von dem ich mir ein ungefähres Bild machen wollte.
Es sollten Zeitschriften bzw. Newsletter sein (d.h. mehrmalige Erscheinungsweise pro Jahr), Jahrbücher etc. wurden nicht berücksichtigt.
Die Erhebung sollte - möglichst - vollständig sein
Im folgenden gebe ich eine Liste jener Publikationen wieder, auf die wir stießen; es kann selbstredend keine Garantie einer totalen Vollständigkeit gegeben werden, denn man kann immer etwas übersehen. Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) erhält auch manche Publikationen als (meist unregelmäßig zugesandte) Freiexemplare ohne Austausch; jene versuchten wir auszuschließen, wobei manchmal Unsicherheiten entstanden; im Zweifelsfall wurden die betreffenden Publikationen aber aufgenommen. Die folgende Liste, welche die Namen der Zeitschriften, der dahinterstehenden Institutionen sowie das Land widergibt, demonstriert sehr anschaulich, in welch regem wissenschaftlichen Austausch mit einschlägigen Institutionen und Medien im Bereich Diplomatie und Friedensforschung bzw. -bewegung das UZF steht.
In Wahrheit geht es mir aber weniger darum, sondern um P.R.-Kontakte, weswegen einzelne Fehler auch nicht ins Gewicht fallen: Die vorliegende Liste ist, wie oben erläutert, möglicherweise ein erster Anknüpfungspunkt für künftige Presse- und Medienarbeit, die sich an eine speziell an Internationaler Politik interessierte Zielgruppen wenden will.
Zeitschrift - Organisation - Land
Illustrierte Neue Welt - - Österreich
Austria Today - - Österreich
Europa-Forum Wien - - Österreich
Unsere Sicherheit Europa - Österreichisches Institut für Europäische Sicherheitspolitik - Österreich
United Nations Chronicle - Vereinte Nationen - USA u.a.
Choices , The Human Development Magazine -Vereinte Nationen, insbes. Entwicklungsprogramm (UNDP) - USA u.a.
BFHI-News (The Baby-Friendly Hospital Initiative Newsletter) - Vereinte Nationen, insbes. Kinderhilfswerk (UNICEF) - USA u.a.
First Call for Children - Vereinte Nationen, insbes. Kinderhilfswerk (UNICEF) - USA u.a.
UNESCO-Sources - Vereinte Nationen, insbes. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) - Frankreich u.a.
Flüchtlinge - Vereinte Nationen, insbes. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) - Deutschland
UNESCO News - Vereinte Nationen, insbes. UNESCO -USA u.a.
IAEA News - Vereinte Nationen, insbes. International Atomic Energy Agency - Österreich u.a.
Forum du désarmement - Vereinte Nationen, insbes.Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le Désarmement (UNIDIR) - Schweiz u.a.
UNIDIR Newsletter - Vereinte Nationen, inbes. UNIDIR - Schweiz u.a.
Society - Vereinte Nationen - Österreich u.a.
DPI-Update - Vereinte Nationen, insbes. United Nations Departement of Public Information (DPI) - USA u.a.
Development Update - Vereinte Nationen, insbes. DPI - USA u.a.
Dispatches - Vereinte Nationen, insbes. United Nations Population Fund (UNFPA) - USA u.a.
Go Between - Vereinte Nationen, insbes. United Nations Non-Governmental Liaision Service (NGLS) - USA u.a.
NGO Reporter - Vereinte Nationen, NGO Executive Committee - USA u.a.
OSCE Newsletter - Organisation für Sicherheit Österreich und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) - Österreich
International Peace Research Newsletter - International Peace Research Association (IPRA) - Indien u.a.
Aufbrüche - Impulse aus dem gewaltfreien Kampf in Lateinamerika -Internationaler Versöhnungsbund - Österreich
Spinnrad, Forum für aktive Gewaltfreiheit -Internationaler Versöhnungsbund - Österreich
Mc Nair Paper - Institute for National Strategic Studies, National Defense University Washington D.C. - USA
Strategic Forum - Institute for National Strategic Studies, National Defense University Washingtion D.C. - USA
Prime - International Peace Research Institute Meigaku - Japan
Special Report - United States Institute of Peace Washington D.C. - USA
Peace Watch - United States Institute of Peace Washington D.C. - USA
Mitteilungen des IWK - Institut für Wissenschaft und Kunst (IWK) - Österreich
Christen in Not - - Österreich
Hiroshima Research News - Hiroshima Peace Institute - Japan
OSI aktuell - Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut - Österreich
Dialogue - Centre for Philosophical Research of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina and International Peace Center Sarajevo - Bosnien
The Bridging Tree - Lifebridge Foundation - USA
ICAR Newsletter- Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR), George Mason University in Fairfax, Virginia - USA
IDM aktuell - Institut für den Donauraum und Mitteleuropa - Österreich
ÖGLS - Österreichische Gesellschaft für Landesverteidung und Sicherheitspolitik - Österreich
Occasional Papers - Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR), George Mason University in Fairfax, Virginia - USA
Informationen der Gesellschaft für politische Aufklärung - Gesellschaft für politische Aufklärung - Österreich
politique étrangère - Institut francais des relations internationales - Frankreich
liberal aktuell - Club unabhängiger Liberaler - Österreich
Kultur Austausch - Institut für Auslandsbeziehungen Stuttgart - Deutschland
Eurasian Studies - Turkish International Cooperation Agency - Türkei
Adelphi Papers - International Institute for Strategic Studies - Großbritannien
Survival - International Institute for Strategic Studies - Großbritannien
katholisch aktuell - Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände Österreichs (AKV) - Österreich
Croatian International Relations Review - - Kroatien
IFK news - Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK) - Österreich
Cercle Diplomatique - - Österreich
The Korean Journal of Defense Analysis -Korea Institute for Defense Analysis - Korea
Zürcher Beiträge - Eidgenössische Technische Hochschule Zürich - Schweiz
The University Life - Kyung Hee University - Korea
Presseinformation von SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) - Schweden
S+F (Vierteljahresschrift für Sicherheit und Frieden) - - Deutschland
Neue Argumente - Arbeitsgemeinschaft Nein zur Atomenergie, Ja zur Umwelt - Österreich
AFB-Info - Arbeitsstelle Friedensforschung Bonn - Deutschland
Taipeh heute - - Taiwan
Taipei Journal - Government Information Office of the Republic of China on Taiwan - Taiwan
International Journal of Peace Studies - Formosa College - Taiwan
Newsletter - Departement of Peace Studies, University of Bradford - Großbritannien
AGEMUS Nachrichten - Arbeitsgemeinschaft Evolution, Menschheitszukunft und Sinnfragen - Österreich
Rostocker Philosophische Manuskripte - Universität Rostock - Deutschland
ÖMZ (Österreichische Militärische Zeitschrift) - Landesverteidigungsakademie - Österreich
Informationen zur Sicherheitspolitik - Landesverteidigungsakademie - Österreich
World Cititzen News - - USA
friedensforum - Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung - Österreich
Friedensforschung aktuell - Hessische Stiftung für Friedens und Konfliktforschung (HSFK) - Deutschland
Südwind - Das Magazin für Entwicklungspolitik - Österreich
alpe adria - Alpen Adria Friedensbewegung - Österreich
One Country - Bahá’i International Community - USA
report - Internationales Konversionszentrum Bonn -Deutschland
Österreichische außenpolitische Dokumentation -Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten - Österreich
Arbeitspapier des OIIP - Österreichisches Institut für Internationale Politik - Österreich
Chaillot Papers - Institute for Security Studies, Western European Union (WEU) - Frankreich u.a.
guernica - Friedenswerkstatt Linz - Österreich
Gesellschaft und Politik - Dr.Karl Kummer-Institut für Sozialreform, Sozial- und Wirtschaftspolitik - Österreich
Nod and Conversion - Copenhagen Peace Research Institute - Dänemark
Religion in Eastern Europe - Christians Associated for Relations with Eastern Europe - USA
GLV (geistige Landesverteidigung) - Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Österreich
New Routes (Journal of Peace Research and Action) -Life and Peace Institute - Schweden
Peace Work - American Friends Service Committe - USA
Die Dritte Welt - Arbeitsgemeinschaft Entwicklungshilfe und Flüchtlingshilfe der Katholischen Aktion der Erzdiözese Wien - Österreich
stimmen zur zeit - Österreichischer Friedensrat - Österreich
Review of International Affairs - Federal Public Institution (FPI) International Politics - Jugoslawien
Programme for Promoting Nuclear Non-Proliferation (PPNN) - Mountbatten Center for International Studies, University of Southhampton - Großbritannien
Basicreports - British American Security Information Council - Großbritannien
Eurobalkans - - Griechenland
Europa Magazin - Forum für direkte Demokratie (EU-kritisch, sozial, ökologisch) - Schweiz
Info Euro - Europäische Kommission bzw. Amt für amtliche Veröffentlichung der Europäischen Gemeinschaften - Luxemburg
EU direkt - Europäische Kommission - Österreich u.a.
EurOp News - Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften - Luxemburg
Nachrichtenagenturen
Nachrichtenagenturen sammeln Nachrichten aus aller Welt, bereiten die Informationen auf und stellen sie Medien zur Verfügung. Von Nachrichtenagenturen aufgenommene Informationen haben gute Chancen, auch tatsächlich in den Medien zu erscheinen, daher ist es für die Öffentlichkeitsarbeit wichtig, u.a. Agenturen anzusprechen. Bei diesem Unterfangen kommen Nachrichtenagenturen Unternehmen entgegen, weil sie sich international bereits von ihrer hier beschriebenen, klassischen Aufgabe emanzipiert und längst neue Geschäftsbereiche erschlossen haben. Das typische Beispiel für diesen internationalen Trend ist die Austria Presse Agentur (APA), Österreichs führende Nachrichtenagentur, die als Genossenschaftseinrichtungen von fast allen Tageszeitungen und auch vom ORF getragen wird. Unter dem Dach der APA firmiert eine breite Palette von interaktiven Dienstleistungsangeboten an die Medien, die auch Firmen in Anspruch nehmen können.
So gibt es neben dem APA-Basisdienst, der täglich ca. 500 Meldungen für die Medien bereitstellt (diese Meldungen gehen v.a. auf aktive Eigenrecherchen der APA-Mitarbeiter zurück). Es gibt aber z.B. auch das Angebot des Originaltext-Service (OTS). Es handelt sich dabei um ein Kommunikationsmedium zur Verbreitung von Informationen in Eigendarstellung. Unter Eigenverantwortung des Aussenders gehen Texte, Bilder, Graphiken oder Audio-Files online an Redaktionen und maßgebliche Stellen aus Politik und Wirtschaft. Zusätzlich dazu bietet die APA noch zahlreiche andere für die Öffentlichkeitsarbeit nutzbare Dienste an.
Anwendung auf das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF). Es sollte geprüft werden, ob eine Inanspruchnahme des OTS möglich bzw. finanzierbar ist; es wäre damit ein wichtiges Instrument der Presse- und Medienarbeit erschlossen, über das man Vorankündigungen zu Veranstaltungen, aber auch aktuelle Kommentare zur Internationalen Politik verbreiten könnte.
4. Kooperationen
Ich denke, daß es gerade auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit zu einer engen Kooperation mit der Gesamtuniversität kommen könnte und sollte. Bekanntlich hat die Universität Wien ja ein “Zentrum für Forschungsförderung, Drittmittel und Öffentlichkeitsarbeit”. Es würde ich empfehlen, daß einmal über Möglichkeiten der Vernetzung Verhandlungen geführt würden. Über eine solche Kooperation, die auf gegenseitigem Vorteil beruhen muß, könnte die Universität Wien einerseits ein zusätzliches Angebot in ihr P.R.-Spektrum aufnehmen und in eine einheitliche Kommunikationsstrategie eingliedern. Sie könnte über die Erhöhung des Bekanntheitsgrades des UZF auch selbst ständig im Gespräch sein. Außerdem wären Vernetzungen zwischen der Zeitschrift “Die Universität” und den “Wiener Blättern zur Friedensforschung” eine Art “cross-promotion” mit nicht zu unterschätzendem Werbewert für beide Seiten. Die Universität Wien hat mit der ihr eigenen Friedensforschungsstelle “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) aber auch eine große Stärke gegenüber anderen Universitäten, weil das UZF die einzige Verankerung für Friedens- und Konfliktforschung an einer österreichischen Universität ist und zudem ein modernes Fachgebiet mit großem Praxisbezug - diese Stärke könnte die Universität Wien ständig betonen.
Das UZF könnte über diese Kooperation auch (vielleicht, wenn vorhanden) an einen OTS-Anschluß und / oder einen Anschluß an einen guten Presseverteiler herankommen oder über Vermittlung (und bei Abgabe eines gewissen Anteils der vermittelten Drittmittel an die Gesamtuniversität) den einen oder anderen Sponsor finden, z.B. eine Religionsgemeinschaft, die an der Abhaltung eines Friedensdialoges der Weltreligionen interessiert ist; zwei soziale Gruppierungen, die zerstritten sind und einen kompetenten Mediator oder ein Friedensforschungsgutachten suchen, eine Automobilfirma, die in einer Diplomatenzeitschrift inserieren will und dabei eine kleine, aber interessante Zielgruppe erreichen will etc. Es muß in diesem Zusammenhang betont werden, daß man sich mit der Gesamtuniversität nur vernetzen und kooperieren sollte; man sollte eine individuelle Öffentlichkeitsarbeit dennoch beibehalten; denn ein “Einheitsbrei” in der P.R. bringt gar nichts, wohl aber Beziehungen zum gegenseitigen Vorteil.
5. Fund Raising
Fund Raising (Gegenteil: Sponsoring) ist jene Tätigkeit, die sich der Lukrierung von Sponsorgeldern und Subventionen widmet. Diese Disziplin ist mit der P.R. eng verwandt und hat gerade in Non-Profit-Organisationen allergrößte Bedeutung. Auch für das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) ist Fund Raising für seine Zukunft entscheidend.
Es kann nicht Sinn der vorliegenden Arbeit sein, eine vollständige Darlegung des Feldes des Fund Raising abzugeben. Aber wenn ein wesentlicher Grundgedanke des effizienten Fund Raising im “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) Einzug hält, ist meiner Meinung nach schon viel gewonnen.
Dieser Grundgedanke lautet folgendermaßen: Es gibt einen Unterschied zwischen einem “Mäzen” und einem “Sponsor”, ersterer Typus ist im Aussterben begriffen. Ein Mäzen ist ein Privatmann, der aus Überzeugung und uneigennützig etwa die Friedensidee unterstützt. Wenn Botschafter Liedermann z.B. eine größere Spende an das UZF ergehen läßt, wie er es lobenswerterweise schon getan hat, ist er ein Mäzen - er tut es uneigennützig, weil er an die Sache glaubt. Ein Sponsor hingegen, und mit Mäzenen allein wird man keine Non-Profit-Organisation finanzieren können, will etwas für sein Geld. Sponsoring-Aktivität muß für ihn auch ökonomisch Sinn machen, d.h. er erwirbt etwas, z.B. Publizität, Kontakte, Gegenleistungen etc. Diese in der Praxis immer mehr “professionalisierte” und “ökonomisierte” Sichtweise von Sponsoring hat den Vorteil, daß eine gemeinnützige Organisation sich bei Vorsprache bei Sponsoren nicht als bloßer Bittsteller zu fühlen braucht, bringt aber den Nachteil mit sich, daß sie für Sponsoren auch attraktiv sein muß. Es ist wichtig, sich zu überlegen: Was kann meine Organisation einem Sponsor eigentlich bieten?
Diese Frage versuchte ich stellvertretend für das UZF möglichst kreativ zu beantworten und kam dabei auf folgende Ergebnisse, die wiederum nur Vorschlagscharakter besitzen:
Publizität in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift zur Friedensforschung, die zwar nur eine kleine verbreitete Auflage (ca.500 Stück) besitzt, aber dafür ein kaufkräftiges Publikum erreicht (Diplomaten, Universitätsprofessoren etc.). Dieses Publikum wäre als Zielgruppe tatsächlich nicht uninteressant. Die Werbewirtschaft sucht heutzutage nicht mehr unbedingt nach bloßen Massenblättern, die nur Bezieher geringer Einkommen erreichen, sondern Spezialpublikationen mit kleiner Auflage, über die man aber eine vermögende Zielgruppe (in diesem Fall 100% A-Schicht) möglichst ohne Streuverluste erreichen kann. Werbung für folgende Produktangebote ist daher nach meinem Dafürhalten über das Medium der “Wiener Blätter zur Friedensforschung” besonders geeignet: Banken (Geldanlage), Versicherungen (Pensionsvorsorge etc.), Immobilien, teure Autos, Luxusartikel (Uhren, Schmuck etc.), Kunsthandel, standesgemäße Büroausstattung, Kongreßzentren - aber auch alle anderen Unternehmen, Verbände etc., die eine “elitäre” Zielgruppe erreichen wollen.
Auch Sicherheitsdienste, Fabrikanten von Sicherheitsschlössern etc. erscheinen mir als Kunden durchaus sinnvoll, weil ich davon ausgehe, daß sich vorrangig solche Leute mit Sicherheitspolitik beschäftigen, die für Sicherheitsprobleme aller Art sensibilisiert sind. Entsprechend könnte auch für Banken und Versicherungen ratsam sein, das Thema “finanzielle Sicherheit” in den Mittelpunkt ihrer Annoncen in den “Wiener Blätter zur Friedensforschung” zu stellen. Einen Präzendenzfall für einen inserierenden Sicherheitsdienst gibt es schon, nämlich die “Erste Wiener Wach- und Schließgesellschaft”, die in der Nr.66 ihren Revierstreifendienst bewarb.
Publizität bei Veranstaltungen. Auch bei Veranstaltungen (z.B. Symposien) kann eine gewisse Publizität gewährleistet werden; Nennungen von Sponsoren auf Einladungen, Aushängen oder bei der Einleitung zum Kongreß sind z.B. möglich.
Sehr klug und unaufdringlich ist man im UZF in diesem Zusammenhang verfahren bei Veranstaltung des “Landminen”-Symposiums. In der darüber berichtenden Nummer der “Wiener Blätter zur Friedensforschung” konnte man die Minenräumungsfirma Schiebel Electronics als Inserenten gewinnen. Man gewährte einem Experten der Firma auch Publizität beim entsprechenden Kongreß, wo er einen Vortrag zur Minenräumung hielt und dadurch gezielt Interessierte zum Thema, auch Diplomaten in Entscheidungspositionen etc., mit sachlichen Informationen zu Minenräumung erreichen konnte. Das ist ein erfolgsversprechendes Modell für die Zukunft - Chancen auf sachliche Informationsweitergabe, nicht den wissenschaftlichen Rahmen sprengend, aber dennoch nicht ohne Effizienz.
Man soll sich also vor jeder Veranstaltung (die natürlich prinzipiell aus anderen, nämlich aus Friedensforschungsgründen initiiert werden muß) u.a. auch fragen: Wer könnte ein Interesse daran haben, die geplante Veranstaltung zu sponsern?
Man soll dabei auf jeden Fall kreativ sein, denn oft können fast schon “witzige”, aber auch naheliegende Situationen entstehen. So wurde eine äußerst erfolgreiche Ausstellung des Museums für Völkerkunde in Wien über “Eskimos” mit einem relevanten Betrag gesponsert von einem gleichnamen Produzenten von Tiefkühlkost aller Art, der dafür Werbefläche im Museum selbst, Redezeit bei der Eröffnung, eine große Menge an Freikarten zur Hebung der Mitarbeitermotivation, Erwähnung in den Presseaussendungen und Plakaten etc. erhielt.
Einbau der Förderung des Friedens in das P.R.-Programm des Sponsors. Das Potential des Fund Raising für Friedens halte ich für nicht allzu groß; es ist sicher wesentlich kleiner als jenes für den Sport. Das liegt u.a. auch daran, weil die breite Masse in der Regel Sportveranstaltungen mit größerem Interesse verfolgen als Friedenskongresse, wobei sich natürlich die Frage stellt, was objektiv wichtiger ist..
Ich könnte mir aber vorstellen, daß es möglicherweise Organisationen gibt, die sich das Image eines Förderers von Frieden, Internationalität, Völkerverständigung etc. erwerben wollen - mir fällt spontan z.B. die Firma Benetton ein, die ununterbrochen auf Plakaten damit wirbt, mit ihrer Kleidung völkerverbindend und multikulturell zu wirken (“United Colours of Benetton”). Man könnte solchen und ähnlichen Unternehmen vielleicht die Chance bieten, die Förderung der Völkerverständigung in ihrem P.R.-Konzept zu verstärken, indem man ihnen bewußt Sponsoring-Möglichkeiten eröffnet.
Anbieten von Mediation zwischen verfeindeten gesellschaftlichen Gruppen. In unserer multikulturellen Gesellschaft häufen sich zunehmend Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen, etwa Mehrheit und Minderheit. Am Beispiel des Konfliktes um die “Trauner Moschee” habe ich dies in der vorliegenden Arbeit bereits verdeutlicht. Es könnte dem Frieden in der multikulturellen Gesellschaft dienen, wenn Vermittlungsbemühungen zwischen solchen verfeindeten Gruppen gesetzt würden. Teilweise kann dies in Zukunft, so wie bisher, auf Eigeninitiative hin erfolgen; dies ist auch wichtig, um Erfahrungen aufzubauen. Ich sehe aber nicht ein, wieso man nicht prinzipiell offen dafür sein sollte, Mediationsdienste zwischen verfeindeten gesellschaftlichen Gruppen auch gegen Bezahlung (zu gleichen Teilen von den Parteien oder zur Gänze von einem neutralen Dritten zu übernehmen) anzubieten.
Noch besitzt das UZF nach meinem Dafürhalten nicht die Struktur oder die Kapazität, um sich als eine Art österreichische “Krisenfeuerwehr” profilieren zu können, die österreichweit Dialoge initiiert und mediiert; aber warum sollte man nicht langfristig so etwas aufbauen können? Der Staat hätte auf jeden Fall ein plausibles Interesse daran, wenn er auf kompetente Vermittler zurückgreifen könnte, die innerstaatliche Konflikte in der multikulturellen Gesellschaft im Vorfeld entschärfen, noch bevor sie eskalieren. Diesen Vermittlern auch einen relevanten Geldbetrag zu bezahlen ist langfristig sicher billiger, als die Scherben nach gewalttätigen Rassenunruhen aufzuräumen, wie sie z.B. in Los Angeles regelmäßig stattfinden. Noch ist es in Österreich nicht so weit wie dort, aber die Spannungen vergrößern sich auch hierzulande, wie der Konflikt um die “Trauner Moschee” beweist. Die einstmalige “Insel der Seligen” wird sich in der globalisierten Welt auf jeden Fall nicht mehr ganz von der Außenwelt abkapseln können, gesetzt, dies sei überhaupt wünschenswert. Als der Kurdenführer Öcalan verhaftet wurde, gab es auch in Wien mit Kurdenprotesten Probleme. Auch der kleinen Republik im Herzen Europas stehen also konfliktreiche Zeiten bevor; man benötigt in Zukunft daher wohl auch mehr kompetene Vermittler, um den sozialen Frieden auch nur annähernd in jenem Maße zu garantieren wie es in den letzten fünfzig Jahren möglich gewesen ist. Es wäre vielleicht langfristig nicht schlecht für eine Friedensforschungsstelle, sich als interkultureller Mediator zu profilieren versuchen. Im Prinzip würde dann nicht nur die Bezeichnung “Mediation” zutreffen, sondern im Sinne des in der Einleitung skizzierten Ansatzes der “Verständigungsorientierten Öffentlichkeitsarbeit” auch die Bezeichnung “Konflikt-P.R.”, für die es sicherlich auch ein Geschäftsfeld gibt.
Anbieten von Studien zur Analyse von Konflikten und Ausarbeiten von Friedensstrategien. Im Vorfeld solcher Mediationen müßten u.a. Studien erstellt werden, welche den Ursprung der entsprechenden Konflikte analysieren und Lösungswege ausarbeiten. Ein Anbieten solcher Studien könnte möglicherweise auch wirtschaftlich Sinn machen; das UZF müßte aber, bevor es ein entsprechendes Image erwerben könnte, freilich auch noch seine Kompetenzen in den Bereichen “Konflikt-Ursachenforschung” und “sozialwissenschaftliche Methoden” vertiefen.
Soziale Anerkennung durch Vergabe von Ehrentiteln. U.S.-amerikanische Universitäten verleihen oftmals Ehrentitel an Großspender. Damit kann ein wesentliches immaterielles Interesse befriedigt werden. Die Verfasser der Statuten des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) haben diese Möglichkeit bereits vor Jahrzehnten erkannt; Förderern kann der Ehrentitel eines “Stifters” oder, bei noch höheren Beträgen, “Gründers” der Vereinigung verliehen werden.
6. Zur Autonomie-Problematik beim Fund Raising: Plädoyer für einen “realistischen Idealismus”
Ich möchte ferner zur Autonomie-Problematik Stellung nehmen, die mit dem Fund Raising naturgemäß verknüpft ist. Geldzuwendungen aller Art können, das ist ein Faktum, Abhängigkeiten schaffen. Die Öffentlichkeitsarbeit befindet sich hier in einem schwierigen Spannungsfeld: Einerseits will sie das Budget einer Organisation vergrößern und damit ihren Handlungsspielraum. Andererseits strebt sie nach der größtmöglichen Autonomie der eigenen Organisation von allen äußeren Einflußnahmen. Diese Autonomie muß zwar durch finanzielle Zuwendung nicht gefährdet sein, kann es aber sein. Was ist der Ausweg aus diesem offenkundigen Dilemma? Ein Patentrezept gibt es nicht, aber einen auf Plausibilität beruhenden, meiner Ansicht nach allgemein einleuchtenden Weg.
Non-Profit-Organisationen pflegen vor der Annahme von Sponsorgeldern zu prüfen, ob die Ziele des Sponsors mit den Zielen der eigenen Organisation kollidieren könnten. Es kann unter Umständen notwendig sein, einzelne Sponsoren zurückzuweisen, selbst, wenn man ihr Geld gut gebrauchen könnte. Das “Rote Kreuz” tut dies z.B. mit eiserner Konsequenz. Wenn seine Führung meint, die Ziele eines Sponsors sind denen des “Roten Kreuzes” entgegengesetzt, wird das Geld schlichtweg abgelehnt. Diese Vorgangsweise zeugt nicht nur von moralischer Größe, sondern ist - in den Extremfällen - aus P.R.-Sicht absolut notwendig. Im “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) soll man sich nicht scheuen, eine analoge Vorgangsweise zu wählen. Ich bin z.B. der festen Überzeugung, daß die Ablehnung der Förderungen durch das Militärbischofsamt 1995 durch das UZF notwendig gewesen ist. Wie will man als Friedensforschungsstelle noch sinnvoll arbeiten, wenn man in einem solchen Abhängigkeitsverhältnis zum Militär oder militärnaher Institutionen steht? Auch von Waffenfirmen bzw. von Betrieben, die u.a. Waffen produzieren, soll man meiner Ansicht nach als Friedensorganisation kein Geld annehmen; und wenn der Inserent in den “Wiener Blättern zur Friedensforschung” Schiebel Electronics sich nicht vom Produzenten von Landminen zu einem anerkannten Spezialisten für Minenräumung gewandelt hätte, wäre ebenfalls eine bedenkliche Situation vorgelegen.
Es stellt sich allerdings die Frage, wie streng man die Grenze zieht; daß es eine solche gibt, muß unbestritten sein. “Amnesty International” geht nach Angaben auf seiner Homepage im Internet so weit, alle staatlichen Subventionen abzulehnen, weil es dadurch seine Unabhängigkeit gefährdet sieht. Meiner rein persönlichen Ansicht nach ist diese Haltung, zumindest im Falle des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) sowie der meisten mir bekannten Organisationen, völlig überzogen. Solange man nicht vom Irak oder Afghanistan seine Gelder bezieht, habe ich in der Regel kein Problem mit der Annahme von staatlichen Zuwendungen, auch weil ich Sponsoren wie die Gemeinde Wien oder das österreichische Wissenschaftsministerium für relativ harmlos halte. Einzig beim österreichischen Bundesheer wäre ich (als Friedensorganisation) ein wenig vorsichtig.
Man muß aber auf jeden Fall berücksichtigen, daß der Staat immer der größte und wichtigste potentielle Sponsor von Non-Profit-Organisationen ist und man schwer völlig auf ihn verzichten kann. Hier ist daher auch ein gewisser Realitätssinn gefragt. Man wird sich selbst die allgemeine Chance, Gelder von dort zu lukrieren, wohl nicht nehmen. Um die besagte Grenze, welche Sponsoren man ablehnt und welche nicht, im Einzelfall wirklich seriös ziehen zu können, muß man als P.R.-Manager wissen, was die Ziele der eigenen Organisation sind; diese Ziele sollen niedergeschrieben sein, damit man sich verbindlich danach richten kann. Solange eine Organisation nicht weiß, wofür sie steht, kann sie nicht wissen, welche Ziele anderer Organisationen mit den ihren vereinbar sind und welche nicht. Daher kann sie auch nicht wirklich wissen, welche Sponsorgelder sie annimmt und welche nicht. Es besteht eine Notwendigkeit, dies ehestbaldigst zu definieren.
Der Realitätssinn, den ich bei allem Idealismus, Streben nach Autonomie und Ablehnung der intellektuellen Prostitution einmahne, sollte aber beinhalten, daß man schon prinziell darauf achten sollte, bei jenen Inhalten, die man vertritt, für Sponsoring wenigstens allgemein attraktiv zu bleiben oder wenigstens nicht völlig unattraktiv zu werden.
Professionell kann man das Autonomie-Problem meiner Ansicht nach folgendermaßen handhaben: Einen Sponsor abzulehnen kann sehr wichtig für die Autonomie sein; man hat es z.B. als Friedensorganisation nicht notwendig, sich ausgerechnet dem Militärbischofsamt auszuliefern; es gibt viele andere Sponsoren, auf die man zurückgreifen kann. Aber Ziele zu wählen, die alle nur denkbaren Sponsoren vergrämen, hat nichts mehr mit Integrität zu tun, sondern ist meiner Ansicht nach nur mehr selbstschädigend.
In diesem Zusammenhang komme ich nicht ganz zufällig auf Anti-EU-Engagement zu sprechen. Man muß dieses, so meine Meinung, auch unter dem Gesichtspunkt des Fund Raising betrachten. Ob Fundamentalopposition gegen die EU ein günstiges oder ein ungünstiges Umfeld für Fund Raising-Aktivitäten bietet, kann man bei sich selbst klären, wenn man folgende drei Fragen beantwortet:
Welche Bank hat ein wirtschaftliches Interesse daran, eine Organisation zu sponsern, die in der heiklen Phase kurz vor der Einführung des Euro einen Kreuzzug gegen die neue Währung beginnt?
Welche Privatfirma - egal, was sie produziert oder welche Dienstleistungen sie anbietet - hat ein wirtschaftliches Interesse daran, ein Inserat in einer Zeitschrift zu schalten, in der womöglich Brandartikel gegen den freien Markt der Europäischen Union erscheinen?
Definiert die Republik Österreich ihr gegenwärtiges politisches Interesse so, daß dieses in einem Austritt aus der EU läge? (Oder definiert auch nur eine der vier im Parlament vertretenen Parteien das Interesse der Republik auf diese Art? Meines Wissens ist auch das nicht der Fall.)
Ich meine: Solange das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) Forschungsgespräche veranstaltet wie jenes mit Herrn Prof. “Die EU ist eine Raubritterburg” Weissel im Sommersemester 2001, ist jede Form von effizientem Fund Raising von vornherein massiv eingeschränkt. Wie stellt man sich dieses unter den genannten Rahmenbedingungen denn vor? Man erkläre mir: Wie will man einem Banker oder Top-Manager erklären, warum er Geld für eine Organisation mit dem Image einer EU-Austrittsbewegung locker machen soll? Außerdem ist die EU selbst ein interessanter nicht-privater Subventionsgeber, von denen es neben der Republik Österreich nicht sehr viele gibt. Kurzum: Anti-EU-Engagement schadet aus meiner Sicht dem Fund Raising des UZF. Es stellt sich parallel dazu auch die Frage, ob man nicht mit markigen Sprüchen wie jenen Weissels nicht auch eine wichtige Zielgruppe, die zumeist akademisch gebildeten Opinion Leaders (z.B. im Bereich Diplomatie), völlig vergrämt. Es stellt sich auch die Frage, ob man mit Fundamentalopposition gegen die EU gerade junge, urbane, gebildete Schichten (Zielgruppe: Studenten der Uni Wien) ansprechen kann. Durch Inhalt und Form seiner Äußerungen ließen sich vielleicht weniger gebildete “Modernisierungsverlierer” gut ansprechen (z.B. Kleinbauern), aber das entspricht meiner Ansicht nach nicht der gültigen Zielgruppendefinition des UZF.
Übrigens, um Mißverständnissen vorzubeugen: Ob die EU gut ist oder schlecht, ist nicht mein Thema. Dieses besteht vielmehr darin, die Bedingungen des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) für P.R. und auch für Fund Raising einzuschätzen. Wenn man im UZF den Kampf gegen die EU aus Überzeugungsgründen für wichtiger hält als alle P.R. und alles Fund Raising zusammen und sowohl mögliche Imageschäden, als auch finanzielle Einbrüche bewußt dafür in Kauf nimmt, soll man ihn weiterführen. Aber man soll dabei eben wissen, daß dieses Engagement wahrscheinlich ein denkbar ungünstiges Rahmenfeld für Fund Raising darstellt.
Die tiefe, innere Überzeugung bzw. das eigene Gewissen sind aber natürlich wichtiger als Geld und Image - ich bin also kein Materialist, der die falschen und scheinbaren Werte gegenüber den wahren und wirklichen priorisiert. Die Frage ist nur, ob die Ablehnung der EU wirklich für jeden UZF-Mitarbeiter ein absolutes Gebot seines Gewissens ist.
Man sieht aber hier ganz deutlich, daß folgendes nottut: Man sollte die Meinungen bzw. Präferenzen der kleinen und großen Spender zu gewissen Themen kennen. Große Non-Profit-Organisationen führen zu diesem Zweck sogar z.B. Fragebogenuntersuchungen durch, um ihre programmatische Ausrichtung entsprechend optimieren zu können. Bei der durchaus überschaubaren Struktur des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) erscheint dies vielleicht übertrieben. Aber wenigstens durch informelle Methoden könnte man diese Interessen herauszufinden versuchen und dann auch, so weit es in Hinblick auf die grundlegenden Werte der Organisation vertretbar erscheint, berücksichtigen und in Überlegungen einfließen lassen.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich nebenbei bemerken, daß sich nach meinen Informationen die Gemeinde Wien, der gegenwärtige Hauptsponsor des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) gerade angesichts der Terroranschläge in New York, um den Dialog mit dem Islam auf allen Ebenen bemüht; entsprechende Bemühungen kategorisch verweigern und womöglich noch öffentlich (z.B. in Vorlesungen oder Sitzungen) dagegen aufzutreten könnte in diesem Zusammenhang fast schon selbstschädigend sein. Man sollte meiner Ansicht nach vielmehr Kooperationsangebote legen und der Gesellschaft Dienste in diese Richtung anbieten.
7. Interne Kommunikation
Relevanz, Zielgruppen
P.R.-Lehrbücher räumen der internen Kommunikation eine überragende Bedeutung für den Erfolg eines Unternehmens ein. Immerhin sind die eigenen Mitarbeiter und Mitglieder die größte Ressource eines Unternehmens, die optimal genützt sein will. Alvie Smith, früherer Direktor der Unternehmenskommunikation bei General Motors schätzt, daß der U.S.-amerikanischen Wirtschaft durch mangelnde Motivation und daraus resultierendes geringeres Engagement ca.50 Mrd.Dollar pro Jahr verloren gehen. Die interne Kommunikation ist nach Smiths Meinung geeignet, Mitarbeiter zu motivieren, den Teamgeist zu stärken und einfach dafür zu sorgen, daß alle durch stärkere innere Identifikation mit dem Unternehmen letztendlich auch mehr leisten.
Idealerweise sind Arbeitsbeziehungen von folgenden Bedingungen geprägt:
Vertrauen zwischen Arbeitgeber und Angestellten bzw. Vereinsführung und Mitgliedern etc.
Offener Informationsaustausch nach allen Richtungen
Zufriedenstellender Status und ausreichende Einbindung jeder Person
Kontinuität der Arbeit ohne Streit und Hader
Gesundheitsfördernde Umgebung
Erfolg für das Unternehmen
Optimismus für die Zukunft
Die interne Kommunikation soll und kann dazu beitragen, diese zu erfüllen.
Von besonderer Bedeutung ist die Etablierung eines “zweiseitigen Dialoges”, d.h. es sollte insbesonders auch Rückmeldungsmöglichkeiten “von unten nach oben” geben, damit Wünsche, Erwartungen, Ängste, Kritikpunkte artikuliert werden und Einfluß in die Unternehmenspolitik finden können.
Anwendung auf das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF). Die Zielgruppendefinition im Bereich der intenen Kommunikation ist beim UZF ziemlich klar; die Gruppe der Mitglieder ist genau umschrieben, bekannt und kann über Privatadressen erfaßt werden. In einer sehr kleinen und überschaubaren Organisation wie dem “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) scheinen mir Rückmeldemöglichkeiten der Mitglieder an die Unternehmensführung zu existieren, weil im Unterschied zu manchen World Trusts, in denen die Rückmeldung jeder Art zum Problem wird, praktisch jeder jeden persönlich kennt. Man sollte Rückmeldungen auch in Hinkuft ernst nehmen und auf sie eingehen.
Mitarbeiterzeitschrift
Ein wichtiges interne Kommunikationsinstrument ist die “hauseigene” Zeitschrift; im Falle des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) gibt es hier die “Wiener Blätter zur Friedensforschung”. Die optimalen Richtlinien für die Gestaltung einer Zeitschrift sind bereits im Kapitel “Kommunikationsprüfung” behandelt worden, also verweise ich lediglich darauf.
Videos
Manche Organisationen verfügen über Videos, in denen sie sich und ihre Arbeit vor einem Publikum präsentieren, z.B. die UNO in Wien, die solche bei jeder Führung zeigt; solche Videos können unter Umständen viele zehntausend Menschen erreichen. Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) nützt dieses Medium nicht, wohl auch aus finanziellen Gründen (Produktionskosten). Dennoch könnte man die Produktion eines eigenen “Vorstellungsvideos” über die eigenen Organisation in Erwägung ziehen und die Möglichkeit prüfen.
Meetings
Sitzungen aller Art bringen Menschen zusammen, eröffnen Möglichkeiten zu sprechen und zuzuhören, bieten also die optimale Zwei-Weg-Kommunikation. Der Verlust an Zeit in Hinblick auf die tägliche Arbeitsroutine wird wettgemacht durch den Vorteil der besseren Koordination. Die Fähigkeit des Vorsitzenden zur Moderation und Mediation ist außerordentlich wichtig dafür, daß eine Sitzung erfolgreiche Ergebnisse produziert und nicht bloß sinnlos ist.
Anwendung auf das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF). Meine Einschätzung ist auf Basis der Information der Expertengespräche ist, daß Treffen von Mitarbeitern im UZF immer wieder durchaus erfolgreich genutzt werden, wobei der Organisation wieder ihre Kleinheit und Überschaubarkeit zugute kommt. Die Generalversammlung, das höchste Gremium, tagt nur alle zwei Jahre. Vorstandssitzungen finden mehrmals pro Jahr in unregelmäßigen Abständen statt, d.h. bei Bedarf. Darüberhinaus ist der Nucleus an Mitarbeitern aber am Institut für Philosophie der Universität Wien untergebracht; ihre Büros sind in unmittelbarer Nachbarschaft. Oft entwickeln sich aus dieser Nachbarschaft heraus quasi automatisch gewisse Ab- und Aussprachen. Ein ausgeklügelter Plan zur internen Kommunikation erscheint mir in einer solch überschaubaren Organisation nicht wirklich notwendig. Auch der Wissenschaftliche Beirat tritt immer wieder zusammen.
Die Kompetenz der Moderatoren bzw. Sitzungsleiter erscheint mir hoch, weil in Friedensforschung und Diplomatie erfahrene Menschen mit großer Kompetenz versuchen, tragfähige Kompromisse zu finden.
Zusatzpublikationen
Zusatzpublikationen begegnen uns in einer reichen Vielfalt, z.B. als Sach- oder Handbücher, Informationsbroschüren, Biographien des Unternehmensgründers, Arbeitsanleitungen etc. Ihre Anfertigung ist zumeist vom Unternehmen selbst gesponsert, dann werden sie an interne und externe Zielgruppen verschenkt. Sie dienen meist folgenden drei Zwecken:
Einweisung: Ein neues Mitglied bzw. ein neuer Mitarbeiter erhält diese Publikationen, um zu erfahren, worum es in der Organisation geht, was von ihm erwartet wird, welche Werte und Ziele man vertritt etc. Eine solche Information ersetzt nicht den persönlichen Händdruck, kann ihn aber wesentlich ergänzen.
Referenz: Ein unschlüssiger Mitarbeiter kann sich auf die Publikationen beziehen, wenn es Unklarheiten in Erfüllung einer Aufgabe gibt.
Institutionelle Information: Es können Informationen zum Unternehmen selbst, seiner Geschichte, seinem Gründer etc. an spezifische Zielgruppen gegeben werden, z.B. an “Opinion Leaders”, die man so über die eigenen Aktivitäten in Kenntnis setzen kann.
Anwendung auf das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF). Früher existierten im UZF Zusatzpublikationen in der Form von Sachbüchern; so wurden die “Friedensdialoge zwischen Christen und Marxisten” in mehreren erfolgreichen und heute zum größten Teil vergriffenen Sammelbänden dokumentiert und publiziert. Die heutigen Symposien und Friedensdialoge werden auch dokumentiert und publiziert, aber “lediglich” in der Zeitschrift, nicht mehr in der Form von Sammelbänden. Die Zeitschrift ist natürlich ein hervorragend gemachtes Publikationsforum, aber für die Darlegung ganz besonderer “Highlights” würden sich Zusatzpublikationen aller Art durchaus eignen.
Hochrangige UZF-Mitarbeiter publizieren in anderen Zusammenhängen Bücher zum Fach (z.B. Sigrid Pöllinger, Der KSZE / OSZE-Prozeß) oder Artikel (z.B. Erwin Bader, Für ein Europa des Geistes), für die Gesamtorganisation UZF bleibt aber die Zeitschrift das Hauptpublikationsorgan.
Informationsbroschüren bzw. Handbücher über die Organisation selbst, d.h. ihre Werte, Ziele, Themenstellung etc. gibt es nicht, zum Teil sicherlich aus Kostengründen, aber wohl auch, weil diese intern noch nicht wirklich umfassend definiert sind. Solches Material wäre eigentlich wichtig, z.B. um einem neuhinzugekommenen Mitglied wichtige Grundlagen der Organisationsarbeit zu erläutern und ihm auch klarzumachen, wofür die Organisation eigentlich stehen kann und wofür nicht. Auch für externe Zielgruppen sind solche Publikationen wichtig, damit sich die Organisation diesen quasi “vorstellen” könnte. Zum Gründer des “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) liegt keine Biographie oder dergleichen vor.
Einige Ideen für solche Publikationen könnten z.B. sein (unverbindliche Vorschläge):
Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF). Die Friedensforschungsstelle der Universität Wien stellt sich vor.
(In einer solchen Publikation könnte einerseits eine kurze Darstellung der Organisation erfolgen, das Leitbild mit den Werten und Zielen abgedruckt sein, dazu einige wissenschaftliche Beiträge wichtiger Forscher).
Leo Gabriel - Philosoph des Dialoges. Leben und Werk eines Pioniers der österreichischen Friedensforschung.
(In einer Biographie könnte man auf die einzigartige Tradition hinweisen, in der man mit der eigenen Friedensarbeit steht. Mitarbeiter des UZF könnten Beiträge darüber verfassen, z.B. über die Fortsetzung seines Werkes in einem “Friedensdialog der Weltreligionen”, in der Form von Erinnerungen an seine Person durch frühere enge Mitarbeiter oder Studenten. Auch die vorliegende Arbeit enthält gesammeltes Material, das in diesem Zusammenhang nutzbar gemacht werden könnte.)
Friedensdialog der Weltreligionen. Ergebnisse der Symposien des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF).
(Hier könnte man die “Highlights” aus den bei den Symposien präsentierten Referaten zur Versöhnung der Religionen abdrucken.)
Minderheiten: Konflikte in Österreich und Europa.
(In einem solchen, ohnehin bereits von der Generalsekretärin geplanten Buchprojekt, könnten wesentliche Informationen zu einem brisanten und aktuellen Thema enthalten sein).
Neuerdings, das ist ein großer Fortschritt zum bisherigen status quo, gibt es ein P.R.-Konzept des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) in Form der vorliegenden Publizistik-Diplomarbeit.
Der Brief
Sogar im Zeitalter von E-Mail und Fax bleibt der einfache Brief das Rückgrat der Unternehmenskommunikation. Mit der Hilfe spezieller Software werden “individualisierte” Briefe, d.h. solche mit automatisch eingesetzter persönlicher Anrede etc., zunehmend routinemäßig eingesetzt, um eine schnelle, billige und direkte Kommunikation mit allen Mitgliedern, Mitarbeitern etc. herzustellen. Aber auch für die externe Kommunikation z.B. mit “Opinion Leaders” kann das Kommunikationsinstrument des Briefes Bedeutung haben. Briefe sollen in der Regel über Fakten Klarheit schaffen, d.h. nicht hinsichtlich der Hauptaussage verwirren, und tendentiell eher freundlich als unfreundlich sein (das ist zwar trivial, wird aber oftmals nicht beachtet). Es besteht die Möglichkeit, Briefe zu einem billigen und leicht produzierbaren “Newsletter” mit einheitlichem Design weiterzuentwickeln, welcher in regelmäßigen Abständen Informationen über die Organisation an das relevante Zielpublikum gibt (z.B. Vorstellen neuer Mitglieder, Bericht über Aktivitäten, Hinweis auf momentane interne Diskussionen etc.).
Anwendung auf das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF). Ich bin der Ansicht, daß man sich des Briefes als Kommunikationsinstrument im UZF stärker bedienen sollte. Vereine schicken z.B. oft zu Jahresende einen ca. eine Seite umfassenden, ansprechend gestalteten und teilweise bebilderten Brief an alle Mitarbeiter bzw. Mitglieder, in denen ein führender Funktionär auf das alte Jahr zurückblickt, die Erfolge und Aktivitäten ein wenig aufzählt und einige neue Pläne für die Zukunft sowie die immer gleichbleibenden grundlegenden Werte der Organisation betont.
In diesem Zusammenhang wird den Mitarbeiter bzw. Mitgliedern auch in der Regel ein friedvolles Weihnachtsfest und ein guter Rutsch ins neue Jahr gewünscht. Obwohl ich ordentliches Mitglied des UZF bin, habe ich z.B. vor Jahresende 2001 keinen vergleichbaren Brief erhalten und mutmaße daher, daß es eine solche sinnvolle Einrichtung auch für andere Mitglieder gar nicht gibt. Man sollte sich in diesem Zusammenhang, meine ich, menschlich ein wenig intensiver um diese kümmern. Ansonsten habe ich keinen Einblick in die briefliche Korrespondenz des UZF mit externen Zielgruppen. Allgemein bleibt nur zu sagen, daß man auf die gute und ansprechende Gestaltung von Briefen, Eindeutigkeit der Aussage und dennoch eine gewisse darin artikulierte menschliche Wärme großen Wert legen sollte, weil das wichtig für die gute Kommunikation ist. Die Schaffung eines eigenen, monatlich ausgesandten und aktuellen Newsletters als Kommunikationsinstrument mit Mitgliedern ist überlegenswert.
Das Gerücht
Das Gerücht ist das genaue Gegenteil eines kontrollierten Mediums. In den meisten Organisationen ist es aber das wesentlichste und schnellste Kommunikationsmittel. Es spricht Menschen auch einerseits stärker an, weil es interessanter erscheint als die meisten Fakten. Andererseits ist es, worauf Umfragen in Betrieben hindeuten, nicht die bevorzugte Quelle der Mitarbeiter, sondern wird meist dann relevant, wenn keine anderen zuverlässigen Informationen vorhanden sind. Es gilt die Regel: “The informal, uncontrolled channels will take over where the formal, controlled channels stop”. Gerüchte können einem Unternehmen oder einer Person in Führungsfunktion immens schaden und sind für das Image relevant.
Der P.R.-Manager geht nach Cutlip, Center und Broom mit Gerüchten folgendermaßen um: Er bleibt an die Gerüchteküche “angeschlossen” und ist immer über den letzten Stand informiert. Wenn der Klatsch harmlos ist, tut er nichts. Wenn Gerüchte im Umlauf sind, die er als schädlich für die Organisation einstuft, unternimmt er etwas, z.B. entwirft er Gegenstrategien, veröffentlicht die tatsächlichen Fakten, stellt richtig etc.
Anwendung auf das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF). Das UZF ist am Institut für Philosophie der Universität Wien räumlich untergebracht und nützt seine Strukturen (z.B. Hörsäle für Kongresse). Es wäre eigentlich bei einer solchen Konstellation optimal, wenn es an besagtem Institut sehr anerkannt und akzeptiert wäre; dies würde seine Verankerung auch in Zukunft gewährleisten.
Im Laufe meiner Recherchen wollte ich erfahren, welche Gerüchte man über das UZF dort so erzählt. Ich besuchte daher mehrere zufällig ausgewählte Mitarbeiter des Instituts für Philosophie, die keine Mitglieder des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) sind, und befragte sie - unter Zusicherung der Anonymität, an die ich mich auch halte - über ihre persönliche Einschätzungen zum Image besagter Forschungsstelle bei ihnen selbst und unter Institutskollegen. Diese Form der informellen Befragung brachte natürlich keine repräsentativen Aussagen, sondern eben nur Gerüchte, die ich aber in ähnlicher Form von vielen unterschiedlichen Seiten und unabhängig voneinander hörte. Sie sind so schlimm, daß man ihnen, wenn man die oben Ausführungen beherzigt, meiner Meinung nach zumindest in irgendeiner Form entgegentreten sollte.
Zunächst war mir gegenüber davon die Rede, daß es - trotz mancher Personalunionen - praktisch keinen Kontakt zwischen “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) und Institut für Philosophie gibt, abgesehen davon, daß es heißt, man würde ab und zu Prof.Bader (1.Vorsitzender) zwischen Tür und Angel zu sehen. Man ist im Prinzip aber nicht wirklich darüber informiert, was die “UZFler” eigentlich so tun. Auch gab man mir von verschiedenen Seiten zu verstehen, daß allgemein die Sinnhaftigkeit der Verankerung der Friedensforschung am Institut für Philosophie bezweifelt wird. Gerade das, was mir persönlich am UZF so gefallen hat, nämlich seine Interdisziplinarität einerseits und die Auseinandersetzung mit der aktuellen politischen Lage andererseits, scheint massive Vorbehalte zu wecken. “Zuwenig Philosophie”, wurde mir immer wieder gesagt. (So eine Situation gab es historisch schon einmal, nämlich kurz vor der Auflösung des Instituts für Friedensforschung Anfang der 80er, dem vorgeworfen wurde, “zuwenig Theologie” zu betreiben. Diese falschen Vorwürfe folgen offenbar der Interdisziplinarität auf den Fuß und sind alamierend). Teilweise wurde auch die Kompetenz der “UZFler” auf dem Sektor Philosophie angezweifelt, wobei es bei vielen befremdlicherweise hieß, sie seien überhaupt (auch von ihrer Ausbildung her) “fachfremd”.
Das gegenwärtige Image des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) bei Mitarbeitern des Instituts für Philosophie scheint nach einer informellen Umfrage in der “Gerüchteküche” also möglicherweise mit folgenden Einschätzungen zu kämpfen zu haben, über deren Wahrheit oder Falschheit wie gesagt noch nichts feststeht:
1.) Kaum Kontakt, keine Information, “Was tun die überhaupt?”
2.) Friedensforschung (allgemein, aber insbesonders in der vom UZF betriebenen Art und Weise) hat nichts oder zuwenig mit Philosophie zu tun
3.) Der Sinn der Verankerung der Friedensforschung am Institut für Philosophie leuchtet nicht wirklich ein
4.) Die UZF-Mitarbeiter sind “fachfremd”
Dazu ein Kommentar:
ad 1.) Wenn das stimmt, könnte hier möglicherweise ein beträchtliches Defizit in der Kommunikationsstrategie des UZF vorliegen. Viele Gerüchte, insbesonders die unberechtigten, könnten schnell verschwinden, wenn es ein Mehr an Kontakt und Information gäbe. Ich denke auch nicht, daß in jeder Kritik böser Wille steckt, weswegen man jetzt beleidigt sein muß, sondern schlichtweg völlige Uninformiertheit - das ist ein “Klima”, in welchem Fehleinschätzungen gedeihen.
ad 2.) Es könnte auf keinen Fall schaden, P.R.-Maßnahmen im Sinne einer Informationsoffensive ins Leben zu rufen, die sich gezielt an die Mitarbeiter des Instituts für Philosophie wenden und die geeignet erscheinen, den Gerüchten zu Leibe zu rücken. Man könnte z.B. Vorlesungen starten, die ganz bewußt in Titel und vorgetragenem Stoff die philosophischen Grundlagen der Friedensforschung betonen. Aber auch die Initiierung einer eigenen Forschungsgesprächsreihe “Philosophie des Friedens” (als eine Art internes Fortbildungsangebot für Mitarbeiter des Instituts für Philosophie sowie für Mitglieder des UZF, das aber auch Studenten zugänglich ist), zu denen man wirkliche Experten einlädt, bietet sich an. Einladungen dazu sollte man auf jeden Fall an alle Mitarbeiter des Instituts für Philosophie verschicken, deren Privatadressen man sich irgendwie besorgen und in den zentralen Verteiler aufnehmen sollte. Man sollte auch bei jeder sich bietender Gelegenheit z.B. bei Sitzungen institutsintern auf die enge Verbindung zwischen Friedensforschung und Philosophie hinweisen. Die persönlichen Kontakte und auch die Zahl der Gespräche sollten erhöht und intensiviert werden. Auch mit Gratis-Abos der Zeitschrift an strategisch wichtige Personen am Institut sollte man nicht geizen.
Die Mitarbeiter des UZF sollten sich vorsorglich gemeinsam Rechtfertigungsstrategien überlegen, um zu begründen, wieso die Friedensforschung eigentlich so stark mit der Philosophie zusammenhängt, wobei natürlich ein Rückgriff auf die Geistesgeschichte von Augustinus über Kant bis Suttner unvermeidbar ist. Auch im künftigen Unternehmensleitbild des UZF sollte man diese Verknüpfung ausdrücklich und mehrfach hervorheben, was ich oben bereits eingearbeitet habe.
ad 3.) Man wird unter Umständen in Zukunft und auch in der Gegenwart möglicherweise Erklärungsbedarf bekommen, warum das UZF eigentlich am Institut für Philosophie verankert sein sollte und nicht anderswo und v.a., was das Institut von dieser Verankerung hat. Es sollten daher schon vorher Argumentationsstrategien in dieser Richtung überlegt werden; diese Informationen sollte man auch bei jeder Gelegenheit kommunizieren.
Einige Argumente könnten z.B. so aussehen:
Es bietet sich an, die Friedensforschung (v.a. gegenüber Mitarbeitern des Instituts für Philosophie) als sozialphilosophischen Ansatz und / oder auch als “angewandte Ethik” öffentlich zu positionieren, damit jedem der Platz der Friedensforschung in der Philosophie klar wird. Letztere Positionierung empfiehlt sich u.a. auch darum, weil die Ethik ein Hauptfach im Studienplan der Philosophie ist.
Die Friedensforschung kann in letzterer Sichtweise als eine Wissenschaft angesehen werden, die, genauso wie die Medizinethik es im Gesundheitswesen tut, Werte in der praktischen Politik einfordert. Man sollte überhaupt auch darauf hinweisen, daß die Friedensforschung, genauso wie die Medizinethik, Ausdruck zunehmender Praxisorientierung des Philosophiestudiums und beruflich z.B. im Bereich Diplomatie oder Journalismus vielfältig einsetzbar ist. Mit der Verankerung der Friedensforschung am Institut für Philosophie kommt man daher auch einem gegen dieses Fach häufig geäußerten Kritikpunkt des mangelnden Praxisbezuges entgegen. Diesen Umstand könnte auch das Institut für Philosophie zu seinem Vorteil nutzen.
Last but not least wurde das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) von Leo Gabriel gegründet, einem wichtigen Philosophen, der auch Vorstand des Instituts für Philosophie an der Universität Wien war; man sollte sein Werk auch im Rahmen des Instituts weiter pflegen. Auf jeden Fall existieren auch wichtige historische Gründe für eine Verankerung.
ad 4.) Bei Analyse der Biographien sowohl Prof.Baders (1.Vorsitzender), als auch Prof.Lesers (Präsident) fällt eine Gemeinsamkeit zwischen beiden auf: Beide sind natürlich hochgebildet und -kompetent im Bereich Philosophie, aber von ihrer Ausbildung her “Quereinsteiger”. Prof.Bader ist eigentlich Doktor der Politikwissenschaft und kam in die Philosophie über ein Hauptfach dieser Disziplin, das sich diese mit der Philosophie quasi teilt, nämlich die “politische Philosophie”. Prof.Leser ist Doktor der Rechtswissenschaft; er kam in die Philosophie über sein Dissertationsfach, die “Rechtsphilosophie”. Heute wirken beide als - in der Fachwelt in ganz Österreich anerkannte - Professoren am Institut für Philosophie der Universität Wien. Die von ihnen beschrittenen Wege sind völlig legitim, aber ungewöhnlich. Ich empfand es persönlich immer als fachliche Bereicherung, wenn Menschen, die auch in anderen Wissenschaften bewandert sind, an einem bestimmten Institut unterrichten und besuchte eben deshalb gerne die Vorlesungen der Genannten - beide sind meine Lehrer gewesen. Ja, ich gehe sogar soweit zu sagen, daß anders als über einen interdisziplinären Ansatz, der vielfältige Ausbildungen voraussetzt, eine Disziplin wie die Friedensforschung gar nicht intellektuell bewältigt werden kann. Aber ihre Kollegen am Institut für Philosophie sehen den von den beiden beschrittenen Weg nach meinem Eindruck nicht so positiv wie ich. Das liegt wahrscheinlich an folgendem Umstand: Quereinsteiger sind, das sieht man auch bei politischen Parteien, typischerweise geeignet, Ressentiments bei den “Eingesessenen” zu wecken; so sind die mir gegenüber geäußerten Vorbehalte u.a. erklärbar.
Die künftige Absicherung der Räumlichkeiten am Institut für Philosophie wird - insbesonders nach der Emeritierung des UZF-Präsidenten, die immer mit einem Rückgang an Einfluß verbunden ist - einerseits weitgehend davon abhängen, inwieweit es gelingt, mögliche Image-Defizite unter Mitarbeitern des Instituts für Philosophie auszugleichen. Es wäre andererseits ratsam - für alle Fälle und vorsorglich - durch Gewinnung neuer strategisch wichtiger Personen wieder mehr institutionelle Macht für das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) zu akkumulieren.
Man sollte also nach meiner Einschätzung eine dreifache Strategie in der P.R. im Dialog mit Mitarbeitern des Instituts für Philosophie einschlagen: 1.) mehr Offenheit, 2.) mehr Kommunikation und 3.) mehr Einbindungen von Mitarbeitern des Instituts für Philosophie in das UZF. Ich schlage also vor...
1.) ...durch internen Strukturwandel zu reagieren und die Organisation von einem “geschlossenen” in ein “offenes” System umzuformen, das geeignet ist, Anregungen der Dialoggruppen auszunehmen. Es ist doch wirklich sehr seltsam, daß man im UZF erst einen P.R.-Berater braucht, um festzustellen, daß man mit den Leuten, die einem die eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, öfter und intensiver kommunizieren sollte.
2.) ...alle Mitarbeiter am Institut für Philosophie regelmäßig darüber zu informieren, was man eigentlich so tut, um der Uninformiertheit und Unwissenheit entgegenzuwirken (Intensivierung der persönlichen Kontakte, Einladungen zu Kongressen an alle verschicken, Gratis-Abos der Zeitschrift freigiebig verteilen etc.). Dabei muß nach Möglichkeit in eigenen, speziell an besagte Zielgruppe gerichteten P.R.-Maßnahmen klar gemacht werden, wie eng die Friedensforschung mit der Philosophie verbunden ist und warum es sinnvoll ist, daß es eine Friedensforschungsstelle an einem philosophischen Institut gibt.
3.) ...versuchen, mehr der dortigen Mitarbeiter durch Charme und gute Angebote (Publikationsmöglichkeit, Kontakte zu wichtigen Leuten, im Lebenslauf gut wirkende Ämter) in die UZF-Arbeit einzubinden, und zwar vor allem jene, die sich durch Kompetenz auszeichnen - in “fachlicher” und “strategischer” Hinsicht. Es sollten auch einige Nicht-Quereinsteiger dabei sein.
Folgende Erkenntnis ist wichtig und muß in das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) Einzug halten: Bevor die P.R. einer Organisation “in die große weite Welt” hinausstrebt, muß sie sich erst um die leicht erreichbaren Zielgruppen “vor der eigenen Haustür” kümmern.
8. “Opinion Leaders”
Ein wichtiger “Opinion Leader” am Institut für Philosophie der Universität Wien ist aus meiner Sicht Herr Prof.Kampits, der nicht nur seine umfassende Kompetenz im Bereich der Ethik, sondern auch sein gutes Image in der philosophischen Fachwelt in das UZF einbringen kann. Ich habe mich persönlich sehr gefreut, als ich bei der letzten Generalversammlung hörte, daß er als Mitglied gewonnen werden konnte; bei nächster Gelegenheit sollten ihm meiner Meinung nach darüberhinaus führende Aufgaben im UZF angeboten werden, z.B. als Vorstandsmitglied.
Letztes Jahr fand wieder ein “Lech Philosophicum” statt. Es handelt sich dabei um einen der größten und bedeutendsten Philosophie-Kongresse Österreichs mit einem beachtlichen Stammpublikum, der in der Gemeinde Lech am Arlberg abgehalten wird (Bundesland Vorarlberg), die sich eben einmal jährlich für kurze Zeit von einem kleinen österreichischen Provinznest in einen “Think Tank” mit internationaler Bedeutung verwandelt. Das Thema des Kongresses im Jahr 2000 bestand in einer Reflexion über Krieg und Frieden aus heutiger Perspektive. Der Kongreß erfreute sich eines großen medialen Erfolges - Teile davon wurden sogar im Fernsehen übertragen (ich weiß es, denn ich sah das “Lech Philosophicum” - zu nächtlicher Stunde, aber immerhin - zufällig am ORF). Der Veranstalter des Kongresses ist Herr Prof.Liessmann, der sein Büro im selben Gang wie das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) hat.
Dennoch taucht das UZF in keinster Weise im Rahmen dieses Friedenforschungskongresses, seines Programmes und seiner Publikationen auf, zumindest nicht für mich ersichtlich; ich hätte aus P.R.-Perspektive dem UZF natürlich dazu geraten, Sponsoring zu betreiben, d.h. wenigstens einen gewissen Geldbetrag zuzuschießen, dafür überall mit seinem Logo (das man eben auch nicht hat) präsent zu sein und außerdem einen Referenten zu entsenden. Man hat aber eben “aneinander vorbeigearbeitet”, übrigens nicht aus bösem Willen oder Zerstrittenheit, sondern einfach, weil keine Kommunikationskanäle vorhanden sind und der eine nicht weiß, was der andere tut. Auch wenn diese eine Gelegenheit mittlerweile verpaßt ist, sollte man Liessmann nach Möglichkeit einbinden. Er ist Träger eines Staatspreises, begehrter Kommentator in den Medien (z.B.“Format”) und einer der fähigsten Wissenschaftler am Institut für Philosophie. Man sollte das mehr zu schätzen wissen, aber der Prophet gilt ja bekanntlich nichts an der eigenen Universität - zum Schaden für die Universität.
Auch das Universitätsmanagement bietet sich als Rekrutierungsbasis der “Opinion Leaders” an; aber es müssen auch Anstrengungen intensiviert werden, Leute von außerhalb der Universität zu gewinnen. Bei der Gewinnung und Einbindung von Herrn Prof.Pribyl, Referatsleiter in der Wiener Wirtschaftskammer, der bei der letzten Generalversammlung auch in den Wissenschaftlichen Beirat gewählt wurde, ist man den richtigen Weg gegangen. Auch auf die Bereiche Diplomatie und Internationale Organisation sollte man ein Augenmerk hinsichtlich der Rekrutierung von Mitgliedern legen. Diese Rekrutierung könnte u.a. über die bereits praktizierte “member-gets-member”-Strategie erfolgen, d.h. jedes aktive Mitglied versucht, andere Mitglieder aus seinem Bekanntenkreis zu gewinnen.
9. Informelle Vereinbarkeitsprüfung bei neuen Mitgliedern
Angesichts der Geschichte des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) ist es empfehlenswert, sich bei der Aufnahme eines neuen Mitglieds vorher zu überlegen, ob seine Mitgliedschaft nicht z.B. durch die Nähe zu einer bestimmten Organisation möglicherweise einmal ein P.R.-Problem auslösen könnte. Heftige Kämpfe hätten dem UZF in seiner Geschichte erspart werden können, wenn man das von vornherein bereits abgeklärt hätte, was man in Hinkunft bei den “Neuen” meiner Meinung nach tun sollte.
10. Studenten
Studenten erscheinen mir als wichtige Zielgruppe des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF). Daß man sie ansprechen will, davon zeugt alleine die Tatsache, daß man Lehrveranstaltungen organisiert und mit großem Engagement durchführt. Zur Verbreitung der Friedensideen und Sensibilisierung für das Thema macht das auch unbedingt Sinn. Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der einmal in eine wichtige Entscheidungsposition kommt, der nicht zuvor irgendwann in seinem Leben Student an der Universität gewesen ist. Es wäre doch gut, wenn sich möglichst viele solcher Entscheidungsträger irgendwann in ihrem Leben einmal über den Frieden Gedanken gemacht haben, womöglich noch wissenschaftlich fundiert, und vielleicht später in diesem Sinne wirken - und wenn sie es nicht in jungen Jahren tun, wann sollen sie sich sonst für Ideale wie den Frieden begeistern? Es ist zwar niemals zu spät, die Jugend scheint aber die beste Zeit für Ideale.
Woher bekommt ein Student seine Informationen über Lehrveranstaltungen? Da ich selbst Student bin, brauche ich diesbezüglich keine aufwendigen Befragungen durchführen, denn meine Quellen und die meiner Kollegen sind mir hinlänglich bekannt.
Die erste Quelle ist das “große” Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien.
Die zweite Quelle sind die “kommentierten” Vorlesungsverzeichnisse für jede einzelne Studienrichtung. (Papier- sowie Internetausgabe)
Die dritte Quelle sind Aushänge am jeweiligen Institut, und zwar an den Türen der am Institut ansässigen Professoren sowie an einigen ganz bestimmten anderen Stellen (“Schwarzes Brett”).
Daneben spielt noch die “Mundpropaganda” im Sinne der “Gerüchteküche” eine gewisse Rolle, je nachdem, wie intensiv die Kontakte zu anderen Studenten sind, wieviel man auf die Meinung der anderen gibt und wieviele sonstige Informationen zur Verfügung stehen.
Man muß unbedingt sicherstellen, in den genannten Quellen möglichst umfassend präsent zu sein. Eine Kurzbeschreibung der Vorlesung, Übung etc. im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis ist auch eine Plattform der Kommunikation; so etwas sollte man daher sehr sorgfältig schreiben und nicht als “lästige Pflicht” ansehen.
Ich mache bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, daß ein und dieselbe Lehrveranstaltung im “großen Vorlesungsverzeichnis” durchaus auch unter mehreren Studienrichtungen aufscheinen kann, was häufig praktiziert ist; es sollte die Anrechenbarkeit mit der jeweiligen andere Studienrichtung vorher “offiziell” abgeklärt werden und nicht, wie bisher, die Anrechnung rein der Eigeninitiative überlassen werden. Ein nicht unwesentlicher Grund für Studenten, eine Veranstaltung zu besuchen, besteht nämlich nun einmal darin, weil sie günstig anrechenbar ist.
Es ist auch für die Anrechenbarkeit wichtig, daß das Lehrveranstaltungsangebot vergrößert wird, denn oft braucht ein Student z.B. nicht nur zwei, sondern z.B. sechs oder acht Wochenstunden aus einem Wahl- oder Spezialfach, je nach Studienplan. Ich meine, jeder im UZF aktive Professor der Philosophie könnte zumindest einmal pro Jahr eine Veranstaltung zur Friedensforschung in eigener Verantwortung abhalten; auch darum ist es wichtig, mehr entsprechende Professoren für das UZF zu gewinnen. Die Zahl der Lehrveranstaltungen zur Friedensforschung ist noch steigerungsfähig! Die Lehrveranstaltungen sind auch eine gute Plattform, um potentielles Publikum für die anderen Kongresse direkt ansprechen zu können, z.B. wenn man den Kongreß zu einem Teil der Lehrveranstaltung erklärt, die reguläre Vorlesung ausfallen läßt und dafür auf die Wichtigkeit einer Teilnahme am Kongreß etwa für eine Prüfung hinweist. Man könnte, wenn man einen gewissen Grundstock an Studenten hinbringt, auch “peinlichen” Situationen vorbeugen, daß z.B. ein Saal halb leer ist, was etwa in der Vergangenheit zwar nicht bei Symposien, aber bei manchen Forschungsgesprächen immer wieder passiert ist. Außerdem ist es doch schade, wenn das UZF so engagierte Kongresse organisiert, interessierte Studenten es aber vielleicht gar nicht erfahren - wie sollten sie, wenn nicht in Lehrveranstaltungen? Die Frage stellt sich, ob man in Lehrveranstaltungen nicht auch Studenten auf die Möglichkeit einer Mitgliedschaft aufmerksam machen sollte, Anreize dafür schafft (z.B. ermäßigte Mitgliedsbeiträge) und spezifische Kommunikationsangebote (z.B. prüfungsrelevante Infos auf der Homepage etc.).
11. Institutionelle Verankerung der P.R.
Die Öffentlichkeitsarbeit ist am gegenwärtigen “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) nicht institutionell verankert. Eine solche Verankerung könnte dazu führen, daß die Öffentlichkeitsarbeit stärkere Berücksichtigung erfährt, was der gesamten Organisation zugute käme.
Daher würde sich die Schaffung einer eigenen Funktion empfehlen, für die ich die Bezeichnung “P.R.-Beauftragter” oder alternativ dazu “P.R.-Manager” vorschlage. Die optimalen Rahmenbedingungen für eine solche Tätigkeit sind u.a. in Anknüpfung an Cutlip, Center und Broom und Berücksichtigung der UZF-spezifischen Situation folgende:
Zunächst dürfte ein in der Praxis häufiger Fehler von vornherein nicht begangen werden. Dieser besteht darin, daß leitende Persönlichkeiten einer Organisation oftmals so etwas denken wie “Jetzt hab ich einen P.R.-Mann, das ist fein, dann brauche ich mich um Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr zu kümmern.” Diese Sichtweise ist aus vielen verschiedenen Gründen heraus verhängnisvoll. Wenn es eine abgesicherte Erkenntnis der P.R. gibt, dann jene, daß eine Organisation in der Öffentlichkeit v.a. durch die Handlungen ihrer führenden Persönlichkeiten wahrgenommen wird. Das Engagement der leitenden Funktionäre ist daher zu jeder Zeit gefragt, ein P.R.-Beauftragter kann sie dabei nur unterstützen. Außerdem sollte allgemein eine Sensibilität des Top-Managements für die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit für eine Organisation bestehen. Jeder sollte bei allem, was er tut, u.a. mitbedenken, daß es einen Einfluß auf die Öffentlichkeitsarbeit haben könnte und dies bei der Planung und Setzung seiner Handlungen berücksichtigen.
Man müßte auch die Aufgabe eines P.R.-Beauftragten von vornherein insoferne klar umgrenzen, daß man “Öffentlichkeitsarbeit im engeren Sinne” darunter versteht. Das liegt daran, weil Organisationen in der Regel dazu neigen, einen P.R.-Beauftragten mit nicht zu seiner Kernaufgabe gehörenden Tätigkeit zu “überfremden”. Lehrbücher berichten z.B. von einem armen P.R.-Manager einer sozialen Vereinigung, der beauftragt wurde, die Hausverwaltung quasi “mitzuübernehmen”. Danach wurde ihm noch aufgebürdet, die Obdachlosen am Eingang zu empfangen und in die Wärmestube zu geleiten. So kam er nicht zu anderen Aktivitäten und seine Öffentlichkeitsarbeit wurde ineffizient - er hatte nämlich keine Zeit mehr dafür.
Warum besteht eine solche Gefahr der “Überfremdung” mit zusätzlichen Aufgaben gerade bei einem P.R.-Mann? Ich führe es darauf zurück, weil es fast nichts gibt, was - im weitesten Sinne - nichts mit der Wirkung auf die Öffentlichkeit zu tun hat. In der Museums-P.R. heißt es z.B., daß die Freundlichkeit des Personals beim Empfang einen wesentlichen Einfluß auf das Image eines Museums hat. Ich bin zudem überzeugt, daß saubere Toiletten etwa in einem Gasthaus durchaus Einfluß auf die Art und Weise haben, wie dieses in der Öffentlichkeit gesehen wird. Trotzdem ist ein P.R.-Beauftragter keine Empfangsdame und schon gar kein Toilettenschrubber. Der P.R.-Manager ist meist nicht der oberste Chef, er hat in der Regel also Vorgesetzte im Unternehmen, aber effiziente P.R. ist dennoch ihrem Wesen nach eine mit Verantwortung verbundene Managementaufgabe.
Ein P.R.-Beauftragter im “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) wird wohl niemandem eine Arbeit “wegnehmen”, noch dazu, wenn sie gerne getan wird. Wenn es im UZF z.B. keine Zeitschrift oder kein Engagement im Internet gäbe, würde ich meinen, der P.R.-Beauftragte sollte die Leitung über diese wichtigen Gebiete übernehmen. Jetzt gibt es aber im UZF schon bewährte Mitarbeiter, die diese Aufgabenbereiche innehaben und hervorragend bewältigen. Der P.R.-Beauftragte soll sie daher bei diesen Aktivitäten zwar unterstützen, aber ihnen ihre Gebiete nicht streitig machen. Es gibt wirklich eine riesige Fülle anderer wichtige Arbeiten, die noch keinen Verantwortlichen aufweisen; auf diese soll er sich konzentrieren. Beispiele dafür sind die Betreuung eines Corporate Identity-Prozesses, die Presse- und Medienarbeit, die Gestaltung von Informationsmaterial (z.B. eventuelle Broschüren und Info-Mappen; aber er soll u.a. in die Gestaltung aller Aussendungen miteinbezogen werden), er kann auch Verhandlungen und Sondierungsgespräche im Rahmen von Organisationsarbeit zu Veranstaltungen führen etc. Es könnte auch eine Beteiligung am Gebiet des Fund Raising geben, wenngleich eine ausschließliche Verantwortlichkeit hier nicht zweckmäßig wäre - jeder soll helfen, finanzielle Mittel aufzutreiben, wo es nur geht. Ferner wird er generell beratende Aufgaben in Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen und wohl der Generalversammlung als höchstem Gremium über seine Aktivitäten bei ihrem Zusammentreten Bericht erstatten.
Der Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit muß nicht unbedingt selbst Vorstandsmitglied sein. Aber man sollte auch einen anderen häufigen Fehler der Praxis vermeiden: P.R.-Manager werden in manchen Unternehmen weitgehend von der internen Kommunikation ausgeschlossen; die wichtigsten Entscheidungen werden ohne sie getroffen. Anschließend werden sie vor die vollendeten Tatsachen gestellt, die in keinster Weise dem P.R.-Standpunkt gerecht werden und die ihnen - aus der Perspektive ihres ja nicht gänzlich unbedeutenden Fachgebietes - absurde, ja imageschädigende Aufträge erteilen. Eine Beeinflussung der strategischen Beschlüsse im Vorfeld der Entscheidung ist wenigstens insoweit sinnvoll, daß er unverbindliche Vorschläge unterbreiten, seine Meinung zu jeder Zeit offen sagen können muß und daß er ferner am internen Diskussionsprozeß teilnimmt; eine solche Vorgangsweise ist zur Erfüllung einer solchen Aufgabe unabdingbar. Wie soll man außerdem die externe Kommunikation einer Organisation managen können, wenn man von der internen Kommunikation weitgehend ausgeschlossen ist? Man weiß ja dann gar nicht, in welche Richtung sich die Organisation gerade entwickelt, die man vertreten muß! Franz Bogner, langjähriger Präsident des Public Relations Verbandes Austria (PRVA), nennt den Ausschluß des P.R.-Managers von wichtigen Sitzungen sogar eine “Todsünde wider die Öffentlichkeitsarbeit”.
Ein P.R.-Beauftragter muß in einer Organisation eine Art “loyale Opposition” sein. D.h. er muß das Recht bekommen - hinter verschlossenen Türen - alles und jedes ausgiebig zu kritisieren und dabei u.a. auch den höchstrangigen Funktionären zu widersprechen. Das ist insoferne wichtig, weil sonst keine Verbesserungen stattfinden können. Man nimmt sich ja auch keinen Arzt, damit man dann beleidigt ist, wenn er ein Gesundheitsproblem feststellt; genausowenig sollte man auf den P.R.-Verantwortlichen beleidigt sein, wenn er ein P.R.-Problem beim Namen nennt. Es empfiehlt sich die Besetzung des entsprechenden Amtes daher mit einem Querdenker, der nicht nur “ja” sagt, weil alle es hören wollen; es muß jemand sein, der sich traut, seine (selbstredend argumentativ begründete) Meinung auch zu äußern.
Allgemein könnte ein institutionelle Verankerung der Öffentlichkeitsarbeit im UZF dazu beitragen, die Perspektive dieser für die Selbstbehauptung jeder Organisation zentralen Disziplin aufzuwerten.
12. Zusammenfassung: Der taktische Block
Veranstaltungen.
1.Hauptveranstaltung: Ein stark vorbereitetes Symposium pro Jahr zu wissenschaftlichem Thema aus dem Bereich der Friedensforschung (insbesonders aus dem Bereich der Schwerpunktsetzung).
2.Hauptveranstaltung: Ein Friedensdialog der Weltreligionen pro Jahr als spezielles, kompetent mediiertes Symposium
Nebenveranstaltungen: Drei bis vier öffentlich zugängliche Forschungsgespräche pro Jahr, im Rahmen von Lehrveranstaltungen und des Wissenschaftlichen Beirates
Lehrveranstaltungen: Angestrebter Ausbau des Lehrveranstaltungsangebotes auf acht Semesterwochenstunden pro Studienjahr zur Schwerpunktsetzung.
Zeitschrift.
Viermal jährliche Publikation der wissenschaftlichen Fachzeitschrift “Wiener Blätter zur Friedensforschung”, Versendung an UZF-Mitglieder, Austausch mit einschlägigen Forschungsinstitutionen, P.R.-Geschenke an “Opinion Leaders” aus dem Bereich Wissenschaft, Diplomatie etc. sowie an Studenten, die einschlägige Vorlesungen besuchen.
Homepage.
Gewährleistung einer ständig gewarteten und aktualisierten Homepage mit Informationen zur Organisation, zum Fach, zu Veranstaltungen und zur Zeitschrift, mit Mehrsprachigkeit, ansprechendem und dennoch nüchternem, übersichtlichem Design, geringen Ladezeiten, ausreichenden Feedback-Möglichkeiten und laufender Evaluation.
Aussendungen.
Aussendung in Form von Ankündigungen der Veranstaltungen an die im Verteiler angeführten potentiellen Interessenten, in Form von Briefen an Mitgliedern etc.
Zusatzpublikationen.
Streben nach Gewährleistung von Zusatzpublikationen (Broschüren, Bücher etc.) zur Organisation selbst und ihren Forschungserbenissen.
Presse- und Medienarbeit.
Presse- und Medienarbeit via Presseaussendungen, OTS, persönliche Einladungen von Journalisten zu den Haupt- und Nebenveranstaltungen, Presse- bzw. P.R.-Mappe.
Schritt 4:
Evaluation
1. Legitimatorische versus tatsächliche Evaluation
Es gibt zwei Arten von Evaluation: legitimatorische und tatsächliche. Erstere Form der Evaluation ist nur eine scheinbare; man will irgendetwas machen und “sucht” nach Rechtfertigungen. Man präsentiert Veranstaltungen, Newsletter etc. als Erfolg, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob sie wirklich Erfolge gewesen sind oder nicht. Dabei werden u.a. auch Daten manipuliert. Diese Vorgangsweise ist abzulehnen. Natürlich wird eine Organisation dazu neigen, v.a. die für sie vorteilhaften Ergebnisse der Evaluation nach außen zu präsentieren. Dennoch muß es, zumindest intern (für den “Eigenbedarf”), auch eine tatsächliche Evaluation geben. D.h. man muß Untersuchungen wirklich durchführen und “unmanipuliert” auswerten, damit man weiß, “wie es so läuft”. Nur wenn das geschieht und man ohne Rücksicht auf das, was man gerne hätte, die Meinung des Publikums und sowohl die Erfolge, als auch die Mißerfolge kennt, kann man seine P.R.-Aktivitäten verbessern.
Fehler machen ist, wie bereits bemerkt, keine Schande, sondern die Schande liegt darin, aus diesen nicht zu lernen, was an Ignoranz und Sturheit liegen kann, aber u.a. auch daran, daß man Fehler aufgrund des Fehlens von Evaluation gar nicht wahrnimmt. P.R. plädiert für die “Öffnung” von geschlossenen Systemen für Anregungen von außen, auch wenn sie manchmal unangenehm sind; nur dann nämlich kann man einen öffentlichen Auftritt optimieren.
2. Zur Sinnhaftigkeit von Meinungsumfragen trotz finanzieller Grenzen des UZF
Der budgetäre Rahmen des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) ist eng umgrenzt. Es stehen der Vereinigung, so der gegenwärtige Stand, ca.12.000 Euro operatives Budget pro Jahr zur Verfügung. Davon muß der größte Teil auf die Druckkosten, Versand, Redaktion etc. der Zeitschrift verwendet werden, dann gibt es die Posten Bürobedarf und Portogebühren, dann wird einiges für Veranstaltungen ausgegeben; viel bleibt nicht übrig. Es ist ein Faktum, daß das UZF froh sein muß, wenn es irgendetwas für zusätzliche P.R.-Maßnahmen ausgeben kann. Es steht fest, daß sich das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) keine allzu teuren Evaluationsmaßnahmen leisten können wird.
Natürlich stellt sich die Frage, ob z.B. eine wissenschaftliche Umfrage bei einem professionellen Meinungsforschungsinstitut zur Erhebung des Ist-Zustandes (Bekanntheitsgrad und Image unter den Zielgruppen) nicht eine gute Investition und ökonomisch sinnvoll wäre. Man könnte auf dieser Basis Stärken und Schwächen besser erkennen und aktiver darauf hinarbeiten, Image-Defizite auszugleichen.
Momentan wird die Durchführung von Auftragsumfragen schwer möglich sein, weil der budgetäre Rahmen der Organisation sehr gering ist. Dennoch sei festgestellt, daß Meinungsumfragen aller Art sehr wohl Relevanz besitzen würden; nur wenn man weiß, was das Zielpublikum eigentlich will, kann man effizient darauf eingehen. Das “Universitätszentrum für Friedensforschung” (UZF) sollte Meinungsumfragen, welche in wissenschaftlichen Fachmagazinen etc. zu Friedensforschungsthemen in anderem Zusammenhang publiziert werden, sammeln und berücksichtigen.
3. Informelle oder ohnehin bereits vorhandene Umfragen
Man muß nicht immer alle mit einem Fragebogen belästigen, um Dinge zu erfragen. “Informelle”, mündliche Umfragen bei z.B. Kongressen empfehlen sich im Falle des UZF stark. Die Teilnehmer sind doch eine Gruppe, die überschaubar ist, noch dazu, wenn man viele davon kennt. Man soll möglichst viele nach ihrer Meinung zur Veranstaltung, zu den einzelnen Blöcken etc. fragen und sich einfach mal “umhören”.
Wichtig ist aber, herauszufinden, wie die Teilnehmer auf die Veranstaltung aufmerksam geworden sind und was für ihre Teilnahme ausschlaggebend war, ferner was ihnen gefallen hat und was nicht (außerdem natürlich, wer ein “Opinion Leader” oder ein Journalist ist, den sollte man dann nämlich auch gleich mit vorbereitetem Informationsmaterial “beglücken”; man kann Visitenkarten austauschen und seine Adresse dann in den “Aussendungsverteiler” aufnehmen).
Die Universität Wien führt standardmäßig Fragebogenerhebungen zu ihren Lehrveranstaltungen durch. Man sollte für das UZF die ohnehin vorhandenen Ergebnisse ernst nehmen, erschließen und dokumentieren. Es ist auch wichtig, zu Beginn und am Ende der Lehrveranstaltungen die Studenten mündlich zu befragen, was gefallen hat und was nicht etc. und wie sie auf die Veranstaltung aufmerksam geworden sind, was sie sich in Zukunft erwarten würden etc. Diese Rückmeldungen sollten dann auch vom Lehrveranstaltungsleiter schriftlich festgehalten und dokumentiert werden.
4. “Unaufdringliche Methoden”
Ich denke aufgrund der hohen Kosten z.B. der Auftragsumfragen, daß man sich in der Evaluation auch auf jene Methoden besinnen sollte, die Cutlip, Center und Broom als “unaufdringliche Methoden” bezeichnen. Es handelt sich dabei um Methoden, die sehr kostengünstig (praktisch gratis) sind und ohne viel Aufwand durchgeführt werden können. Es ist auch nicht das Einverständnis einer getesteten Gruppe erforderlich, wie z.B. bei einer Umfrage, wo derjenige einverstanden sein muß, der einen Fragebogen ausfüllt.
Unaufdringliche Methoden können sehr kreativ gewählt werden; es geht aber v.a. auch um ganz naheliegende Sachen. Eine Blutbank weiß z.B. genau: Wieviele Blutkonserven bekamen wir angeliefert? Wieviele wurden verwendet? Wieviele wurden weggeworfen? etc. Aus solchen einfachen Daten kann man Aussagen zur Organisation und vielleicht auch zur P.R. ableiten. Es geht aber auch kreativ: Ein Museumsdirektor kann sich ansehen, welche Teile des Bodens wegen Abwetzung häufig erneuert werden müssen etc., dann weiß er auch, welche Vitrinen seines Museums vom Publikum angesehen werden und welche nicht. Auch die Nachfrage nach z.B. Gratis-Broschüren oder Anmeldungen aller Art (wenn vorhanden) können leicht quantitativ festgestellt werden.
Im Falle des “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) gibt es folgende Daten, die intern bekannt sein müssen, eine genaue Erhebung und Verfügbarkeit für interne Zwecke empfiehlt sich. Die Daten sind: Genaue Mitgliederzahl, genaue Zahl der verbreiteten Auflage der Zeitschrift, Budgetzahlen. Ganz leicht kann man ferner erheben die Zahl der Teilnehmer an Lehrveranstaltungen, aber auch an Symposien und Forschungsgesprächen.
Man sollte auch die Briefe, e-mails etc., die Anregungen, Kritik und Vorschläge beinhalten, ernst nehmen und aufheben; man kann diese durchaus auch sinnvoll statistisch auswerten.
5. Medienresonanzanalyse
Einen einzelnen Artikel im “Kurier” einer Medienresonanzanalyse zu unterziehen ist wenig sinnvoll. Aber wenn die Presse- und Medienarbeit in ferner Zukunft einmal “in Schwung” gekommen sein sollte, könnte man vielleicht auf die Methode der Medienresonanzanalyse zurückgreifen. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine statistische Auswertung der Clippings (= Sammlungen der Artikel in Zeitungen, Zeitschriften etc., die möglichst vollständig sein sollten) nach den unterschiedlichsten Kriterien - von der Größe der Artikel bis zur “Benotung” hinsichtlich der Erfüllung des P.R.-Ziels (für die natürlich auch einheitliche Kriterien festgesetzt werden müssen).
6. Evaluation der Internetpräsenz
Es gibt einschlägige Computerprogramme, die automatisiert Aufschluß geben können über monatliche Zugriffszahl auf die Homepage und die Herkunft der User. Man müßte sich einmal erkundigen, wie das an der Universität Wien gehandhabt wird (Ansprechpartner für Philosophie wäre meiner Ansicht nach Prof.Hrachovec). Dem Webmaster des UZF sind keine entsprechenden Daten bekannt. Man könnte auch eine Umfrage durchführen unter bestimmten Zielgruppen, was sie von einem Informationsangebot einer Homepage eigentlich erwarten würden bzw. Verhaltensbeobachtungen einzelner User.
7. Umfassende Dokumentation
Es empfiehlt sich aus Evaluationsgründen die Anlegung einer umfassenden Dokumentation sämtlicher Kommunikationsaktivitäten. Damit die erhobenen Daten nicht für rein “legitimatorische Zwecke” mißbraucht werden, sollte man eine solche Dokumentation nur für den internen Gebrauch bestimmen. Wenn “Externe” sie benutzen dürften, würde man dazu neigen, schönzufärben, was die Dokumentation nutzlos machen würde.
Eine Dokumentation kostet praktisch nichts, kann unter Umständen aber für die Evaluation sehr wichtig sein. Ich hätte z.B. solches Datenmaterial für die “Kommunikationsprüfung” gut brauchen können, aber leider sagte mir die Generalsekretärin auf Anfrage, daß es so etwas wie eine umfassende Dokumentation aller Kommunikationsmaßnahmen im UZF nicht gäbe. Das ist wirklich schade, denn in jeder umfassenden Dokumentation stecken wertvolle Daten, die man mit etwas Kreativität aussagekräftig auswerten kann - was trotz des schlechten Rufs der empirischen Methoden unter Studenten nicht unbedingt langweilig sein muß. Ich bin überzeugt, wenn es eine solche Dokumentation gegeben hätte, wäre es mir möglich gewesen, durch die Anwendung sozialwissenschaftlicher Methoden eine ähnlich gründliche statistische Durchleuchtung aller einzelnen Kommunikationsmaßnahmen zu treffen wie ich es so nur bei der Zeitschrift tun konnte. Es ist bedauerlich, daß mir die gute Gelegenheit für eine wahrscheinlich aufschlußreiche statistische Auswertung entgangen ist.
Es sollte im UZF auf jeden Fall so etwas wie eine “zentrale Datenstelle” eingerichtet werden, die im Prinzip aus einem (oder auch mehreren) Aktenordner im “Hauptquartier” am NIG in z.B. einem bestimmten Regal besteht. Dort sollte man alles ablegen, was irgendwie mit dem Auftritt in der Öffentlichkeit zu tun hat. Vielleicht sollte man inhaltlich trennen zwischen Input (den Aktivitäten, die vom UZF ausgehen) und Output (den Rückmeldungen, die zum UZF kommen).
Zum Input gehören z.B. Aussendungen aller Art, etwa Rundschreiben, verschickte Einladungen, Briefe an “strategisch wichtige” Personen, eventuelle Presseaussendungen etc. - einfach alles Schriftliche, das man hat. Im Output könnte man z.B. dokumentieren: Zuschriften an das UZF, die Anregungen, Kritik, Vorschläge etc. enthalten, sowohl Briefe, Fax als auch e-mails, die Ergebnisse der Evaluationen der Lehrveranstaltungen durch die Universität Wien, die genauen Zahlen über Mitglieder, Auflage, Budget etc.
8. Einrichtung von internen “Nachbesprechungen”
Es ist keine perfekte, auch keine außerordentlich wissenschaftliche Methode, aber in der Praxis gut bewährt: Nach einer Veranstaltung sollten sich einige UZF-Funktionäre zusammensetzen und gemeinsam diskutieren, was gut und was schlecht an der Veranstaltung war. Beim Militär nennt man das “Manöverkritik”, vielleicht kann man es auch in einem Friedensforschungszentrum nutzbar machen. Dabei ist natürlich wichtig, daß wirklich - unter Ausschluß der Öffentlichkeit - offen und kritisch über die Veranstaltung gesprochen wird, ohne daß jemand beleidigt ist, wenn eine solche Kritik geäußert wird. Es ist auch wichtig, daß die Teilnehmer der Nachbesprechungen bei der Veranstaltung auch anwesend waren und sich - zumindest informell - bei den Teilnehmern nach deren Meinung umhörten und diese ungefähr widergeben. Ähnliches findet im UZF sicherlich bereits statt, ich schlage aber vor, Nachbesprechungen als eigenes Gremium zu “institutionalisieren” und wirklich jedes Mal durchzuführen, etwa als eine Art informeller “Evaluationsrat”. Es sollten Zusammenfassung, Anregungen und Kritik eines solchen Gremiums auch in einem Protokoll zusammengefaßt und ebenfalls in der “Dokumentationsstelle” unter “Output” abgelegt werden.
9. Anerkennungspreise
Ebenfalls keine wissenschaftliche Methode, aber doch eine gewisse “Evaluation aus der Praxis” liegt vor, wenn eine Organisation für ihre Arbeit einen Preis erhält, insbesonders von einer gewissen Autorität mit guter Reputation. Das Friedenszentrum in der Burg Schlaining erhielt z.B. einen Anerkennungspreis der UNESCO, was in seiner Öffentlichkeitsarbeit auch betont wird.
Vielleicht könnte sich das “Universitätszentrums für Friedensforschung” (UZF) an dieser nicht unerfolgreichen vergleichbaren Organisation orientieren, indem es die Verleihung eines Anerkennungspreises z.B. durch eine Organisation wie die OSZE oder eines ihrer Organe (z.B. den Hochkommissar für Minderheiten) aktiv anstrebt.
Literatur
Gertrud ACHTERHOLZ, Corporate Identity. In zehn Arbeitsschritten die eigene Identität finden und umsetzen. Wiesbaden 1991.
Hannah ARENDT, Macht und Gewalt. München (14.Auflage) 2000.
Wilhelm ARNOLD, Hans Jürgen EYSENCK, Richard MEILI, Lexikon der Psychologie. Augsburg 1996.
AUGUSTINUS, Der Gottesstaat. Einsiedeln 1961.
Barbara BAERNS, PR-Erfolgskontrolle. Messen und Bewerten in der Öffentlichkeitsarbeit. Verfahren, Strategien, Beispiele. Frankfurt am Main 1995.
Barbara BAERNS, Public Relations 1996: Kampagnen, Trends & Tips. Düsseldorf 1996.
Erwin BADER, Für ein Europa des Geistes. In: Günther WITZANY (Hg.), Zukunft Österreich. EU-Anschluß und die Folgen. Salzburg 1998. S.9-50
Erwin BADER, Zum bleibenden Wert der immerwährenden Neutralität Österreichs. Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.90, S.31-40
Erwin BADER, Die “Wahrheit des Ganzen”. Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.100, S.116-119
Erwin BADER, Der Ausschließlichkeitsanspruch der Christentums und der Hinduismus. Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.101. S.26-48
Wilhelm BAUM, Ludwig Wittgenstein. Berlin 1985.
Kirsten BERTH, Göran SJÖBERG, Quality in Public Relations. Kopenhagen 1997.
Gary BITTNER, The Need for a Christian-Islamic Dialogue as a Method of Peace Assurance, Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.96, S.45-50
Ulrich BOBINGER, Erfolgreiche Pressearbeit: Ein Leitfaden für Pressestellen in Unternehmen, Behörden und Verbänden. Rostock (2.Auflage) 1995.
Franz BOGNER, Das Neue PR-Denken. Strategien, Konzepte, Aktivitäten. Wien 1999.
Manfred BRUHN, Effizientes Kommunikationsmanagement: Konzepte, Beispiele und Erfahrungen aus der integrierten Unternehmenskommunikation. Stuttgart 1993.
Manfred BRUHN, Integrierte Unternehmenskommunikation. Stuttgart 1995.
Manfred BRUHN, Sponsoring. Systematische Planung und integrativer Einsatz. Frankfurt am Main 1998.
Hauke BRUNKHORST, Hannah Arendt. München 1999.
Christine BRÜNNER, Zur Praxis der PR-Evaluation in österreichischen PR-Agenturen. Diplomarbeit, Wien 1997.
Viktor BUCHER, Öffentlichkeitsarbeit für kulturelle Non-Profit-Organisationen wie die Denkmalpflege. Diplomarbeit Wien 1988.
Roland BURKART, Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder. Wien (2.Auflage) 1995.
Roland BURKART, Verständigungsorientierte Öffentlichkeitsarbeit. Der Dialog als PR-Konzeption. In: Günter BENTELE, Horst STEINMANN, Ansgar ZERFASS, Dialogorientierte Unternehmenskommunikation. Grundlagen - Praxiserfahrungen - Perspektiven. Berlin 1996. S.245-270
Roland BURKART, Online-Dialoge: eine neue Qualität für Konflikt-PR? In: Barbara BAERNS, Juliana RAUPP (Hg.), Information und Kommunikation in Europa. Forschung und Praxis. Berlin 2000.
Scott CUTLIP, Allen CENTER, Glen BROOM, Effective Public Relations. New Jersey 1998.
Johanna DORER, PR als komplexe Kommunikationsstrategie. Theorie und Praxis politischer Öffentlichkeitsarbeit. Dissertation, Wien 1992.
Johanna DORER, Politische Öffentlichkeitsarbeit in Österreich: Eine empirische Untersuchung zur Public Relations politischer Institutionen. Wien 1995.
Klaus DÖRRBECKER, Renée FISSENEWERT-GOSSMANN, Wie Profis PR-Konzeptionen entwickeln. Frankfurt am Main 1997.
Margot DROBITS, Das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung. Dokumentation der Berichterstattung in österreichischen Printmedien unter Berücksichtigung der Öffentlichkeitsarbeit. Diplomarbeit, Wien 1998.
Peter DRÖSSLER, Öffentlichkeitsarbeit von Nichtregierungsorganisationen in Österreich. Ein handlungs- und partizipationsorientierter Entwurf einer gemeinsamen PR-Strategie für Umwelt-, Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen. Diplomarbeit, Wien 1994.
Gerlinde Elisabeth EHRENSTRASSER, Die Öffentlichkeitsarbeit der chemischen Industrie am Beispiel des Fachverbandes der chemischen Industrie Österreichs. Diplomarbeit, Wien 1988.
Josef Christian EISTERT, Professionelle Öffentlichkeitsarbeit im kommunalen Bereich am Beispiel ausgewählter niederösterreichischer Städte. Diplomarbeit, Wien 1994.
Renate ENÖCKL, Die Öffentlichkeitsarbeit von sozialen Nonprofit-Organisationen am Beispiel des Österreichischen Roten Kreuzes. Diplomarbeit, Wien 1995.
Andrea FELDHOFER, Öffentlichkeitsarbeit politischer Parteien am Beispiel von SPÖ und ÖVP: Die Bedeutung interner Kommunikationsstrategien für die externe Öffentlichkeitsarbeit. Diplomarbeit Wien 1990.
Claudia FISCHER, Öffentlichkeitsarbeit einer Nonprofit-Organisation: Die deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft. Bochum 1995.
Gabriele FISCHER, PR als strategischer Erfolgsfaktor. Eine kritische Unternehmensführung. Ludwigsburg 1991.
Roger FISHER, William URY, Bruce PATTON, Das Harvard-Konzept. Sachgerecht verhandeln - erfolgreich verhandeln. Frankfurt am Main, New York (18.Auflage) 1999.
Nicole FRIEDRICH, Öffentlichkeitsarbeit für Theater verstanden als kulturpolitische Aufgabe. Diplomarbeit, Wien 1992.
Christian FUHRMANN, Die Öffentlichkeitsarbeit der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 in der EU-Frage: Erarbeitung eines PR-Konzeptes auf der Grundlage von kommunikationstheoretischen, -praktischen und Marketing-Aspekten. Diplomarbeit, Wien 1994.
Gerals FURIAN, Bürgerinitiativen und Öffentlichkeitsarbeit: Eine kritische Evaluation der PR-Aktivitäten zweier Bürgerinitiativen im Zuge der Planung von Sondermülldeponien. Diplomarbeit, Wien 1993.
Sabine FÜRST, Qualität im Pressestellen-Journalismus. Dissertation, Salzburg 1996.
Leo GABRIEL, Gestalten und Strukturen des integrativen Denkens. In: Sonderdruck aus: Philosophische Selbstbetrachtungen Bd.4, Verlag Peter Lang, Bern u.a. 1978.
Johan GALTUNG, Eurotopia. Die Zukunft eines Kontinents. Wien 1993.
Johan GALTUNG, Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung. Reinbek bei Hamburg 1981.
Thomas GAZLING, Erfolgreiche Pressemitteilungen: Über den Einfluß von Nachrichtenfaktoren auf die Publikationschancen. In: Publizistik Jg.44, 1999, Heft 2, S.185-199
Helmuth von GLASENAPP, Die fünf Weltreligionen. Hinduismus, Buddhismus, Chinesischer Universismus, Christentum, Islam. Sonderausgabe, München 1996.
Andrea GOTZMANN, Corporate Identity in der Risikogesellschaft. Diplomarbeit, Wien 1993.
Marc GRAMBERGER, Die Öffentlichkeitarbeit der Europäischen Kommission 1952-1996: PR zur Legitimation
Elizabeth GRANDWILLE, Öffentlichkeitsarbeit der österreichischen Hochschulen. Dissertation, Wien 1981.
Anne GREGORY, Planning and managing a Public relations campaign: A step by step guide. London 1996.
James GRUNIG (Hg.), Excellence in Public Relations and Communication Management. New Jersey, 1992.
Caroline HAAS, Öffentlichkeitsarbeit im Kulturbereich. Eine theoriegeleitete Einschätzung der Öffentlichkeitsarbeit kultureller Institutionen am Beispiel des Musikfestivals “Wien modern”. Diplomarbeit, Wien 1990.
Kurt HACKL, Kommunale Öffentlichkeitsarbeit und deren Probleme in Bezug auf Bürgerbeteiligung anhand der Stadtgemeinde Wolkersdorf. Diplomarbeit, Wien 1991.
Sandra HEDINGER, Frauen über Krieg und Frieden. Bertha von Suttner, Rosa Luxemburg, Hannah Arendt, Betty Reardon, Judith Ann Tickner, Jean Bethke Elshtain. Frankfurt am Main 2000.
Dieter HERBST, Corporate Identity. Berlin 1998.
Andreas HÖFERL, Die Öffentlichkeitsarbeit der österreichischen Arbeiterkammern, Diaaertation Wien, 1988.
Martin HOFFMANN, Öffentlichkeitsarbeit von Nonprofitorganisationen am Beispiel des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie “Elekroindustrie”. Diplomarbeit, Wien 1997.
Angelika HÖLLRIEGL, PR für soziale Anliegen dargestellt an einem Spezialfall - PR für Frauenprojekte. Eine standortbestimmung und Bestandsaufnahme am Beispiel der AÖF (Aktionsgemeinschaft der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser). Diplomarbeit, Wien 1993.
Karl HÖRMANN, Die Anfänge des Instituts für Friedensforschung, Wiener Blätter Nr.1, S.2-4
Patrick HORVATH, Machiavelli. Über das Spannungsfeld von Politik und Moral. Diplomarbeit, Wien 2000.
Patrick HORVATH, Zur Identitätsbildung Jugendlicher durch die neuen Medien. In: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Hg.): Medienimpulse Nr.37. Beiträge zur Medienpädagogik. September 2001.
Brigitte HOSTIALEK, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für Theater. Eine Untersuchung derLinzer Theaterszene. Diplomarbeit, Wien 1988.
David HUME, Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Stuttgart 1982.
Samuel P. HUNTINGTON: Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21.Jahrhundert. München, Wien (5.Auflage) 1997.
INSTITUT FÜR FRIEDENSFORSCHUNG und INTERNATIONALES INSTITUT FÜR DEN FRIEDEN (Hg.): Christen und Marxisten im Friedensgespräch. Band 2: Materialien dreier wissenschaftlicher Symposien. Wien u.a. 1979.
Peter IRSIGLER, Die Öffentlichkeitsarbeit des Österreichischen Bundesheeres mit dem Beispiel der Einführung der “Draken”-Abfangjäger. Diplomarbeit, Wien 1992.
Christian J. JÄGGI, David J. KRIEGER, Fundamentalismus. Ein Phänomen der Gegenwart. Zürich und Wiesbaden 1991.
JOHANNES PAUL II., Die Schwelle der Hoffnung überschreiten. Hamburg (2.Auflage) 1994.
JOHANNES PAUL II., In der Wahrung der Menschenrechte liegt das Geheimnis des wahren Friedens. Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.100, S.6-16
Gero KALT, Peter STEINKE (Hg.), Erfolgreiche PR: Ausgewählte Beispiele aus der PRaxis. Frankfurt am Main (3.Auflage) 1997.
Gerd KAMISKE, Uwe BÜCHER (Hg.), Unternehmenserfolg durch Excellence. München (2.Auflage) 2000.
Immanuel KANT, Zum ewigen Frieden, in: Ders., Der Streit der Facultäten und kleinere Abhandlungen, S.279-333. Dortmund 1995.
Marion KARASEK, Öffentlichkeitsarbeit von Selbsthilfegruppen. Adaption und Anwendung eines organisationstheoretischen Modells. Diplomarbeit, Wien 1995.
Nadine KARSCH, Mediation in internationalen Konflikten. München 1998.
Isabella KARL, Öffentlichkeitsarbeit im Tierschutz. Analysiert am Fallbeispiel der österreichischen Tierschutzorganisation Tierhilfswerk Austria. Diplomarbeit, Wien 1996.
Robert KENDALL, Public Relations campaign strategies: Planning for implementation. New York 1992.
Ingrid KELLER, Das CI-Dilemma. Abschied von falschen Illusionen. Wiesbaden 1990.
Alfred KEUSCH, Politische Öffentlichkeitsarbeit. Diplomarbeit, Wien 1990.
Renate KEUSCH, Öffentlichkeitsarbeit im Sozialbereich. Diplomarbeit, Wien 1990.
Bettina KLAMPFERER, Die Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Wirtschaftskammer. Diplomarbeit, Wien 1993.
Rudolf Friedrich KLOCKER, Die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung. Dissertation, Wien 1993.
Karin KOCH, Kriterienerstellung für die Öffentlichkeitsarbeit von Non-Profit-Organisationen am Beispiel des Internationalen Bundes der Tierversuchsgegner. Diplomarbeit, Wien 1990.
Alfred KÖCHER, Eliane BIRCHMEIER, Public Relations? Public Relations! Konzepte, Instrumente und Beispiele für erfolgreiche Unternehmenskommunikation. Zürich 1992.
Karin KÖNIG, Das Kommunikationsmanagement von Public Relations Agenturen in eigener Sache: Eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Praxis in Österreich. Diplomarbeit, Salzburg 2000.
Barbara KRAFT, Die Öffentlichkeitsarbeit des Österreichischen Kolpingwerkes. Diplomarbeit, Wien 1995.
Jens KULENKAMPFF, David Hume. München 1989.
Alexander LANG, Rotes Kreuz und Minen. Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.102, S.28-32
Thomas LANG, Public Relations. Möglichkeiten und Grenzen der Erfolgskontrolle. Diplomarbeit, Wien 1989.
Helmut LIEDERMANN, Entminung und das humanitäre Völkerrecht. Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.102, S.19-27
Konrad Paul LIESSMANN (Hg.), Der Vater alle Dinge. Nachdenken über den Krieg. Philosophicum Lech Bd.4. Wien 2001.
Thomas LUNGKOFLER, CI und Design. Diplomarbeit, Wien 1993.
Detlef LUTHE, Öffentlichkeitsarbeit für Nonprofitorganisationen. Eine Arbeitshilfe. Augsburg 1994.
Sonja MAK, Die Öffentlichkeitsarbeit der niederösterreichischen Landesregierung im Umweltschutzbereich. Diplomarbeit, Wien 1991.
Veronika MARTINZ, Öffentlichkeitsarbeit im sozialen Bereich. Social Public Relations für, von und mit behinderten Menschen. Entwicklung eines effizienten Public Relations-Konzeptes für behindertenspezifische Einrichtungen. Dissertation, Wien 1994.
Herbert Marshal MCLUHAN, Die magischen Kanäle. Understanding Media. Düsseldorf u.a. 1992.
METZLER PHILOSOPHEN LEXIKON. Dreihundert biographisch-werkgeschichtliche Porträts von den Vorsokratikern bis zu den Neuen Philosophen. Stuttgart 1989.
Lilian MEYER, Evaluation und Erfolgskontrolle von Öffentlichkeitsarbeit. Diplomarbeit, Wien 1999.
Christiane MOSER, Die Öffentlichkeitsarbeit der AIDS-Hilfe Wien am Beispiel des Projektes “AIDS-Hilfe-Haus”. Diplomarbeit, Wien 1998.
Hans-Peter NEUHOLD, Waldemar HUMMER, Christoph SCHREUER: Österreichisches Handbuch des Völkerrechts. Band 2: Materialienteil. Wien 1983.
Volker NICKEL, Informieren muß man können: Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit der Unternehmen. Landsberg am Lech 1985.
Klaus NAUMANN, Die Rolle und Aufgabe der NATO nach dem Gipfel 1999, Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.100, S.25-37
Birgit OCZKO, Neue soziale Bewegungen und Öffentlichkeit: Die PR-Aktivitäten der Frauenbewegung Wien zum “Internatipnalen Frauentag am 8.März 1996” unter verständigungsorientierten Gesichtspunkten. Diplomarbeit, Wien 1997.
Wally OLINS, Corporate Identity. Strategie und Gestaltung. Frankfurt am Main 1990.
Regina ÖLSBÖCK, Die Öffentlichkeitsarbeit regierungsunabhängiger Organisationen am Beispiel der Österreichischen Friedensdienste unter besonderer Berücksichtigung der Kommunikation mit Angehörigen des Österreichischen Bundesheeres. Diplomarbeit, Wien 1996.
Gudrun PALLIERER, Social Communications. Öffentlichkeitsarbeit für soziale Anliegen dargestellt am Beispiel der Unfallverhütung. Dissertation, Wien 1990.
Herlinde PAUER-STUDER, Das Andere der Gerechtigkeit. Berlin 1996.
Peter PELINKA, Österreichs Kanzler. Von Leopold Figl bis Wolfgang Schüssel. Wien 2000.
Martin PESCHKE, Interne Öffentlichkeitsarbeit im Industriebetrieb dargestellt am Beispiel der EU-information der Industriellenvereinigung. Diplomarbeit, Wien 1995.
Frank PFETSCH, Die Europäische Union. Eine Einführung. München 1997.
Martin PICHAL, Die externe Öffentlichkeitsarbeit 1996 des Österreichischen Roten Kreuzes unter besonderer Berücksichtigung des Landesverbandes Wien: Eine trichotomische Betrachtung von sozialen Nonprofit-Public Relations. Diplomarbeit, Wien 1997.
Johanna PIRKFELLNER, Die Öffentlichkeitsarbeit des Museums für Völkerkunde. Diplomarbeit, Wien 1994.
Manuela Maria PISKANDLO, Die Öffentlichkeitsarbeit einer Gemeinde am Beispiel der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. Diplomarbeit, Wien 1992.
Manfred PITTIONI, The Idea of the Crusades in the Conflicts between the European States and the Ottoman Empire. Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.100, S.109-116
Andreas PITTLER: Bruno Kreisky. Reinbek bei Hamburg 1996
PLATON, Nomoi. In: Ders., Sämtliche Werke Bd.4, S.143-574
Gerhard PLEIL, Öffentlichkeitsarbeit - Ein Weg zum Unternehmenserfolg: Möglichkeiten und Grenzen von Public Relations. Stuttgart 1997.
Sigrid PÖLLINGER, Erfahrungen des euro-arabischen Dialogs, Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.92, S.52-60
Sigrid PÖLLINGER, Einleitung zum Internationalen Symposium “Stabilisierung des Balkans: Fünf Jahre nach Dayton”. Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.105, S.3-6
Sigrid PÖLLINGER, Der KSZE / OSZE-Prozeß. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.100, S.89-109
Sigrid PÖLLINGER, Die Ottawa-Konvention und das Engagement der OSZE, Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.102, S.46-51
Sigrid PÖLLINGER, Der KSZE / OSZE-Prozeß. Ein Abschnitt europäischer Friedensgeschichte. Wien 1998.
Sigrid PÖLLINGER, Wladimir Solowjew und der mystisch-metaphysische Versuch einer religiösen Erneuerung in Rußland. Zum 100.Todestag am 31.Juli (13.August) 2000. In: Hans Dieter Klein (Hg.), Wiener Jahrbuch der Philosophie Bd.32, Wien 2000, S.81-97
Karl POPPER, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Tübingen 1992.
Karl POPPER, Auf der Suche nach einer besseren Welt. Vorträge und Aufsätze aus dreißig Jahren. Hamburg (10.Auflage) 1999.
Neil POSTMAN, Das Verschwinden der Kindheit. Frankfurt am Main 1997.
Julia PRINZ, Die Erarbeitung von PR-Strategioen anhand von kommunikationswissenschaftlichen Theorien. Dargestellt am Beispiel der Arbeitsgemeinschaft Verpackungsverwertung (ArgeV). Diplomarbeit, 1995.
Klaus PUCHLEITNER, Public Relations in Krisenzeiten. Das Handbuch für situationsorientierte Öffentlichkeitsarbeit. Wien 1994.
Alexandra RADL, Social marketing im Antirassismusbereich. Eine Analyse der Europäischen Jugendkampagne gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Intoleranz. Diplomarbeit, Wien 1996.
Simone de RAIJ, Die Evaluation interner Public Relations am Beispiel eines Pharmaunternehmens. Diplomarbeit, Wien 1998.
Esther RAINER, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für Non-Profit-Organisationen unter besonderer Berücksichtigung von Fundraising für soziale Dienstleistungen. Diplomarbeit, Wien 1996.
Roberta RASTL, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbewußtsein. Ein Kommunikationskonzept für Umwelterziehung in einer südbrasilianischen Grundschulklasse. Diplomarbeit, Wien 1996.
Gerhard REGENTHAL, Corporate Identity - Luxus oder Notwendigkeit? Wiesbaden 1997.
Volker RITTBERGER, Martin MOGLER, Bernhard ZANGL, Vereinte Nationen und Weltordnung. Zivilisierung der internationalen Politik? Opladen 1997.
Andrea ROGY, Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement am Beispiel der Arbeiterkammer. Diplomarbeit, Wien 1996.
Franz RONNEBERGER, Public Relations der Non-Profit-Organisationen. Theoretische Ansätze, Forschungsergebnisse und praktische Erfahrungen aus einem PR-Seminar. Wiesbaden 1982.
Udo RUMERSKIRCH, Die Öffentlichkeitsarbeit des Österreichischen Bundesheeres. Militär und Gesellschaft im neutralen Kleinstaat. Diplomarbeit, Wien 1985.
Elisabeth SAGMEISTER, Das Image von Nonprofitorganisationen in Österreich am Beispiel der Caritas: Eine Untersuchung des Images bei 20-30jährigen anhand von zwei Gruppendiskussionen. Diplomarbeit, Wien 1998.
Norbert SATTLER, Corporate Identity für Non-Profit-Organisationen. Diplomarbeit, Wien 1993.
Andreas SCHERER, Der Informationsoffizier als Instrument militärischer Öffentlichkeitsarbeit. Anspruch und Wirklichkeit - Möglichkeiten und Grenzen. Diplomarbeit, Wien 1994.
Christoph SCHNEIDER, Ingo DÄMGEN, Knaurs Länderlexikon. Die Staaten der EU. Daten, Fakten, Trends. München 1999.
Martin SCHMUTZ, Die Öffentlichkeitsarbeit der katholischen Privatschulen Österreichs. Diplomarbeit, Wien 1989.
Peter SCHNECKENLEITNER, Politische PR der Grünen Alternative. Diplomarbeit, Wien 1993.
Peter SCHOLL-LATOUR, Das Schwert des Islam. Revolution im Naman Allahs. München 1992.
Nicole SCHOLZ, Öffentlichkeitsarbeit für Krankenhäuser. Diplomarbeit, Wien 1992.
Beate SCHULZ, Strategische Planung von Public Relations. Das Konzept und ein Fallbeispiel. Frankfurt am Main 1991.
Peter SCHWARZ, Mangement in Nonprofit-Organisationen. Eine Führungs-, Organisations- und Planungslehre für Verbände, Sozialwerke, Vereine, Kirchen, Parteien. Bern 1996.
Ignaz SEIDL-HOHENVELDERN, Torsten STEIN, Völkerrecht. Köln u.a. (10.Auflage) 2000.
Dieter SENGHAAS (Hg.), Den Frieden denken. Si vis pacem, para pacem. Frankfurt am Main 1995.
Benno SIGNITZER, Eine Theorie der Public Relations. In: Roland BURKART, Walter HÖMBERG (Hg.), Kommunikationstheorien. Ein Textbuch zur Einführung. S.134-152
Barbara SOMMERSACHER, Das Corporate Identity-Konzept der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Von der “Pferde-Curen- und Operationsschule” zur “Neuen Wiener Schule der Veterinärmedizin”. Diplomarbeit, Wien 1996.
Oswald SPENGLER: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. München (10.Auflage) 1991.
Peter STREINKE, Erfolgreiche PR. Ausgewählte Beispiele aus der Praxis. Frankfurt am Main 1992.
Maureen SULLIVAN, The Four Seasons of Greek Philosophy. Nicosia (2.Auflage) 1992.
Bertha von SUTTNER, Die Waffen nieder! Eine Lebensgeschichte. Berlin 1990.
Konstanze THUMA, Öffentlichkeitsarbeit für Museen. Theorie und Praxis am Beispiel des Technischen Museums Wien. Siplomarbeit, Wien 1991.
Holger TREML (Hg.), Öffentlichkeitsarbeit der Kirche. Stuttgart (3.Auflage) 1995.
Gunther TRÖGER, Macht und Magie der PR. Insider-Informationen, Erfolgsformeln, Spitzenleistungen. Landsberg am Lech 1989.
Michael URSELMANN, Erfolgsfaktoren im Fundraising von Nonproiftorganisationen. Wiesbaden 1998.
VOLTAIRE, Philosophische Briefe. Frankfurt am Main 1992.
Walter WAGLECHNER, Öffentlichkeitsarbeit in der öffentlichen Verwaltung: am Beispiel des Bundesministeriums für Inneres. Diplomarbeit, Wien 1989.
Rudolf WEILER, Der Ausbau des Instituts für Friedensforschung in den Jahren 1972 und 1973, Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.1, S.5-7
Martin WEISS, Leo Gabriel. In: Bio-Bibliographisches Kirchenlexikon. Augsburg 1990.
Petra Susanne WILFINGER, Erfolg durch wirksame Öffentlichkeitsarbeit. Diplomarbeit, Universität Klagenfurt 2000.
Siegfried WILLING, Ulrich MAUBACH, Präsentationserfolg in Werbung und Public Relations. Düsseldorf (2.Auflage) 1993.
Andreas WINKLER, Politische Öffentlichkeitsarbeit. Analyse der wesentlichen Gesichtspunkte der Öffentlichkeitsarbeit staatlicher und politischer Institutionen, untersucht am Beispiel des Landespresseamtes der Autonomen Provinz Bozen. Diplomarbeit, Wien 1995.
Ludwig WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus. Logisch-philosophische Abhandlung. Frankfurt am Main 1963.
Renate ZEDERBAUER-PRASCHAK, Public Relations und politische Parteien. Dargestellt am Beispiel der PR der Sozialistischen Partei Österreichs. Diplomarbeit, Wien 1991.
Ansgar ZERFASS, Was ist exzellente PR? Ergebnisse des weltweit größten Forschungsprogramm. In: Public Relations Forum 2.Jg., Nr.3, S.18-20
Ulrike Maria ZÖCHBAUER, Öffentlichkeitsarbeit und deren Anwendung auf den nicht erwerbswirtschaftlichen Bereich. Dargestellt am Beispiel der Handelskammer Oberösterreich. Diplomarbeit, Wien 1990.
Valentin ZSIFKOVITS, Jahresbericht des Universitätszentrums für Friedensforschung, Wiener Blätter zur Friedensforschung Nr.1, S.8-9
Fussnoten beim Autor (können HTML-bedingt hier nicht angezeigt werden)