

![]()

Proseminararbeit Zeitgeschichte, abgegeben am 15.1.1997
Lehrveranstaltungsleiter: Dr.Spann
Wintersemester 96/97
Universität Wien
1. Einleitung
Die Sozial- oder Wirtschaftspartnerschaft kann als allgemein als Konflikt- und Problemlösungsmechanismus zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern bezeichnet werden. Sie ist ein System der wirtschafts- und sozialpolitischen Zusammenarbeit zwischen den Interessensvertretungen beider Gruppen. In der wissenschaftlichen Literatur wird ihr ideologischer Gegensatz zur marxistischen Theorie des Klassenkampfes ausdrücklich betont; die zumindest theoretische Aufgabe der Sozialpartnerschaft liegt in der Regelung gesellschaftlicher und ökonomischer Probleme durch Verhandlungen, die durch die dauerhafte Zusammenarbeit der großen Interessensverbände garantiert werden sollen. Die Sozialpartnerschaft besitzt aus noch zu erläuternden historischen Gründen keine verfassungsrechtliche Verankerung, sondern wird informell von Arbeiterkammer, Österreichischem Gewerkschaftsbund, der Landwirtschaftskammer und Bundeswirtschaftskammer getragen. (vgl. SPIEGEL, 1987; FUNK 1982). Die historische Entwicklung ihrer institutionellen und ideologischen Voraussetzungen vom 19.Jahrhundert über die 1.Republik bis hin zur Gegenwart sollen ebenso ausführlich thematisiert werden wie gegenwärtige Bedeutung und mögliche Zukunft der Einrichtung.
2. Entwicklung der ideologischen und institutionellen Voraussetzungen
Sozialpartnerschaftliche Problemlösung setzt zweierlei voraus: Erstens, daß sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer über Interessenvertretungen verfügen und zweitens, daß diese bereit sind, miteinander zu kooperieren. Beides ist vom historischen Standpunkt aus betrachtete keine Selbstverständlichkeit.
2.1. Rudimentäre Anfänge im 19.Jahrhundert
Die ersten Forderungen nach Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern waren im bewußten Gegensatz zur marxistischen These des unversöhnlichen Klassenkampfes formuliert und betonten die Gemeinsamkeit der Interessen, beispielsweise die katholische Soziallehre von Karl Freiherr von Vogelsang, die im 19.Jahrhundert entstand (MAYR 1991). Daß solche und ähnliche Ansätze damals weitgehend ungehört verklangen und noch bis zu Beginn der Zweiten Republik das trennende Element vor dem gemeinsamen betrachtet wurde, darf aber nicht übersehen werden.
Was die institutionellen Ansätze jener Zeit betrifft, fällt auf, daß sich zunächst die Arbeitgeber zu Interessenvertretungen durchrangen. Bereits im Jahre 1848 wurde erstmals die Handelskammer gegründet, die die Vorläuferorganisation der Bundeswirtschaftskammer werden sollte. Die Handelskammer war schon damals als Einheitskammer angelegt und zur Vertretung der gesamten gewerblichen Wirtschaft befähigt (MAYR 1991). Die ersten Ansätze zur Landwirtschaftsvertretungen finden sich auch schon im 19.Jahrhundert; so gründete Joseph II. 1808 eine Landwirtschaftsgesellschaft in Wien, doch erst viele Jahrzehnte später (1922) sollte die Landwirtschaftskammer entstehen. Die soziale Bewegung förderte aber auch die Bildung von Gewerkschaften, die ab 1870 erfolgte, nachdem die bis dahin hinderlichen Gesetze aufgehoben wurden (Abschaffung des Koalitionsverbotes am 7.April 1870). Die Schwäche solcher Gewerkschaften läßt sich ermessen, wenn man bedenkt, daß es 1872 in Österreich 75 davon gab (NICK, PELINKA 1982). Insgesamt sind die Ansätze der institutionellen Entwicklung von Interessensverbänden im 19.Jahrhundert zwar vorhanden, aber als sehr rudimentär zu bezeichnen.
2.2. Die Situation in der 1.Republik
Viel entscheidender ist für dieses Thema die Entwicklung in der 1.Republik. Die Arbeiterkammer sollte erst 1921 als Gegenstück der Handelskammer entstehen. Das verzögerte Entstehen einheitlicher Arbeitnehmervertretungen erklären manche Autoren mit großen Defiziten an Bildung in der Arbeiterschaft (SPIEGEL 1987). Viele Autoren vertreten die Ansicht, daß in dem Gesetz, mit dem die Arbeiterkammer geschaffen wurde, schon sozialpartnerschaftliche Ansatzpunkte enthalten waren. So sollte die Arbeiterkammer mit anderen zur Vertretung wirtschaftlicher Interessen berufenen Körperschaften zur Bearbeitung gemeinsamer Angelegenheiten Ausschüsse schaffen (MAYR 1991) Auf die Bedeutung solcher und ähnlicher Körperschaften wird weiter unter eingegangen.
Daß trotz solcher Aspekte, deren besondere Betonung eher eine Verschleierung der wirklichen Umstände darstellt, allein die politische Situation der 1.Republik die Zusammenarbeit beider Seiten massiv erschwerte, steht aber fest. Zur allgemeinen Situation der Verbände in der 1.Republik ist festzustellen, daß die Bedeutung der Parteien deutlich über der der Verbände lag; sowohl auf Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite waren die Interessensvertretungen der Gliederung des politischen Systems in Lager im wesentlichen untergeordnet. Partei und Verband wurden generell als Einheit angesehen. Die Verbände übernahmen den parteipolitischen Kampf. Besonders bezeichnend für die Situation der 1.Republik war das Vorhandensein von Richtungsgewerkschaften; jede bedeutende Partei verfügte über eine eigene Arbeitervertretung.
Die mit Abstand stärkste Richtungsgewerkschaft war der Bund der Freien Gewerkschaften, eine Dachorganisation von anfangs 65 (Stand 1919), später 45 sogenannten Freien Gewerkschaften (Stand 1930), die sehr eng mit der Sozialdemokratischen Partei verknüpft waren. Als zweitstärkste Richtungsgewerkschaft folgte die Zentralkommission der Christlichen Gewerkschaften, die eng mit der Christlichsozialen Partei kooperierte. Weitere richtungsgewerkschaftliche Gruppierungen waren die Deutschnationalen Gewerkschaften, die mit der Großdeutschen Volkspartei zusammenhingen und die mit dem Heimatschutz verbundenen sogenannten Unabhängigen Gewerkschaften (genaue Zahlen siehe Tabelle 1). An eine Einheitsgewerkschaft war also nicht zu denken; die zunehmende Entfremdung der Parteien voneinander führte daher notwendigerweise zu zunehmenden Konflikten der Gewerkschaftsbewegungen. Die folgende Tabelle soll auf den mit der Zeit zunehmenden Kampf der Richtungsgewerkschaften untereinander hinweisen.
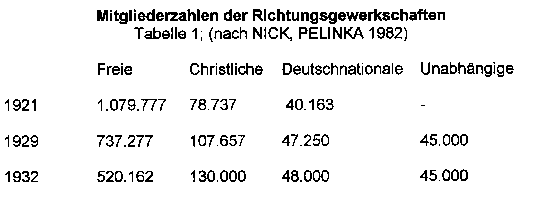
Aus den angeführten Gründen war das Stärkeverhältnis zwischen den Richtungsgewerkschaften auch direkt abhängig von der Stärke der jeweiligen Partei. Wie die hier angeführten Zahlen ebenfalls demonstrieren, sank der Vorsprung der Freien Gewerkschaften drastisch im Verlauf eines Jahrzehnts. Von 1921 bis 1932 sank die Zahl der Mitglieder der Freien Gewerkschaften um etwa die Hälfte, während sich die Zahl Mitglieder der Christlichen Gewerkschaft verdoppelte. Dies weist auf den drastischen Machtverlust der Sozialdemokratie in diesen Jahren hin. Eine solche drastische Konkurrenzsituation allein schon zwischen Arbeitnehmervertretern deutet schon auf die damaligen faktischen Schwierigkeiten einer sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit hin. Die Freien Gewerkschaften dominierten in der 1.Republik auch die vorhin angesprochene Arbeiterkammer - damit herrschte dort indirekt auch die Sozialdemokratie.
Hier liegen keine Zahlen nach 1926 vor, weil nur zweimal gewählt wurde. Trotzdem kann man auch hier schon den rückläufigen Trend der Stimmen für die Freien Gewerkschaften feststellen; dieser kam vor allem den Deutschnationalen zugute. Aus dem bisher Gesagten soll vor allem die Stärke der Sozialdemokratie unter den Arbeitnehmervertretungen verdeutlicht werden, die entsprechend dem Machtverlust der Sozialdemokratie im Laufe der 1.Republik stark zurückging; gleichzeitig soll nochmals die Spaltung der Arbeitnehmervertretungen betont werden. In der 1.Republik waren die Gewerkschaften vor allem Arbeitergewerkschaften.
Die Wirtschaftsverbände waren in der 1.Republik nur wenig zentralisiert; das Kammerngesetz von 1920 errichtete für die Länderkammern vier Sektionen (für Handel, Industrie, Gewerbe und eine gemeinsame für Verkehr und Finanzen). Auf der Bundesebene konnten nur die Präsidialkonferenz und die sogenannte Kammeramtsdirektorenkonferenz agieren, die aber über keinen eigenen organisatorischen Apparat verfügten. Auch auf der Arbeitgeberseite ist also Dezentralisierung zu beobachten, die die sozialpartnerschaftliche Arbeit notwendigerweise erschwerte.
Trotz der Schwierigkeiten gab es aber schon in der 1.Republik faktische Ansätze zur sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit. Noch vor der Ausrufung der 1.Republik, am 4.Oktober 1918, trat eine paritätische Industriekommission zusammen, an der auch Vertreter der Freien Gewerkschaften gleichberechtigt mitwirkten. Ihre Aufgabe bestand in der Vermittlung von Arbeitsplätzen an die vom 1.Weltkrieg heimkehrenden Soldaten. In den folgenden Wochen und Monaten entstanden ähnlich strukturierte paritätische Organisationen, an denen Arbeitgeber und Gewerkschaftsvertreter teilnahmen: z.B. die Kommission für Sachdemobilisierung und Liquidierung der Kriegswirtschaft, die landwirtschaftlichen Betriebsarbeitsräte, die Staatskommission für Sozialisierung und die Schiedskommission etc. Im November 1919 berief Karl Renner, damals Staatskanzler, die sogenannte Industriekonferenz ein, die aber nur kurzfristig tätig sein sollte.
Die Industriekonferenz war paritätisch organisiert. Es wurden Unterausschüsse geschaffen, wobei der Unterausschuß für Lohn- und Preisfragen der wichtigste war. Seine Aufgabe bestand in der Festsetzung von Indexlöhnen. Dieser vielversprechende Anfang endete weitgehend nach dem Auseinanderbrechen der Großen Koalition, die nur von 1919 bis 1920 bestand und 83 % der Abgeordneten auf sich vereinte. Der Wechsel zur "Bürgerblock"-Regierung 1920 gleich zu Beginn der 1.Republik beendete faktisch die Kooperation.
Die sozialpartnerschaftlichen Ansätze der 1.Republik scheiterten also, weil das Regierungsbündnis zwischen den Großparteien früh zerbrach und die Sozialisierung aufgrund der immer stärker werdenden ideologischen Gegensätze nicht verwirklicht werden konnte.
Wichtig erscheint aber vor allem die Feststellung, daß das weitgehende Fehlen beziehungsweise Nichtfunktionieren einer Sozialpartnerschaft im engen Zusammenhang mit der ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklung der 1.Republik zu sehen ist. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen lag im Jahre 1919 bei 355.000, was einer Arbeitslosenrate von 18,4% entsprach. Die Zahl sank 1925 auf 220.000 (9,9%). 1930 gab es wieder 243.000 Arbeitslose (11,2%). Ab diesem Zeitpunkt stieg die Arbeitslosenzahl explosionsartig an. 1933 betrug die Zahl der Arbeitslosen 557.000, was einer Arbeitslosenrate von 26 % entsprach. (NICK, PELINKA 1983)
Eine solche widrige Situation belastete nicht nur das Gesprächsklima, sondern beschränkte auch den Handlungsspielraum jeder sozialpartnerschaftlichen Institution. Was sie leisteten, wurde durch die wirtschaftliche Realität zunichte gemacht, ihre vergeblichen Bemühungen lösten Vertrauenskrisen aus. Es scheint, daß in einer Zeit der Knappheit der Ressourcen verschiedene Faktoren die Sozialpartnerschaft behindern und sogar funktionsunfähig machen können. Diese Feststellungen werden in die noch folgende Diskussion der gegenwärtigen Situation der Sozialpartnerschaft einfließen.
2.3. Situation im Ständestaat
Der Ständestaat, der auf die 1.Republik folgte, führte nicht wirklich zu einem Ausgleich von Arbeitgeber und -nehmerinteressen, obwohl er dies ideologisch für sich in Anspruch nahm. Vielmehr basierte er nicht auf dem Ausgleich zwischen zwei Lagern, sondern war eine Diktatur des einen über das andere Lager. Es wurde zwar versucht, z.B. eine einheitliche Gewerkschaftsbewegung zu errichten, diese wurde aber von der Regierung kontrolliert und von der sozialdemokratischen Mehrheit innerhalb der Arbeiterschaft nicht akzeptiert. 1937 sah ein Gesetzesvorschlag erstmals die Errichtung einer Bundeswirtschaftskammer vor; dies wurde zu Beginn der 2.Republik realisiert. Der Ständestaat war aufgrund seiner diktatorischen Struktur nicht in der Lage, eine auf Konsens und gegenseitige Verständigung basierende Sozialpartnerschaft zu errichten (NICK, PELINKA 1983). Die auf den Ständestaat folgende NS-Diktatur soll hier weitgehend übergangen werden. Die Nationalsozialisten beanspruchten universale Geltung über Klassengrenzen hinweg. Die von ihnen geschaffenen unnatürlichen Wirtschaftsverhältnisse, die auf massive Aufrüstung zum Krieg unter gigantischer Verschuldung beruhten, verminderten durch die Schaffung von Arbeitsplätzen zwar die Interessensgegensätze, diese in einen schrecklichen Weltkrieg mündende Vorgangsweise kann aber wohl kaum als Prototyp einer empfehlenswerten sozialpartnerschaftlichen Wirtschaftspolitik betrachtet werden.
3. Entstehung der Struktur der 'eigentlichen' Sozialpartnerschaft in der 2.Republik
Erst in der 2.Republik sollte die 'eigentliche' Sozialpartnerschaft entstehen und zum Höhepunkt ihrer Blüte und politischen Macht kommen. Viele verschiedene Faktoren führten zur zunehmenden Dialogfähigkeit der Parteien. Vor allem der Wunsch nach Freiheit von den Besatzungstruppen und die dafür nötige Voraussetzung einer funktionsfähigen Politik und Wirtschaft wird oftmals in der wissenschaftlichen Literatur betont (SPIEGEL 1987). Die 2.Republik lieferte - bisher - die nötigen Voraussetzungen einer funktionsfähigen Sozialpartnerschaft, weil sie, sieht man von den ersten Nachkriegsjahren ab, relativ stabile wirtschaftliche und politische Verhältnisse aufwies. Dies verdeutlichen etwa die Arbeitslosenzahlen, die 1955 bei 117.890 lag, was einer relativen Quote von 5,4 % entspricht. Bis 1965 sanken die Zahlen auf 65.514 Arbeitslose (2,7 %). Bei der äußerst niedrigen Quote von 2,7 % blieb die Arbeitslosenzahl auch 1975. Die Arbeitslosenrate 1980 betrug gar nur 1,9 %! Ein Vergleich der Streiktage in Österreich weist auf einen ähnlichen Trend hin: Weit heftigeren Turbulenzen in der 1.Republik stehen weit weniger Streiks in der 2.Republik gegenüber (NICK, PELINKA 1983). Dazu kommt noch die breite Basis, auf die sich die Regierung die ganze 2.Republik hindurch stützen konnte; dies alles wird jedoch in der Gegenwart zunehmend in Frage gestellt.
Die Funktion der Handelskammern auf Länderebene übernahm die Bundeswirtschaftkammer, die auch über institutionelle Einrichtungen auf Bundesebene agiert; sie wurde 1946 gegründet. Überhaupt kann man eine Tendenz zur Zentralisierung der Interessensverbände beobachten: Ein de-facto einheitlicher Gewerkschaftsbund, der ÖGB, wurde 1945 gegründet. Die anderen Organisationen, Landwirtschaftskammer und Arbeiterkammer, wurden weitgehend in ihrer bestehenden Struktur beibehalten.
3.1. Kurze, allgemeine Darstellung des Systems der Interessensverbände
Ziel dieses Artikels kann es nicht sein, eine vollständige Einzeldarstellung der jeweiligen Verbände zu liefern. Eine allgemein gehaltene Analyse der Organisationsstruktur erscheint aber unabdingbar. Dabei geht es vor allem um die Herausarbeitung von für die Sozialpartnerschaft entscheidenden Grundfunktionen der Systeme. Details werden bewußt vernachlässigt.
Alle drei Kammerorganisationen sind hierarchisch und gleichzeitig föderalistisch strukturiert, wobei das hierarchische Element überwiegt. Alle drei Organisationen besitzen je eine Dachorganisation in Wien, sowie Landes- und Bezirksstellen. Neben der regionalen Gliederung sind die Kammern auch fachlich gegliedert. Diese fachliche Gliederung ist bei den Landwirtschaftskammern nicht so stark ausgeprägt wie in den anderen beiden Kammern. Der ÖGB weist eine den Kammern ähnliche Struktur auf. Er ist ein Dachverband mit faktischem Monopolcharakter und hoher Zentralisation. Im Gewerkschaftsbund bestehen neben den Landesexekutiven, Bezirks- und Ortsgruppen auch Betriebsgruppen; es sind also auch föderalistische Elemente vorhanden. Eine fachliche berufliche Gliederung erfolgt im ÖGB in der Form von 15 Einzelgewerkschaften. In seinen Satzungen ist keine parteipolitische Gliederung vorgesehen, die aber de facto existiert. In den anderen Verbänden ist eine parteipolitische Gliederung nicht vorhanden, bei den Wahlen treten aber Parteien als wahlwerbende Gruppen auf. Fraglos werden Arbeiterkammer und ÖGB von der SPÖ, Landwirtschaftskammer und Bundeswirtschaftskammer von der ÖVP dominiert. Das österreichische Spezifikum der ungewöhnlich hohen Vernetzung der Verbände mit bestimmten Parteien sei betont; sie ist für das Funktionieren der Sozialpartnerschaft unerläßlich. Ohne auf die Struktur der Verbände noch näher einzugehen, sei festgestellt, daß ihre demokratische Durchdringung zu wünschen übrig läßt. Konkret ist damit gemeint, daß die Wahl der Spitzenfunktionäre indirekt, das heißt durch Gremien erfolgt. Niemals kann die Mehrheit der Verbandsmitglieder ihren Wunschkandidaten wählen. Die Dachverbände agieren dominant. Die Aufgabe aller Verbände liegt, wie schon mehrfach festgestellt, in der Interessensvertretung ihrer Mitglieder. Ob diese durch die autoritäre Organisation vollständig gewährleistet werden kann, bleibt dahingestellt. Haupttätigkeit der Verbände besteht im sogenannten "Lobbying". Dieses Wort bezeichnet das Agieren im vorparlamentarischen Raum. Die Interessensverbände treffen Vorentscheidungen zu Gesetzen, die in der Folge im Nationalrat formal beschlossen werden. Die Interessensverbände besitzen ein gesetzlich festgeschriebenes Begutachtungsrecht der Gesetzesvorschläge der Ministerien. Die Gesetzesvorschläge von Regierungsseite werden traditionell nur mit Einverständnis der Sozialpartner im Parlament eingebracht (SPIEGEL 1987).
3.2. Endgültige Ausformung der Zusammenarbeit der Verbände ab 1945
Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes wurde von der alliierten Besatzung ein Lohn-Preis-Stop verhängt. Dieser wurde allerdings bald unhaltbar, denn er griff nur einseitig: Die Löhne blieben eingefroren, die Preise stiegen trotzdem. Im März 1946 wurde eine mit Kompetenzen des Rechtstreuhänders ausgestattete zentrale Lohnkommission eingerichtet, die eine Angleichung der Löhne an die Preise intendierte. Die Lohnanträge mußten anfangs noch bei der alliierten Lohnkommission zur Billigung eingereicht werden. Zwischen 1945 und 1946 übten die Alliierten die Lohnkontrolle und die örtlichen Behörden die Preiskontrolle aus. Erst danach übernahm eine Kommission des Sozialministeriums diese Kompetenzen.
Der unmittelbare Anlaß für die Zusammenarbeit der Interessensvertretungen nach dem 2.Weltkrieg war der starke Lohn-Preisauftrieb. Zwischen April und Juni 1947 stiegen z.B. die Lebensmittelpreise um 83%, was einem Anstieg des Index der Lebenserhaltungskosten um 50 % entsprach. Die Verdienste stiegen nur um 20 %, sodaß es zu einem starken Absinken der Reallöhne kam. Streiks waren die Folge.
Im Juni 1947 beschlossen besagte vier Verbände die Einrichtung einer ständigen, gemeinsamen Wirtschaftskommission, deren Aufgabe darin bestehen sollte, die wirtschaftliche Entwicklung zu beobachten und gemeinsame Vorschläge an die Regierung auszuarbeiten. Im Rahmen dieser Wirtschaftskommission wurden bis zum Jahre 1951 fünf Lohn-Preisabkommen beschlossen. Der Hauptzweck jedes dieser Abkommen war es, die mit zunehmender Schnelligkeit auftretende Kluft zwischen Produktionskosten und Preisen einerseits und Löhnen und Lebenserhaltungskosten andererseits zu mindern. Die Inflation sollte gesteuert und somit niedrig gehalten werden. Die Abkommen der Kommission wurden im Parlament als Gesetze verabschiedet, wodurch die Vorform der Paritätischen Kommission massiv aufgewertet wurde (MAYR 1991, LANG 1978).
Im April 1951 wurde die Wirtschaftkommission vom Wirtschaftsdirektorium ersetzt. Seinen Vorsitz übernahm der Bundeskanzler, neben den vier Interessensvertretungen gehörten ihm auch der Vizekanzler, der Verkehrsminister und der Außenminister an. Schon ein Jahr später, 1952, wurde diese Institution als verfassungswidrig erklärt und vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Bis 1957 sollte nun die Sozialpartnerschaft fehlen, was notwendigerweise zu einer aggressiveren Wirtschaftspolitik seitens der Arbeitgeber führte. In diesen Jahren kam es zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen.
1957 schloß der damalige Bundeskanzler Julius Raab, der vor seinem Amtsantritt der erste Präsident der Bundeswirtschaftskammer war und es nachher wieder wurde, eine informelle Vereinbarung mit Johann Böhm, dem Präsidenten des ÖGB, der gleichzeitig auch die Funktion des 2.Präsidenten des Nationalrates innehatte. Nach dieser Vereinbarung sollte die Paritätische Kommission für Preis- und Lohnfragen eingerichtet werden, der erneut die Vertreter der vier großen Interessensverbände angehören sollten. Die Paritätische Kommission, die von Anfang an einen Unterausschuß für Preisfragen besaß, ist das Kernstück der österreichischen Sozialpartnerschaft. Im sogenannten Raab-Olah-Abkommen 1962 wurde ein zweiter Unterausschuß für Lohnfragen, 1963 schließlich ein Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen errichtet. 1968 wurden die sogenannten Quartalaussprachen eingeführt, in denen außer den ständigen Mitgliedern der Paritätischen Kommission der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts, der Präsident der Nationalbank und der Finanzminister teilnahmen (mittlerweile gibt es pro Jahr nur mehr drei Treffen). Seit dieser Zeit existieren auch die sogenannten Präsidentenbesprechungen, die vor jeder Sitzung der Paritätischen Kommission stattfinden; dort werden allgemeine Richtlinien festgelegt. 1972 wurde das Sallinger-Benya-Abkommen beschlossen, das bis Mai 1973 in Kraft blieb. Es war die letzte von insgesamt fünf Stabilisierungsaktion der Löhne und Preise (sogenannte Lohn-Preis-Pausen). Ihnen kann ein gewisser Erfolg nicht abgesprochen werden (LANG 1978). Die Paritätische Kommission, die im folgenden Punkt noch näher erläutert werden soll, ist das mit Abstand wichtigste Organ der Sozialpartnerschaft. Neben ihr existieren aber noch mehr Formen der Sozialpartnerschaft, so werden z.B. die höchsten Posten der Sozialversicherung durch die Interessensverbände besetzt. Außerdem waren die Sozialpartner bisher in einer Unzahl von Kommissionen vertreten, die auch über von der Lohn- und Preispolitik weit entfernten Fragen entschieden (als wahres Kuriosum sei die mittlerweile abgeschaffte Gewissenskommission beim Zivildienst angeführt).
3.3. Mitglieder, Grundsätze, Funktion, Bewertung der Paritätischen Kommission
Mitglieder der Paritätischen Kommission sind der Bundeskanzler, der Innenminister, ursprünglich der Handels- und Wiederaufbauminister (heute: Wirtschaftsminister), der Sozialminister und je zwei Vertreter der vier Interessensverbände. Sie beschäftigt sich mit Angelegenheiten, die ihr von den Unterschüssen vorgelegt werden oder die in den Unterausschüssen nicht entschieden werden können. Die Kommission tritt regelmäßig zusammen. Sie basiert im wesentlichen auf folgenden Grundsätzen (teilweise nach MAYR 1991):
1.) Prinzip der Freiwilligkeit der Zusammenarbeit
Eine gesetzliche Verankerung der Zusammenarbeit ist nicht vorhanden. Das Fehlen von diesbezüglichen Zwang begünstigt den guten Willen der Zusammenarbeit. Es steht jedem Partner frei, die Zusammenarbeit zu beenden.
2.) Prinzip der Einstimmigkeit der Beschlüsse
Ein Überstimmen eines der vier Partner ist nicht möglich, jeder besitzt quasi ein Vetorecht. Dies soll verhindern, daß lebenswichtige Interessen einer Gruppe auf der Strecke bleiben.
3.) Prinzip der Nichtöffentlichkeit der Beratung
Dieser Grundsatz wurde zurecht oft kritisiert, denn er verhindert die Transparenz der Paritätischen Kommission und ist daher demokratisch bedenklich; umgekehrt besteht nur so die Bereitschaft, offen zu diskutieren. Würden die Konflikte z.B. in den Medien ausgetragen werden (was zunehmend geschieht), hätte dies wahrscheinlich die Folge einer Einzementierung der Standpunkte (was auch zunehmend geschieht).
Weiters ist zu berücksichtigen: Die Paritätische Kommission kann zwar nur Empfehlungen aussprechen, doch stehen ihr durch die Machtfülle der einzelnen Mitglieder und der Parteien-Disziplin zahlreiche wirksame Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Die in der Paritätischen Kommission vertretene Regierung hält die exekutive und aufgrund der Struktur unseres Parteienstaats auch die legislative Gewalt in Händen. Die Präsidenten der Verbände nehmen neben ihrer Funktion im Interessensverband auch noch hohe Parteifunktionen und politische Ämter wahr. So ist z.B. der Präsident der Bundeswirtschaftskammer gleichzeitig Obmann des Wirtschaftsbundes der ÖVP, der Präsident des ÖGB war immer Mitglied im Nationalrat mit Ausnahme Anton Benyas: Er war Präsident des Nationalrates.
Man erkennt also die de-facto-Machtfülle der Paritätischen Kommission, wohlgemerkt: einer einigen Paritätischen Kommission. Diese Machtkonzentration ist aufgrund der mangelnden demokratischen Legitimierung bedenklich. Daß der Verfassungsgerichtshof als demokratische Kontrollinstanz umgangen wurde, indem man die paritätische Kommission einfach gesetzlich nicht definierte, ist meines Erachten ein purer Machtmißbrauch; wenn Verfassungswirklichkeit und Verfassungsrecht zunehmend auseinanderklaffen, kann dies nämlich eine ernsthafte Gefährdung der Demokratie darstellen. Die Paritätische Kommission trug in der Vergangenheit aber tatsächlich viel zum sozialen Frieden bei. Ob sie dies heute noch vermag, soll im nächsten und letzten Punkt diskutiert werden. Doch zweifellos wurde das Bild der 2.Republik von sozialpartnerschaftlichen Maßnahmen positiv geprägt. Die geringe Anzahl von Streiks - im Jahre 1988 gab es nur 87 Streiksekunden pro Arbeitnehmer, was lächerlich gering ist - ist sicher auf das Wirken der Sozialpartnerschaft und hier vor allem auf das der Paritätischen Kommission zurückzuführen (LANG 1978).
4. Aktuelle Diskussion um die Sozialpartnerschaft
Bei der obigen Diskussion der Gründe, warum die sozialpartnerschaftlichen Ansätze in der 1.Republik nicht funktioniert hatten, wurden vor allem zwei Faktoren festgestellt: Die fehlende breite Basis der Regierung nach 1920 und die katastrophale Wirtschaftslage. Die gegenwärtige Vertrauenskrise der Sozialpartnerschaft tritt nun in einer Zeit auf, in der die einstmals breite Zustimmung der Bevölkerung zu beiden Regierungsparteien zunehmend im Schwinden begriffen ist und zudem die Wirtschaft das erwünschte Wachstum missen läßt. So sank die Stimmenzahl der der Sozialpartnerschaft nahestehenden Parteien SPÖ und ÖVP von einstmals mehr als 90 % (1970) auf nur mehr 63 % (1994) - bei diesen Wahlen ging sogar die Zweidrittelmehrheit der Regierungsparteien verloren, die aber durch Neuwahlen wiedergewonnen wurde; doch trotz dieses Umstandes hält der negative Trend an, wie man auch aus den schlechten Ergebnissen der jüngsten Wahl zum EU-Parlament entnehmen kann, die man in den Medien zurecht einhellig als "Protestwahl" bezeichnet hat. Die ungünstige Wirtschaftslage, die sich in hohen Arbeitslosenzahlen äußert und zudem die Regierung im letzten Jahr zu massiven Einsparungen bewogen hat, die die Schlagzeilen und Berichterstattung der Zeitungen von 1996 und Anfang 1997 prägten, ist ebenfalls vorhanden. Daß die Kritik an der Sozialpartnerschaft gerade unter diesen Rahmenbedingungen zunimmt, kann wohl unter Berücksichtigung der in dieser Arbeit besprochenen historischen Fakten nicht als Zufall angesehen werden.
Kritik an der Sozialpartnerschaft zieht sich durch die Berichterstattung fast aller österreichischer Tageszeitungen des Jahres 1996 und Anfang 1997. Ausgewählte Beispiele, die ein Bild der gegenwärtigen Lage repräsentativ vermitteln, sollen hier nicht fehlen.
Ende 1995 und Anfang 1996 herrschten noch weitgehend positive Berichte vor, die einerseits durch die Ergebnisse der Urabstimmung der Pflichtmitgliedschaft der Kammern, andererseits durch eine umfassende Untersuchung eines renommierten Meinungsforschungsinstitutes (Fessel+GfK) bedingt sind. So liest man in der "Kärntner Tageszeitung" in einem Artikel vom 14.12.1995 als äußerst positive Schlagzeile: "Sozialpartnerschaft statt Straßenkampf". Der oben erwähnte Beitrag der Sozialpartnerschaft zum sozialen Frieden wird thematisiert. Der "Kurier" würdigt etwa in einem Kommentar vom 2.2.1996 die Beibehaltung der Pflichtmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer, der 81,7 % der Österreicher zustimmten. Das "Wirtschaftsblatt" veröffentlicht unter dem Titel "Klares Votum für Sozialpartner" am 19.1.1996 die Ergebnisse besagter Umfrage vom Fessel-Institut, in der sich 80 % der Österreicher für Beibehaltung oder sogar Ausbau des Einflusses der Sozialpartner aussprachen. Ähnliche Berichte lassen sich in vielen Zeitungen finden.
Nahe der Mitte des Jahres 1996 allerdings, im selben Maße wie das Sparpaket der Regierung zunehmend thematisiert und der Einbruch in der Wirtschaft immer spürbarer wurde, änderte sich das allgemeine Klima zunehmend und die kritischen Kommentare nehmen überhand.
Ein Beispiel: In einem Kommentar zum Thema Sozialpartnerschaft in der Tageszeitung
"Der Standard", am 24.4.1996 gedruckt, wird konstatiert: "Die Frage nach
der Existenzberechtigung jener, die früher in allen Dingen bis zur Gewissenserforschung
potentieller Wehrdienstverweigerer mitredeten, hat aber tiefere Ursachen (Anmerkung: als
der übliche Anlaß der medialen Kritik, nämlich die äußerst hohen Bezüge der
Funktionäre; P.H.): Die Rahmenbedingungen, in denen die Sozialpartner agierten, haben
sich wesentlich verändert. Sowohl die demokratiepolitischen wie die
volkswirtschaftlichen. Zwar haben die beiden ehemaligen Großparteien nach der vergangenen
Nationalratswahl gemeinsam wieder eine Zweidrittelmehrheit. Aber die Parteienlandschaft,
auch die politische Heimat der Sozialpartner, ist anders geworden (...)
Die Sozialpartner werden auf Kernbereiche der Wirtschafts- und Sozialpolitik
zurückgedrängt. Noch gravierender sind die Veränderungen der volkswirtschaftlichen
Grundlagen. Der autonome Spielraum nationaler Wirtschaftspolitik geht durch die zunehmende
Globalisierung mehr und mehr verloren. Die Regulierung der nationalen Nachfrage über die
Paritätische Kommission, das Steuerungsinstrument der Sozialpartner in der Vergangenheit
wirkt nicht mehr." Trotzdem räumt das intellektuelle Kommentar der
Sozialpartnerschaft Zukunftschancen ein. In anderer Zeitungen wurde zu dieser Zeit
ebenfalls leichte und wohlfundierte Kritik geübt.
Das negative mediale Trommelfeuer begann bei zusehends schlechterem Wirtschaftsklima. "Egoismus statt Partnerschaft" titelte der "Kurier" in fetten Lettern auf der ersten Seite am 27.9.1996. Untertitel: "Arbeiterkammer-Präsidentin Hostasch sorgt sich um die Sozialpartnerschaft, weil deren 'Grundkonsens' bröckelt". Auf den folgenden Seiten wird die Linie der Schlagzeile im wesentlichen fortgesetzt. Die Ankündigung eines ähnlichen Artikels auf der Titelseite am selben Tag lautet: "Sozialpartner in der Krise".
15.10.1996. Im Neuen Volksblatt ist folgender kurzer Artikel zu lesen: "Entschieden zurückgewiesen hat gestern Wirtschaftskammer-Präsident Leopold Maderthaner die Kritik von Bundeskanzler Franz Vranitzky an der mangelnden Problemlösungskapazität der Sozialpartnerschaft. Laut Maderthaner träfe dieser Vorwurf den ÖGB." Angesichts des sich verschlechternden Klimas, so denkt der aufmerksame Zeitungsleser, wird es bald wieder zu einem scharfen Konflikt zwischen den sogenannten Sozialpartnern kommen.
Dieser folgte tatsächlich kurz darauf. Die "Kärntner Zeitung", die am Anfang des Jahres allgemein sehr Positives von den Sozialpartnern zu vermelden hatte, schreibt nun in fetten Lettern am 17.10.1996 in der Rubrik Soziales: "Sozialpartner: Jetzt fliegen die Fetzen". Untertitel: "Die 'Kultur der Sozialpartner' scheint gestört. Die Sticheleien zwischen Gewerkschaft und Wirtschaftskammer flauten auch gestern nicht ab". Thematisiert wird im folgenden Artikel wie zu erwarten das schlechter werdende Gesprächsklima zwischen den einzelnen Sozialpartnern. Am 25.11.1996 kündigt der "Standard" eine Artikelreihe an zum Thema: "Götterdämmerung der Sozialpartnerschaft". Am 19.12.1996 wird im Kurier ein Leserbrief unter der Überschrift "Gegen Sozialpartnerschaft" veröffentlicht. Seine Conclusio, die nichts anderes ist als das emotionalisierte Nachsprechen der Berichterstattung der Medien zu jener Zeit: "Minister Bartenstein, offenbar ein junger, dynamischer Mann mit Hirn, meinte, man sollte den Sozialpartnern nicht mehr zuhören als nötig. Ich würde noch weiter gehen: man sollte sie vergessen." Zu etwa derselben Zeit tauchen schon die ersten parteipolitischen Kampagnen gegen die Sozialpartner auf, so erscheint z.B. im "Standard" am 10.12.1996 folgendes Inserat: "Sozialpartnerschaft 'alt' ist eine Gefahr für unsere Wirtschaft". Untertitel: "Wir fordern: Moderne Interessensvertretung statt antidemokratischer Schattenregierung". Das "wir" steht für den "Ring freiheitlicher Wirtschaftstreibender". Solche Tendenzen haben sich in den ersten Jännerwochen des neuen Jahres fortgesetzt.
Eine systematische Analyse der Artikel von Ende 1995 bis Anfang 1997, hier mit einigen repräsentativen Beispielen illustriert, zeigt den Wandel von der weitgehend positiv gefärbten Berichterstattung über zunehmende Kritik Mitte 1996 bis hin zum negativen Trommelfeuer Ende 1996 und Anfang 1997. Die Hintergründe sind klar: Vor allem die immer schlechter werdende Wirtschaftslage belastete zusehends die Gespräche der Sozialpartner untereinander; denn viel zu verteilen gibt es unter den Interessensgruppen in einer Zeit der Knappheit der finanziellen Ressourcen nicht. Die Maßnahmen der Paritätischen Kommission werden durch dieselbe Wirtschaftslage zusätzlich ihrer intendierten Wirkung weitgehend beraubt. Dies wiederum verschlechtert die allgemeine Meinung und veranlaßt viele, die Sinnhaftigkeit der Sozialpartnerschaft in Frage zu stellen.
Als wichtigstes Ergebnis dieser Untersuchung soll die Feststellung gelten, daß die Zukunft der Sozialpartnerschaft weitgehend von einer zukünftigen besseren Wirtschaftslage und der verstärkten politischen Absicherung der Regierungsparteien SPÖ und ÖVP abhängen wird. Das Eintreten dieser beiden Faktoren, welche zum großen Teil das Überleben der Sozialpartnerschaft sichern würden, erscheint allerdings äußerst unwahrscheinlich.
Literatur und Quellen:
FUNK, Bernd-Christian: Einführung in das österreichische Verfassungsrecht. Graz 1982.
LANG, Werner: Kooperative Gewerkschaften und Einkommenspolitik. Das Beispiel Österreich.
In: BÖHRET u.a. (Hg.): Beiträge zur Politikwissenschaft Bd.13, Frankfurt am Main u.a.
1978.
MAYR, Martin: Die österreichische Sozialpartnerschaft. In: PICHLER, Johannes W.,
QUENE, Theo (Hrsg.): Sozialpartnerschaft und Rechtspolitik. Wien, Köln 1991.
MESCH, Michael (Hg.): Sozialpartnerschaft und Arbeitsbeziehungen in Europa. Wien 1995.
NICK, Rainer, PELINKA, Anton: Bürgerkrieg - Sozialpartnerschaft. Das politische System
Österreichs. 1. und 2. Republik. Ein Vergleich. Wien 1982.
SPIEGEL Peter: Die großen Fünf der österreichischen Gesellschaft. Eine Analyse der
Grundsatzprogramme der Sozialpartnerverbände Österreichs. Wien 1987.
TALOS, Emmerich: Entwicklung, Kontinuität und Wandel der Sozialpartnerschaft. In: Ders.
(Hg.), Sozialpartnerschaft. Wien 1993. 11-34.
Das gesamte Quellenmaterial, das meiner in Punkt 4 angestellten Analyse der Zeitungsartikel zwischen Ende 1995 und Anfang 1997 zugrundeliegt, wurde aus dem Tagblattarchiv der Sozialwissenschaftlichen Dokumentationsstelle der Arbeiterkammer Wien entnommen. .

Patrick Horvath: "Über Philosophie und Politik"
Kontakt
© 1997 Patrick Horvath
