
Machiavelli
Über das Spannungsfeld von Politik und Moral
DIPLOMARBEIT
zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie
an der Human- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Wien
eingereicht von
Patrick Horvath
Wien, November 2000


"Der Größe dieses Namens wird kein Lob gerecht"
("Tanto nomini nullum par elogium")
Inschrift auf dem Grabmal Machiavellis in der Kirche Santa Croce in Florenz, gesetzt von einem britischen Bewunderer des Philosophen

Inhalt
Widmung
Inhalt
Vorwort
Teil I: Machiavelli im geistesgeschichtlichen Kontext
A.) Machiavellis Bruch mit dem Mittelalter
B.) Machiavelli - ein Vorläufer von Thomas Hobbes?
1. Die Grundgedanken des Thomas Hobbes
Allgemeines
Hobbes’ negatives Menschenbild
Hobbes’ These von der Gleichheit der menschlichen Fähigkeiten
Der Naturzustand
Der Krieg aller gegen alle
Naturrecht und Naturgesetz
Der Gesellschaftsvertrag und der Leviathan
Die Entscheidung im Naturzustand als Gefangenendilemma
2. Machiavelli als Vorläufer von Hobbes
Inwieweit Machiavelli kein Vorläufer von Hobbes ist
Inwieweit Machiavelli doch ein Vorläufer von Hobbes ist
* Negatives Menschenbild und Primat des Eigeninteresses
* Die Ablehnung der mittelalterlichen Legitimationstheorien
* Der Staat als Beschützer seiner Bürger
* Politische Ordnung als Antwort auf die Krise
Teil II: Machiavellis Hauptwerke - Discorsi und Fürst
A.) Machiavellis Discorsi
1. Zur Rezeptionsgeschichte
2. Der Einfluß des Titus Livius
3. Machiavellis Republikbegriff
Die starke Republik
Die Überlegenheit der Republik gegenüber der Autokratie
Aut Caesar aut Brutus
Vom Erhalt der republikanischen Freiheit
Von der Vergrößerung einer Republik
4. Machiavelli und die Religion
Die Religion als Mittel der Politik
Die Kritik an der christlichen Lehre
Die Kritik an der Katholischen Kirche
5. Ratschläge zu Machtgewinn und Machterhalt
Entweder gut oder böse handeln - kein Mittelweg
Bescheidenheit - keine erfolgreiche Strategie
Mit Ungestüm und Kühnheit ist man oft erfolgreich
Machiavelli als Ratgeber für Privatleben und Beruf?
B.) Machiavellis Fürst
1. Der Begriff des "Fürsten"
2. Realistische Politikbetrachtung
Die "Machiavellische Ermächtigung"
Der unbewaffnete Prophet
Negatives Menschenbild
3. Der Begriff der "virtù"
Anknüpfung an das antike Tugendideal
Virtù als "Inbegriff politischer Energie und Kompetenz"
Weitere Charakteristika des virtù-Begriffs
4. Der Begriff der "fortuna"
Politik ist Schicksal
Virtù und fortuna
Gelegenheit macht Fürsten
Die Zeiten ändern sich...
5. Machiavellis Typologie der Herrschaftsformen
Allgemeines
Ererbte Fürstenherrschaft
Gemischte Fürstenherrschaft
Neuerworbene Fürstenherrschaften
* Durch Tüchtigkeit und eigene Waffen erworbene Fürstenherrschaft
* Durch Glück und fremde Waffen erworbene Fürstenherrschaft
* Durch Verbrechen erworbene Fürstenherrschaft
* Durch die Gunst der Mitbürger erworbene Fürstenherrschaft
6. Der revolutionäre Fürstenspiegel
Die Bombe im Gebetbuch
Der Politiker als Tiermensch
Die Kunst der Tarnung
Teil III: Machiavellis "Drei-Schranken-Theorie"
A.) Über Agathokles. Oder: Das Konzept des Ruhmes
B.) Machiavelli - ein Verantwortungsethiker? Oder: Der Zweck heiligt die Mittel
Gesinnungs- und Verantwortungsethik nach Max Weber
Machiavelli als Verantwortungsethiker
C.) Die taktische Selbstbeschränkung der Politik. Oder: Moral als langfristiger Egoismus?
Menschenrechte als Staatsräson?
Moralisches Handeln - manchmal ein Weg zum Erfolg?
Nur ein gerechter Friedensvertrag ist von Dauer
Die Forderung nach dem Rechtsstaat
Zwei Arten der Moralbegründung in der Tradition
Machiavellis "Drei-Schranken-Theorie"
Zusammenfassung
Literatur

Vorwort
Bei meiner Lektüre philosophischer Klassiker verspürte ich schon immer eine Vorliebe für die Beschäftigung mit den wirklichen oder vermeintlichen "Bösewichtern" der Geistesgeschichte. Gründe dafür existieren genug. Zunächst gibt es wahrscheinlich keine langweiligere Beschäftigung als das Studium der "braven", der angepaßten, der konventionellen Denker - so es sich hierbei überhaupt um Denker handelt. Und daß ich danach strebe, Langeweile nach Möglichkeit aus meinem Leben zu verbannen, wird man besonders in einer Gesellschaft verstehen, in der die Unterhaltung nicht nur zum zentralen Lebensinhalt der meisten Menschen und zum fast ausschließlichen Angebot der Massenmedien, sondern in der bewährten, römischen Form von "Brot und Spielen" auch zur scheinbaren Hauptaufgabe der Politik geworden ist.
Darüber hinaus habe ich die Erfahrung gemacht, daß viele Denker zu Unrecht als "böse" gelten - oftmals ist dies nur der Fall, weil sie auf unliebsame Wahrheiten hinweisen, die niemand so gerne hören will; oder weil sie eine Perspektive einnehmen, von der aus sie sehen, was nach Meinung einiger selbstberufener Zensoren offenbar niemand sehen sollte. Ein wahrheitssuchender Geist darf sich meiner Meinung nach aber davon nicht abschrecken lassen. Oftmals werden die sogenannten "bösen" Philosophen auch einfach nur falsch verstanden.
Es gibt nun kaum eine historische Persönlichkeit, die ein schlechteres Image hat als Niccolò Machiavelli. So wurde sein Vorname im englischen Sprachraum zum Synonym für den Teufel ("Old Nick" bedeutet dort in etwa so viel wie bei uns der "Leibhaftige"). Sein Nachname hingegen dient bis heute als Bezeichnung für verabscheuungswürdige, heimtückische, machthungrige und menschenfeindliche Realpolitik ("Machiavellismus"). Seine Werke landeten auf Betreiben der Jesuiten auch bald auf dem Index der verbotenen Bücher, den die Katholische Kirche ja dankenswerterweise bis heute führt, um mich auf interessante Klassiker und Neuerscheinungen aufmerksam zu machen.
Bei allem vordergründigen Moralisieren gegen Machiavelli scheint man aber zu vergessen, daß er immerhin überzeugter Republikaner war - und dies im frühen 16.Jahrhundert, als die Monarchien Europa dominierten. Er hat zudem, wie ich in meiner Arbeit behaupte, Überlegungen angestellt, die in die Nähe eines Menschenrechtsbegriffes kommen, für einen Rechtsstaat plädiert, und nicht zuletzt der von ihm unter gewissen Voraussetzungen zugelassenen Unmoral in der Politik deutliche Schranken gesetzt (was ich daher entsprechend in der vorliegenden Arbeit als Machiavellis "Drei-Schranken-Theorie" bezeichne). Ob die Jesuiten dies alles von sich behaupten können, sei dahingestellt. Erschwert wird die Auseinandersetzung mit Machiavelli gerade heute zusätzlich noch dadurch, daß ihn Benito Mussolini zu seinem philosophischen Vorbild erkor und sich bei jeder Gelegenheit auf ihn berief. Daher gilt der Florentiner Philosoph vielen bis heute als Vorläufer des Faschismus. Ich sage dazu: Offenbar hat Mussolini die "Discorsi" nicht gelesen, wäre ihm doch sonst ein Kapitel aufgefallen mit dem Titel "So lobenswert die Gründer eines Freistaats oder eines Königreichs sind, so schimpflich sind die Begründer einer Gewaltherrschaft". Allein in der Überschrift, aber auch im Kapitel selbst, wird eindeutig klar, was Machiavelli von Diktatoren vom Schlage Mussolinis oder Hitlers gehalten hätte, die eine Republik stürzen und durch ihre persönliche Tyrannis ersetzen.
Ich möchte abschließend der Betreuerin meiner Diplomarbeit, Frau Prof.Dr. Herlinde Pauer-Studer, meinen Dank aussprechen. Ihre zahlreichen Hinweise (vor allem zum Gefangenendilemma als Interpretationshilfe zu Hobbes’ Konzept des Naturzustands sowie den "egoistischen" und "nicht-egoistischen" Modellen der Moralbegründung in der Geistesgeschichte) waren für meine Arbeit sehr wertvoll; und ich kann sagen, daß mein von Machiavelli und Hobbes geprägtes skeptisches Menschenbild durch ihr uneigennütziges Engagement für meine Person nachhaltig erschüttert worden ist. Ich bin ihr aber nicht zuletzt auch deshalb besonders verpflichtet, weil der Name "Machiavelli" sogar heute noch eine so abschreckende Wirkung entfaltet, daß viele andere, die weniger Mut besaßen, die Betreuung meiner Diplomarbeit abgelehnt hätten und haben. Außerdem ergeht mein Dank an Herrn Prof.Dr. Wilhelm Schwabe, der sich spontan bereit erklärte, als mein "Zweitprüfer" zu fungieren.
Wien und Kástellos (Kreta), Sommer 2000
Patrick Horvath

Teil I
Machiavelli im geistesgeschichtlichen Kontext
Machiavellis Bruch mit dem Mittelalter
Machiavellis Denken stellt einen radikalen Bruch mit der politischen Philosophie des Mittelalters dar. Unter dem Eindruck der schweren Krise des damaligen Italien fragt die politische Theorie Machiavellis nicht mehr nach den Bedingungen eines guten und tugendhaften Lebens, wie noch das Mittelalter. Für Thomas z.B. war die menschliche Gemeinschaft auf ein höheres Ziel ausgerichtet: die christlich verstandene Tugend und damit letztlich auf das Seelenheil. Was Machiavelli interessiert, ist hingegen allein "die Dauerhaftigkeit, die innere Stabilität und äußere Expansionsfähigkeit der staatlichen Gemeinschaften". Münkler meint, in Machiavellis Denken zeigt sich auch eine neue, fundamentale politische Kategorie der Neuzeit: die Selbsterhaltung - vor allem des Staates. Damit kehrt Machiavelli die Prioritäten des Mittelalters quasi um: Während etwa Thomas die Selbsterhaltung dem Heil der Seele unterordnen würde, spielt letzteres bei Machiavelli praktisch keine Rolle mehr. Vielmehr könnte es fast scheinen, daß Machiavelli mit dem berühmten Satz aus seiner Florentiner Geschichte, in dem er demjenigen Anerkennung zollt, der das Vaterland höher schätzt als sein Seelenheil, aus dem vormals Substantiellen ein bloßes Akzidens macht. Machiavelli verläßt damit den normativen Ansatz der Politikbetrachtung früherer Zeiten und bahnt den Weg zum realistischen Paradigma.
Welche Stellung Machiavelli der Religion überhaupt beimißt, werde ich im Teil II im Kapitel "Machiavelli und die Religion" genauer ausführen. Nur ein Hauptergebnis sei schon genannt: Machiavelli verwandelt die Religion von der Norm der Politik zu ihrem Mittel. Für ihn ist Religion lediglich ein Instrument, das für die Erreichung politischer Ziele eingesetzt werden kann. Dies bedeutet unter anderem auch eine Emanzipation der Politik gegenüber der Religion. Die Eigenständigkeit und Eigengesetzlichkeit der Politik wird gegenüber der vormals übermächtigen Theologie zur Geltung gebracht. Diese besonders von Machiavelli betriebene Säkularisierung des politischen Denkens - Grundvoraussetzung aller späteren maßgeblichen Entwicklungen auf diesem Gebiet - sollte seine epochale, historische Leistung werden. Seine Arbeit ist damit durchaus der eines Kopernikus zur Seite zu stellen, der den Vorrang der Naturwissenschaft gegenüber der Theologie behauptete. Man kann mit Fug und Recht behaupten, die Neuzeit beginnt - zumindest auf dem Gebiet des politischen Denkens - mit Machiavelli. Seine Arbeit ist im Zusammenhang mit der allgemeinen Säkularisierungstendenz der Renaissance zu sehen.
Der der mittelalterlichen Geborgenheit verlustig gegangene Mensch ist bei Machiavelli auf sich allein gestellt. "Es soll niemand so töricht sein, zu glauben, wenn sein Haus einstürzt, daß er es Gott überlassen kann, ihn zu retten", verkündet Machiavelli seinen Zeitgenossen.
Machiavelli ist ein Denker der Krise, der Krise Italiens, der Krise seiner Heimatstadt Florenz, der Krise der schon zerbröckelnden mittelalterlichen Welt, die schon vieles von ihrer Glaubwürdigkeit verloren hat. Machiavelli versucht, das Gottvertrauen durch Selbstvertrauen zu ersetzen - nicht nur der Staat, auch der in der Politik tätige Mensch muß für seine Selbsterhaltung sorgen. Dazu braucht er die Fähigkeit, von der später im Teil II noch genauer die Rede sein wird: virtù, was bei Machiavelli ungefähr soviel bedeutet wie politische Tüchtigkeit.
Damit zeigt sich in Machiavellis Schriften auch eine andere Tendenz der Renaissance: die Besinnung des Individuums auf sich selbst und seine Fähigkeiten. Machiavelli ist ein vom heraufdämmernden bürgerlichen Zeitalter geprägter Autor. Wie das aufstrebende Bürgertum seiner frühkapitalistischen Heimatstadt Florenz bringt Machiavelli das Individuum zur Geltung. Und er fordert in den "Discorsi" eine bürgerliche Regierungsform: die Republik. Machiavelli ist somit einer der ersten Vertreter einer neuen Epoche. Wie andere Denker der Renaissance auch, greift Machiavelli auf die Antike zurück. Er benötigt die antiken Autoren als eine Art Steinbruch; sie liefern ihm das Baumaterial zu einer Gegenwelt zum Mittelalter, die Machiavelli aufbauen will. Machiavelli braucht die antiken Historiker, wobei es ihm vor allem Titus Livius angetan hat (auf den ich im Teil II bei der Behandlung von Machiavellis "Discorsi" noch zurückkommen werde): einerseits, um aus ihnen die Vorbilder für seine politischen Schriften zu beziehen, andererseits, um ihnen eine Geschichtsauffassung zu entnehmen, die nicht auf das Transzendente ausgerichtet ist. Machiavellis Geschichtsbild kommt ohne göttliches Eingreifen aus. Die Menschen formen ihre eigene Geschichte. In dieser Sichtweise greifen Säkularisierung und das neue Selbstvertrauen der Menschen ineinander.
Machiavelli gleicht einer Planierraupe, die das alte Weltbild einer sterbenden Epoche einreißt. Er setzt ein neues, weltliches Gedankengebäude an die Stelle des alten. Doch es sollte anderen Denkern der Neuzeit vorbehalten bleiben, vieles, was Machiavelli sagte, systematisch zu vollenden. Einer dieser Denker war Thomas Hobbes.
Machiavelli - ein Vorläufer des Thomas Hobbes?
1. Die Grundgedanken des Thomas Hobbes
Allgemeines
Alle philosophischen Systeme können mit Bauwerken verglichen werden (man spricht nicht umsonst von "Gedankengebäuden"). Wie in jedem Haus gibt es auch in ihnen tragende Säulen und Wände, aber auch nebensächliche architektonische Beifügungen, deren Veränderung oder Weglassung niemals das ganze Gebäude in seinem Bestand gefährden könnte.
Führt man dieses Gleichnis weiter, kann man sagen, daß die Ideen über Naturzustand und Naturgesetz praktisch der Grundpfeiler von Hobbes philosophischem Werk sind, welches letztere, nebenbei bemerkt, in der Architektur seiner Argumentation einem barocken, fast manieristisch anmutenden Bau ähnelt. Fast alle Gedanken von Hobbes stützen sich auf die besagte Grundlage und haben ohne sie keinen Bestand.
In der weiteren Folge geht es mir darum, Hobbes’ Grundgedanken herauszuarbeiten, um danach den Versuch der Beantwortung der Frage folgen zu lassen, ob und inwieweit Machiavelli als sein Vorläufer betrachtet werden kann.
Hobbes' negatives Menschenbild
"Homo homini lupus", lautet des Thomas Hobbes berühmtester Ausspruch, der sein negatives Menschenbild in eine einprägsame Formel bringt.
Man könnte heute mit einem Augenzwinkern sagen, daß dieser Ausspruch mißglückt ist, weil er den Wolf beleidigt; dieser ist sicher bei weitem nicht so grausam wie der Mensch es oftmals sein kann.
Doch sieht man von dieser eher zynischen Feststellung ab, können wir das, was Hobbes tatsächlich meint, mit anderen Worten etwa so wiedergeben: Der Mensch ist von Natur aus grausam, habgierig, egoistisch etc.; ein Raubtier voller Bosheit und dazu des Menschen größter Feind.
Hobbes' Ausspruch markiert auch seine Distanz zur "Politik" des Aristoteles. Dieser sieht den Menschen als "politisches Tier", dessen Fähigkeit zur Gemeinschafts- und Staatenbildung eine natürliche Veranlagung darstellt. Aristoteles vergleicht den Menschen in dieser Hinsicht auch mehrmals mit den Bienen und den Ameisen.
Daß aber der Mensch in dieser Hinsicht nicht den Bienen oder Ameisen gleichkommt, stellt Hobbes u.a. im siebzehnten Kapitel seines Hauptwerkes "Leviathan" fest. Für Hobbes ist der menschliche Staat ein aus Verträgen aufgebautes künstliches Gebilde, kein natürliches wie bei manchen Insekten. Fünf Gründe führt Hobbes an besagter Stelle an, warum der Mensch kein staatsbildendes Tier ist; alle laufen sie darauf hinaus, die eigentlich anarchistischen und destruktiven Instinkte des Menschen herauszuarbeiten:
* Die Menschen liegen (im Gegensatz zu den Tieren) miteinander im ständigen Wettstreit um Ehre und Würde; auch gibt es unter ihnen häufiger als bei Insekten Neid, Haß oder Krieg.
* Das Gut der Insekten ist gemeinsam; und jeder fördert den Gemeinbesitz. Der Mensch aber ist habgierig und egoistisch, auch freut er sich, wenn andere weniger haben als er.
* Die Tiere tadeln die Verwaltung und die Obrigkeit nicht; der einzelne Mensch aber ist dermaßen eitel, daß er ständig die Regierung und Verwaltung kritisiert und überhaupt dauernd räsoniert. Dies ist aber eine Quelle der Unruhe.
* Die Tiere haben zwar eine Stimme, aber keine ausgefeilte Sprache; und vor allem keine Redekunst. Diese aber verdreht die Wahrheit ständig und stiftet so Unfrieden.
* Die Tiere sind zufrieden, solange sie genug haben; der Mensch aber wird unausstehlich, wenn er viel besitzt und sorgt dann für Zwietracht.
Auch in "De cive" betont Hobbes ständig die Verworfenheit des Menschen. Man braucht nur zu beobachten, wie abfällig bei menschlichen Zusammenkünften über die Abwesenden gesprochen wird oder wie sich selbst Gespräche unter Gelehrten zutragen. Wenn nämlich mehrere Menschen zum gemeinsamen Philosophieren zusammenkommen, sind dort "ebenso viele, die Belehrung austeilen, als da Menschen sind", denn alle wollen als Meister ihres Faches erscheinen. Dies alles ist u.a. ein beredtes Zeugnis dafür, daß ein negatives Menschenbild gerechtfertigt erscheint.
Es scheint, daß Philosophen, die ein positiveres Menschenbild vertreten, eher für eine geringe staatliche Autorität, eine egalitäre Gesellschaft, mildere Gesetze und Pluralität eintreten (z.B. Rousseau). Philosophen, die von einem negativen Menschenbild ausgehen, tendieren dagegen zur Glorifizierung der Macht (z.B. Machiavelli, Hobbes, Nietzsche). Das Menschenbild ist für das Endergebnis der Staatstheorie offenbar sehr entscheidend.
Hobbes' These von der Gleichheit der menschlichen Fähigkeiten
Hobbes ist der Meinung, daß die Menschen hinsichtlich ihrer Fähigkeiten relativ gleich begabt sind. Trotz der Tatsache, daß es stärkere und schwächere Menschen gibt, "wird man gewiß selten einen so schwachen Menschen finden, der nicht durch List und in Verbindung mit anderen, die mit ihm in gleicher Gefahr sind, auch den stärksten töten könnte". Auch hinsichtlich der geistigen Begabungen sind die Menschen relativ gleich, sieht man vom Gebrauch der Sprache und von der Kenntnis der Wissenschaften ab; hier sind die Begabungen freilich ungleich verteilt. Hobbes hält es für ausgemacht, daß die Fähigkeit der Beherrschung von Sprache und Wissenschaft nur auf Übung beruht; die prinzipielle Verteilung der Verstandeskräfte, also das potentielle Vermögen dazu, meint Hobbes, sei ziemlich dieselbe.
Der Naturzustand
Hobbes konstruiert einen ursprünglichen Zustand, in dem sich die Menschen dereinst befunden haben sollen. Dieser Naturzustand zeichnet sich aus durch das Fehlen einer staatlichen Ordnung. Es muß an dieser Stelle festgestellt werden, daß man dem Verständnis des Hobbes’schen Naturzustands eher gerecht wird, wenn man ihn als ein vernünftiges Gedankenmodell und Testfall der staatlichen Legitimität und nicht als historisches Faktum versteht - ansonsten wäre er rasch durch historisch-empirisches Argumentieren widerlegbar, wie es z.B. David Hume getan hat.
Wenn staatlicher Zwang den Menschen nicht aufhält, wenn es keine Gesetze gibt, die den Menschen einschüchtern, wird den niederen, destruktiven Trieben des Menschen freier Lauf gelassen. Nun fallen die Menschen übereinander her, um sich gegenseitig auszuplündern, zu unterwerfen, zu töten etc. Davon kann sie auch keine vernünftige Überlegung abhalten, denn der Trieb ist wesentlich stärker als die Vernunft. Eine Garantie für die Ordnung kann es nur geben, wenn es eine starke Macht gibt, die den Einhalt der Gesetze mit Gewalt verteidigen kann und somit Furcht erregt. Im Bürgerkrieg (den er in einem anderen Werk mit dem biblischen Ungeheuer Behemoth personifiziert) haben die Gesetze ähnlich wie im Naturzustand keine Autorität, denn es gibt keine Staatsmacht, welche sie verteidigt; und sogleich fallen die Menschen übereinander her.
Nun kann sich aber im Naturzustand, aufgrund der oben dargelegten Gleichheit der Kräfte ein jeder berechtigte Hoffnung auf die Erfüllung seiner Triebe machen. Zentral ist hierbei der Wunsch nach Selbsterhaltung, das ist aber bei weitem nicht der einzige Antrieb. Aber selbst, wenn ein Mensch nur nach der Selbsterhaltung strebt, wird er andere angreifen müssen; schon alleine, um ihren Feindseligkeiten zuvorzukommen. Die häufigsten Anlässe, bei denen Menschen miteinander uneins werden, sind Mitbewerbung (um Macht, Geld etc.), Verteidigung (gegen das Machtstreben anderer) und die Gier nach Ruhm.
Was nun aus der Schlechtigkeit des Menschen einerseits und der Gleichheit der menschlichen Kräfte andererseits im Naturzustand (also bei Fehlen einer staatlichen Zwangsmacht) logisch folgt, ist der sogenannte "bellum omnium contra omnes". Jeder kämpft gegen jeden; dieser Krieg ist ein furchtbares Chaos von Blut und Gewalt. Das schreibt Hobbes u.a. im dreizehnten Kapitel des "Leviathan", wenn er meint:
"Hieraus ergibt sich, daß ohne eine einschränkende Macht der Zustand der Menschen ein solcher sei, wie er zuvor beschrieben wurde, nämlich ein Krieg aller gegen alle."
Der Krieg aller gegen alle
Da ein jeder in diesem Kriegszustand unter ständiger Bedrohung lebt, können sich die höheren Kräfte nicht entfalten. Wer sollte z.B. den Acker bestellen, wenn er ständig Raub und Plünderung fürchten muß oder um sein Leben zittert? Aber auch andere wichtige Güter, die nur im Frieden (d.h. in der Abwesenheit des Krieges) gedeihen können, sind nicht möglich.
Hobbes schreibt dazu im dreizehnten Kapitel des "Leviathan":
"Da findet sich kein Fleiß, weil kein Vorteil davon zu erwarten ist; es gibt keinen Ackerbau, keine Schiffahrt, keine bequemen Wohnungen, keine Werkzeuge höherer Art, keine Länderkenntnis, keine Zeitrechnung, keine Künste, keine gesellschaftlichen Verbindungen; stattdessen ein tausendfaches Elend; Furcht, gemordet zu werden, stündliche Gefahr, ein einsames, kümmerliches, rohes und kurz dauerndes Leben."
An dieser Stelle muß betont werden, daß Hobbes zur Zeit des englischen Bürgerkrieges lebte; dieser Umstand ließ ihn die Aktualität der Frage nach dem richtigen und geordneten Staatswesen brennend spüren.
Nicht nur im Bürgerkrieg fallen die Menschen wieder in den Naturzustand zurück, sondern auch die Staaten leben untereinander im Naturzustand; hier gibt es keine übergeordnete Macht, die stark genug ist, das Recht mit Gewalt durchzusetzen (Hobbes wertet den bewaffneten Frieden und den Vorsatz, bei Gelegenheit Gewalt einzusetzen, auch als eine Art Krieg).
In einem Kriegszustand gibt es keinen gesicherten Besitz; den Besitz behält man nur, solange man ihn sich durch seine Stärke zu sichern versteht. Überfälle, Plünderungen, Verlust des Besitzes und gewaltsamer Tod stehen im Naturzustand an der Tagesordnung - bis man diesen leidvollen Zustand durch den Abschluß des Gesellschaftsvertrags überwindet.
Naturrecht und Naturgesetz
Das Naturrecht ist das Recht, welches im Naturzustand herrscht. Es ist "die Freiheit, nach welcher ein jeder zur Erhaltung seiner selbst seine Kräfte beliebig gebrauchen und folglich alles, was dazu etwas beizutragen scheint, tun kann."
Daraus wird das ursprüngliche Recht aller auf alles abgeleitet, "da es nichts gibt, was er nicht irgendeinmal zur Verteidigung seines Lebens gegen einen Feind mit Erfolg gebrauchen könnte,..."
Der Unterschied zwischen Recht und Gesetz besteht darin, daß das Recht eine Freiheit beinhaltet (man darf etwas tun), das Gesetz aber eine Verbindlichkeit (man muß etwas tun). Von Natur aus ist der Mensch, meint Hobbes, frei, alles zu tun, was ihm beliebt. Diese Freiheit eben ist das Naturrecht, d.h. das Recht auf alles, welches, wie im obigen Zitat angeführt, aus dem Recht der Selbsterhaltung im Naturzustand hervorgeht.
Solange der Naturzustand gilt, existiert für alle das Naturrecht, alle haben also das Recht auf alles. Wenn aber alle ein Recht auf alles haben, schränken sie sich gegenseitig total ein; der Krieg aller gegen alle ist die logische Folge des Naturrechts. Um denselben Gedanken noch einmal anders auszudrücken: Wenn es keine staatliche Ordnung gibt, ist die Freiheit (Willkürfreiheit) eines jeden unendlich. Wenn aber alle unendlich viel Freiheit besitzen, sinkt die Freiheit eines jeden auf Null.
Mit den Naturgesetzen hat es etwas anderes auf sich. Es sind Maximen, die unter diesen Voraussetzungen notwendig aus der Vernunft entstehen und dieser auch einsichtig sind. Diese Naturgesetze entspringen schon im Naturzustand aus den Köpfen der Menschen, allerdings haben sie dort noch keine praktische Gültigkeit. Denn der Mensch ist für Hobbes ein Triebwesen; was auch immer seine Vernunft ersinnt, wird hinfällig, sobald sich seine Triebe dagegen stemmen. Diese vernünftigen Gesetze können in der Praxis nur Gültigkeit erlangen, wenn es eine Staatsgewalt gibt, die für ihre Einhaltung sorgt.
Von diesen natürlichen Gesetzen gibt es zwei von primärer Priorität und eine ganze Reihe von sekundären; das geht schon aus der Kapiteleinteilung des Leviathan hervor.
Hobbes formuliert die zwei wichtigen Naturgesetze und ihre Herleitung - etwas geschraubt - folgendermaßen:
"Also ist folgendes eine Vorschrift oder allgemeine Regel der Vernunft: suche Friede, solange nur Hoffnung darauf besteht; verschwindet diese, so schaffe dir von allen Seiten Hilfe und nutze sie; dies steht dir frei. Der erste Teil dieser Regel enthält das erste natürliche Gesetz: suche Friede und jage ihm nach; der zweite den Inbegriff des Naturrechts: jeder ist befugt, sich durch Mittel und Wege aller Art selbst zu verteidigen. Aus diesem ersten natürlichen Gesetz ergibt sich das zweite: sobald seine Ruhe und Selbsterhaltung gesichert ist, muß auch jeder von seinem Recht auf alles - vorausgesetzt, daß andere auch dazu bereit sind - abgehen und mit der Freiheit zufrieden sein, die er den übrigen eingeräumt wissen will."
Einfacher ausgedrückt: Jeder muß vernünftigerweise einsehen, daß die Beendigung des Krieges aller gegen alle, also der Friede erstrebenswert ist; dies schon aus Gründen der Selbsterhaltung, die von diesem Krieg gefährdet ist und der Furcht, die aus ihm entspringt. Ein jeder wird also wünschen, daß dieser Zustand aufhört. Wenn keine Hoffnung darauf besteht, wird er alles aufbieten, um sich selbst zu erhalten und zu den "Privilegien" greifen, die ihm das Naturrecht gestattet; primär wird aber jeder das Ende dieses Bürgerkriegs wollen.
Einem jeden muß aber auch einleuchten, daß der bellum omnium contra omnes nur beendet werden kann, wenn er auf sein Naturrecht verzichtet oder es an eine Obrigkeit überträgt - vorausgesetzt, alle anderen tun es auch. Wenn er sich weigert, das Recht auf alles aufzugeben, werden die anderen es auch nicht aufgeben.
Nach Thomas Hobbes ist das zweite Naturgesetz gleichbedeutend mit der allgemein einleuchtenden Erkenntnis des bekannten Sprichwortes: "Was andere dir nicht tun sollen, tue ihnen auch nicht."
Hobbes untersucht als Vorbereitung zu seiner Theorie des Gesellschaftsvertrags die Möglichkeit einer Übertragung von Rechten. Er vertritt die Meinung, daß Übertragungen von Rechten nur freiwillig geschehen können; sonst sind sie ungültig. Die Freiwilligkeit einer solchen Übertragung ist nur gewährleistet, wenn die Übertragung dem des Rechtes Entsagenden einen Vorteil bringt. Es gibt Rechte, deren Übertragung keinerlei Vorteil bringen, daher sie auch nicht gültigerweise übertragen werden können, z.B. das Recht, sich gegen Gewalt zu verteidigen; überhaupt alles Recht, das die nackte Selbsterhaltung gewährleistet. Erzwungene Übertragungen sind nach Hobbes ungültig.
Die Übertragung der Rechte erfolgt durch einen Vertrag. Der Vertrag muß den oben angeführten Kriterien entsprechen. Trotz dem der Vertrag nicht erzwungen sein darf, ist die bloße Furcht, die uns bewegt, einen Vertrag einzugehen, kein Hindernis für seine Gültigkeit. Diese offenbar paradoxe Feststellung (als ob uns gewaltige Furcht nicht de facto zwingen würde!) ist für Hobbes nötig, um sein kompliziertes Gedankengebäude durchhalten zu können.
Nun gibt es andere natürliche Gesetze, die unmittelbar oder mittelbar aus den oberen folgen. Zunächst verlangen diese anderen Naturgesetze, daß vertragliche Abkommen eingehalten werden; denn geschieht das nicht, gibt es keine Chance, den Krieg aller gegen alle zu beenden.
Solange es das Recht aller auf alles gibt, existiert keine Ungerechtigkeit. Gerechtigkeit wird also erst durch die Naturgesetze und die Verträge bestimmt. Daß die Verletzung des geschlossenen vertraglichen Abkommens Ungerechtigkeit ist, ist ein weiteres Naturgesetz. Gerechtigkeit aber ist der durch das Naturgesetz festgelegte Entschluß, jedem das Seinige zu geben.
Hobbes distanziert sich in diesem Zusammenhang von Menschen, die aus religiösen Gründen gegen Verträge, insbesonders gegen den Gesellschaftsvertrag verstoßen, den er zu konstruieren versucht. In diesem Zusammenhang muß bemerkt werden, daß Thomas Hobbes die Ermordung des französischen Königs Heinrich des IV. durch den religiösen Fanatiker Ravaillac miterlebte, dies mag seine politische Auffassung mitbestimmt haben.
Hobbes hielt ein solches Vorgehen für ein Unrecht. Denn er geht davon aus, daß sich der Glaube auf die Bibel stützt; letztere, argumentiert er aber, würde jedoch an vielen Stellen betonen, daß man dem Herrscher folgen muß. Daher kann es für Hobbes kein religiös motiviertes Widerstandsrecht geben.
Des Thomas Hobbes religiöse Ansichten sind ein eigenes Kapitel für sich. Seine Zeitgenossen warfen ihm Atheismus vor; dies stritt er allerdings ab. Ich denke, niemand hat das Recht, einem anderen Menschen den Glauben abzusprechen, wenn dieser behauptet, ihn zu haben. Fest steht aber doch, daß Thomas Hobbes' Religiosität sehr eigenwillig war. Seine Vorliebe gilt dem Alten Testament, sein Gottesbild ist davon sehr geprägt: Der Gott, von dem in seinem Werk die Rede ist, hat mehr das Wesen des zürnenden, strafenden Machthabers, nicht des vergebenden, liebenden Vaters des Neuen Testaments. Die Bibel interpretiert Hobbes aber immer so, wie es ihm gerade in den Kram paßt, d.h. er läßt sich von ihr nicht viel sagen. Die Interpretation der beiden biblischen Ungeheuer Behemoth und Leviathan als Bürgerkrieg und geordneter Machtstaat z.B. ist sehr gewagt und hat wenig Bezug zu den entsprechenden Kapiteln der Bibel (Hiob 40 und 41). Er sucht im "Leviathan" auch ständig zu beweisen, daß die Bibel im Prinzip nur eine Wahrheit mitteilt: das Gebot, der Obrigkeit zu gehorchen und den Gesellschaftvertrag zu halten. Daß er mit einer solchen Interpretation die Bibel oftmals vergewaltigt, ist offensichtlich; seine Intention ist aber, die Bedeutung der Bibel auf die Relevanz für die Staatstheorie einzuschränken. In dieser Hinsicht ist er ein typischer Vertreter der neuzeitlichen Philosophie.
Ein anderes natürliches Gesetz besagt: "Wer eine Wohltat unverdient empfängt, muß danach streben, daß der Wohltäter sich nicht genötigt sehe, seine erwiesene Wohltat zu bereuen." Dies würde nämlich Versöhnung unmöglich machen und damit dem dauerhaften Frieden im Staatsinneren entgegenwirken.
Ferner muß jeder dem anderen nützlich werden, wie es Hobbes ausdrückt. Damit meint er, daß jeder Mensch, der der Gemeinschaft nicht auf irgendeine Art nützt, damit rechnen muß, verstoßen zu werden, denn auch er wirkt dem Aufbau einer funktionierenden Gemeinschaft entgegen.
Ein weiteres natürliches Gesetz lautet nach Hobbes: "Ein jeder muß Beleidigungen vergeben, sobald der Beleidiger reuevoll darum bittet und er selbst für die Zukunft sicher ist."
Auch dies ist nötig, um den dauerhaften Frieden zu sichern.
Außerdem ist zu beachten: "Bei jeder Rüge muß auf die Größe nicht des vorhergegangenen Übels, sondern des zu erhoffenden Guten Rücksicht genommen werden."
Ebenfalls aus der Sicherung des Friedens und aus der Berücksichtigung des vorigen Gesetzes soll nach Hobbes die Praxis des Strafvollzuges folgen, nur Strafen zu verhängen, die zur Besserung des Sünders und zur Warnung anderer dienen. Die Verletzung dieses Gesetzes ist nach Hobbes Grausamkeit.
Auch schreiben die Naturgesetze vor, daß niemand durch Tat, Wort, Miene oder Gebärde Verachtung oder Haß gegen jemanden zeigen darf. Auch diese Regel soll den dauerhaften Frieden garantieren.
Ein weiteres Gesetz legt fest, daß alle Menschen von Natur aus gleich seien. Diese Regel folgt für Hobbes aus der oben besprochenen Gleichheit der menschlichen Fähigkeiten. Was die Natur gleich gemacht hat, soll auch im Staat gleich sein. Die Verletzung dieses Gesetzes bezeichnet Hobbes als Stolz.
Ferner soll niemand bei einem Friedensschluß ein Recht für sich verlangen dürfen, das er dem anderen nicht zugestehen will. Außerdem sollen Streitsachen von einem unparteiischen Richter entschieden werden. Beide Gesetze werden wieder durch den Frieden in der Gemeinschaft gerechtfertigt.
Nach einigen Bestimmungen zur Besitzverteilung (...alles Unteilbare muß gemeinschaftlich genutzt werden) meint Hobbes, die natürlichen Gesetze würden gebieten, daß Friedensmittler sicher kommen und gehen dürfen. Wird gegen dieses Gesetz verstoßen, wird es wohl unmöglich, Frieden zu erreichen.
Den Urteilsspruch eines unparteiischen Richters muß man sich gefallen lassen, sagt ein weiteres natürliches Gesetz. Denn sonst hat der Streit zwischen zwei Parteien im Staat nie ein Ende und der Friede ist nicht gesichert. Der Richter muß natürlich, wie nochmals versichert wird, unparteiisch sein. Zeugenaussagen sollen ferner Streitereien über eine Sache entscheiden.
Fassen wir das bisher über Naturgesetze Gesagte nochmals zusammen. Es gibt zwei "wichtige" Naturgesetze, die unmittelbar vernünftig einleuchten müssen. Diese besagen im wesentlichen, daß man den Zustand des Krieges aller gegen alle beenden will, also nach Frieden streben muß (aus Gründen der Selbsterhaltung); nur, wenn keine Hoffnung darauf besteht, verteidigt man sich selbst mit allen Mitteln. Der Friede kann aber nur erreicht werden, wenn jeder einzelne auf sein Recht auf alles, seine absolute Freiheit sozusagen, verzichtet. Ein jeder soll also mithilfe eines Vertrages die meisten seiner Rechte auf eine Obrigkeit übertragen, unter der Voraussetzung, daß alle anderen es auch tun. Nur, wenn alle dies tun, kann der Krieg aller gegen alle beendet und Frieden erreicht werden. Letztere Einsicht ist gemäß dem Sprichwort: "Was du nicht willst, das dir geschehe, tue andern auch nicht".
Neben diesen zwei wichtigen Naturgesetzen gibt es noch neunzehn weniger wichtige, die allesamt einzig die Aufgabe haben, den Frieden innerhalb des Staates zu sichern.
Die sogenannten Naturgesetze gibt es nach Hobbes theoretisch schon im Naturzustand; dies darum, weil sie aufgrund ihrer Vernünftigkeit jedem Menschen einleuchten. Ihr Gewissen (forum internum) würde sie immer akzeptieren. Allein, im Naturzustand ist keine staatliche Macht vorhanden, die die Einhaltung der Gesetze überwacht; es gibt keinen strafenden Gerichtshof (forum externum). Darum besteht aber keine Garantie, daß die Gesetze eingehalten werden, denn die Vernunft allein ist zu schwach, um dies zu gewährleisten - der Mensch ist für Hobbes ja ein Triebwesen. Der aber würde seiner Selbsterhaltung zuwiderhandeln, der sich dann an die Gesetze hält, wenn es die anderen nicht tun. Nur, wenn die anderen auf ihr Naturrecht verzichten und die vernünftigen, natürlichen Gesetze akzeptieren, kann der Krieg aller gegen alle überwunden werden.
Für Thomas Hobbes ist die Kenntnis der Naturgesetze die "wahre Sittenlehre". Seine Philosophie sieht er als Garanten für den Frieden im Staat und für die Vermeidung des Bürgerkrieges.
Der Gesellschaftsvertrag und der Leviathan
Was ist nun der Antrieb dafür, daß der Naturzustand und der Krieg aller gegen alle überwunden wird, die Menschen ihr Recht aller auf alles abgeben und die Gültigkeit der Naturgesetze anerkennen? Was bewegt sie dazu, ihre absolute Freiheit und ihr Machtstreben aufzugeben, welcher Antrieb verhilft der schwachen Vernunft zum Sieg? Oben wurde es schon angedeutet: Die absolute Freiheit eines jeden führt zum Krieg aller gegen alle, dieser ist ein elender Zustand, der ständig drohende, gewaltige Gefahren und daher die Furcht mit sich bringt. Die Menschen erkennen bald, daß es ihrer Selbsterhaltung, die ihnen hauptsächlich am Herzen liegt, förderlicher ist, ihr Recht auf alles aufzugeben (vorausgesetzt, die anderen tun es auch), den Krieg aller gegen alle zu beenden und künftig in Frieden zu leben unter Anerkennung der Naturgesetze. Sie sehen auch ein, daß deren Einhalt nur von einem starken Staat garantiert werden kann, an den sie ihre Rechte gemeinsam übertragen.
Das geht u.a. auch aus folgendem Zitat hervor:
"Die Absicht und Ursache, warum Menschen bei all ihrem natürlichen Hang zu Freiheit und Herrschaft sich dennoch entschließen konnten, sich gewissen Anordnungen, welche die bürgerliche Gemeinschaft trifft, zu unterwerfen, lag in dem Verlangen, sich selbst zu erhalten und ein bequemeres Leben zu führen; oder mit anderen Worten, aus dem elenden Zustand des Krieges aller gegen alle gerettet zu werden. Dieser Zustand ist aber notwendig wegen der menschlichen Leidenschaft mit der natürlichen Freiheit so lange verbunden, als keine Gewalt da ist, welche die Leidenschaften durch Furcht vor Strafe gehörig einschränken kann und auf die Haltung der natürlichen Gesetze und Verträge dringt."
An dieser Stelle in Hobbes' Gedankengebäude schließen die Menschen den Gesellschaftsvertrag. Dieser Gedanke war der wahrscheinlich weitreichendste von Thomas Hobbes; historisch neu ist an der Konzeption des Gesellschaftsvertrages, daß die Legitimation der Macht nicht mehr (wie im Mittelalter) von Gottes Gnaden oder ähnlichem abgeleitet wird, sondern von den Menschen.
Hobbes schreibt über den Gesellschaftsvertrag:
"Um aber eine allgemeine Macht zu gründen, unter deren Schutz gegen auswärtige und innere Feinde die Menschen bei dem ruhigen Genuß der Früchte ihres Fleißes und der Erde ihren Unterhalt finden können, ist der einzig mögliche Weg folgender: jeder muß alle seine Macht oder Kraft einem oder mehreren Menschen übertragen, wodurch der Willen aller gleichsam auf einen Punkt vereinigt wird, so daß dieser eine Mensch oder diese eine Gesellschaft eines jeden einzelnen Stellvertreter werde und ein jeder die Handlungen jener so betrachte, als habe er sie selbst getan, weil sie sich dem Willen und Urteil jener freiwillig unterworfen haben."
Und darauf folgt die berühmte Stelle (Leviathan, Kap.17):
"Dies faßt aber noch etwas mehr in sich als Übereinstimmung und Eintracht; denn es ist eine wahre Vereinigung in einer Person und beruht auf dem Vertrage eines jeden mit einem jeden, wie wenn ein jeder zu einem jeden sagte: 'Ich übergebe mein Recht, mich selbst zu beherrschen, diesem Menschen oder dieser Gesellschaft unter der Bedingung, daß du ebenfalls dein Recht, über dich ihm oder ihr abtrittst'."
Der Gedankengang ist klar: Im Gesellschaftsvertrag übertragen alle Menschen ihr Recht, sich selbst zu beherrschen auf eine Person oder Gesellschaft. Letztere Feststellung ist sehr interessant. Nach Hobbes' Meinung könnte es - theoretisch - also auch ein Parlament sein, dem die höchste Gewalt im Staat übertragen wird. In der Praxis aber, das geht aus Hobbes' weiterem Werk hervor, ist er mit einem Parlament weniger glücklich; sein Ideal wäre eher ein absolutistischer Monarch, da jener den inneren Frieden besser behaupten könnte als ein Parlament, in dem ja wieder allein aufgrund der Vielheit der Entscheidungsträger der Unfriede weitergepflogen wird.
Durch die kollektive Übertragung der Macht auf eine Obrigkeit entsteht eine Gewalt, die stark genug ist, die Naturgesetze zu garantieren. Der Friede ist gesichert, Recht und Ordnung werden durch Autorität gewährleistet.
Der Gesellschaftsvertrag schafft den Staat. Hobbes' Definition des Staates erhellt sich aus dem bisher Gesagten.
"Staat ist eine Person, deren Handlungen eine große Menge Menschenkraft der gegenseitigen Verträge eines jeden mit einem jeden als ihre eigenen ansehen, auf daß diese nach ihrem Gutdünken die Macht aller zum Frieden und zur gemeinschaftlichen Verteidigung anwende."
Diesen autoritären Machtstaat will Hobbes im Leviathan, einem drachenähnlichen, biblischen Ungeheuer aus dem Buch Hiob wiedererkannt haben. Diesen Leviathan personifiziert das berühmte Titelbild von Hobbes' Werk mit einem gewaltigen, gekrönten Riesen, der aus vielen einzelnen Menschen zusammengesetzt ist. Dieser Staat wurde durch den Gesellschaftsvertrag geboren; er ist somit eine "künstliche Macht". Einem Staat kommt gottähnliche Macht auf Erden zu, so stark ist er; da er aber theoretisch in den Bürgerkrieg zurückfallen kann, nennt Hobbes den Leviathan aber den "sterblichen Gott". Erschaffen aus dem Gemeinschaftswillen um den Frieden und die Gesetze durch seine selbstherrliche Macht zu gewährleisten, thront der Leviathan über den Sterblichen.
"So entsteht der große Leviathan, der sterbliche Gott, dem wir unter dem ewigen Gott allein Frieden und Schutz zu verdanken haben. Dieses von allen und jedem übertragene Recht bringt eine so große Macht hervor, daß durch sie die Gemüter aller zum Frieden unter sich geneigt gemacht und zur Verbindung gegen auswärtige Feinde leicht bewogen werden."
Die Entscheidung im Naturzustand als Gefangenendilemma
Man kann für das Verständnis von Hobbes’ eben dargestellter Argumentation einiges gewinnen, wenn man sich das Modell des "Gefangenendilemmas" (prisoner’s dilemma) vor Augen führt.
"Eine Interaktionssituation vom Typ des Gefangenendilemmas ist dadurch charakterisiert, daß je individuell optimierende Strategien zu einem Ergebnis führen, das alle Beteiligten schlechterstellt als ein anderes, das durch nicht-optimierende individuelle Strategien erreicht worden wäre."
Oder, um es mit anderen, einfacheren Worten zu sagen: Es handelt sich um eine Situation, in der die Beteiligten zwischen einer egoistischen Handlungsweise und einem Verzicht auf eine solche wählen können. Das egoistische Verhalten ist erfolgreich, außer alle wählen es - in diesem Fall stehen nachher alle relativ schlecht da. Insoferne wäre es (langfristig gedacht) für alle Beteiligten die bessere Strategie, sich kollektiv nicht-egoistisch zu verhalten. Dies sollte man also auch selbst tun. Verhält man sich aber selbst auf diese Art altruistisch, die anderen aber doch nicht, so steht man selbst unverhältnismäßig schlecht da, während die anderen gewinnen. Eine egoistische Strategie wäre dann klüger gewesen. Wie man sich selbst verhält, hängt also von der eigenen Einschätzung des Verhaltens der anderen ab und umgekehrt.
Graphisch läßt sich das Gefangenendilemma wie folgt darstellen.
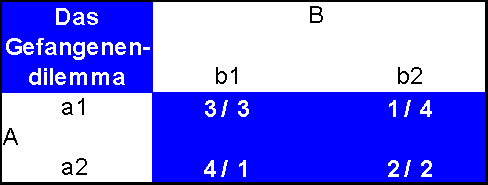
Die Großbuchstaben bezeichnen die "Spieler", die kleinen Buchstaben die ihnen jeweils zugeordneten beiden möglichen Entscheidungen. Die Zahlen bezeichnen die gewonnenen "Punkte", wobei die Zahl vor dem Schrägstrich die Punkte von A, die Zahl dahinter die Punkte von B bei der jeweiligen Entscheidungskombination darstellt. Die Kombination a1 / b1 bringt für beide Spieler eine gute Punktezahl, die Kombination a2 / b2 eine weniger gute; beide schneiden allerdings gleich ab. Bei der Kombination a2 / b1 und a1 / b2 erhält jeweils einer der beiden Spieler eine extrem hohe, der andere eine extrem niedrige Punktezahl.
Mit konkreteren Bezeichnungen ließe sich das Gefangendilemma also z.B. folgendermaßen darstellen (wobei A und B beliebige Personen in einer konkreten Situation darstellen):
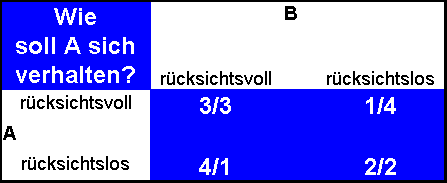
Wenn sich A in diesem Modell rücksichtsvoll verhält und B auch, ist es für jeden gut. Wenn sich A aber auf Bs Kosten rücksichtslos verhält, gewinnt er massiv auf Kosten des anderen. Verhalten sich aber beide rücksichtslos, ergibt sich für beide auch nur ein niedriger Gewinn. Ist A aber als einziger rücksichtsvoll, während B rücksichtslos ist, profitiert B, während A verliert.
Übertragen auf den Hobbes’schen Naturzustand könnte man folgende Tabelle entwerfen - wobei man A am besten als beliebige Einzelperson, B als "die anderen" interpretiert:
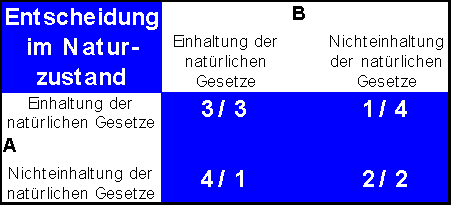
Die natürlichen Gesetze, die nach Hobbes durch die Vernunft einsichtig sind, könnten einen Grundstock der Moral liefern - würden sie nur eingehalten. Dienen sie den anderen Menschen allerdings nicht als Grundlage ihres Handelns, ist es für die Einzelperson klüger, sie auch nicht einzuhalten, wobei dann allerdings alle Schaden davontragen, weil der Naturzustand mit seinen Schrecken andauert. Hobbes’ Individuen im Naturzustand streben nach der Verwirklichung eines Friedenszustandes, in dem die natürlichen Gesetze gelten. Um diesen zu erreichen, müßten alle Individuen ihr Naturrecht auf eine staatliche Zentralgewalt übertragen, die die Einhaltung des gesellschaftlichen Friedens überwacht. Der Akt der Übertragung des Naturrechts auf einen Souverän ist auch als Gefangenendilemma darstellbar.
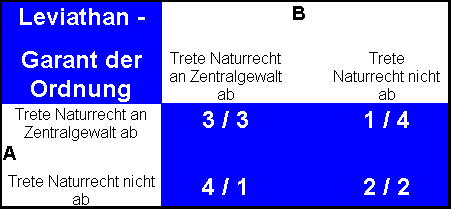
Eine Abtretung des eigenen "Rechts auf alles" macht für jede Einzelperson nur dann Sinn, wenn es alle tun, sonst würde sie stark verlieren, durch eine allgemeine Abtretung gewinnen alle. Ansonsten bleibt der Naturzustand für alle bestehen.
Der Vorbehalt des Gesellschaftsvertrags, die Abtretung nur unter der Bedingung durchzuführen, wenn es die anderen auch tun, macht daher im Lichte des Gefangenendilemmas Sinn. Ebenso die Formulierung des zweiten natürlichen Gesetzes: "Sobald seine Ruhe und Selbsterhaltung gesichert ist, muß auch jeder von seinem Recht auf alles - vorausgesetzt, daß andere auch dazu bereit sind - abgehen und mit der Freiheit zufrieden sein, die er den übrigen eingeräumt wissen will."
Der Vorteil der Darstellung der Entscheidung für den Gesellschaftsvertrag als Gefangenendilemma ist auch, daß dadurch ersichtlich wird, daß sich die Menschen im Naturzustand nicht unbedingt aus moralischen Gründen für den Abschluß des Gesellschaftsvertrags und die Einhaltung gewisser moralischer Grundnormen entscheiden, sondern um ihr Eigeninteresse zu optimieren. Die moralische Ordnung der Gesellschaft entsteht für Hobbes also letztlich aus dem langfristig gedachten Egoismus der Einzelpersonen, wobei eine allmächtige Zentralgewalt durch Sanktionen verhindern muß, daß die Menschen nicht wieder in ihre kurzsichtigen Strategien der Nutzenmaximierung verfallen.
2. Machiavelli als Vorläufer von Hobbes
Inwieweit Machiavelli kein Vorläufer von Hobbes ist
Wie oben ausgeführt, ging es Hobbes um die theoretische Begründung politischer Macht. Wie wird sie gerechtfertigt? Was ist ihre Aufgabe? Warum darf es so etwas wie Herrschaft geben? Dies sind Fragen, die Hobbes brennend interessieren. Machiavellis politisches Denken allerdings verfolgt andere Ziele als die Legitimation von Macht, worauf auch schon Kersting hinweist:
"Machiavelli hat jedoch keine legitimationstheoretische Argumentation im Sinn. Man muß sich daher hüten, dem politischen Denken des Florentiners die methodologischen und theoretischen Formen neuzeitlicher Staatsphilosophie überzustülpen und das staatsphilosophische Erkenntnisprogramm des 17. und 18.Jahrhunderts auf seine politische Programmatik zu projizieren. Staatsdeduktion, um mit Fichte zu sprechen, ist nicht Machiavellis Sache."
Machiavelli will also in erster Linie praktische Handlungsanweisungen für Politiker abgeben. Seine Methode entspricht auch nicht der streng geometrischen des Thomas Hobbes, der aus Axiomen mit logischer Stringenz Schlußfolgerungen ableitet. Machiavelli arbeitet anders: Bildhaft, rhetorisch, unter Verwendung historischer Analogien aus der Römerzeit und eigener, unsystematischer Beobachtungen.
Machiavelli ist von Hobbes also insoferne grundverschieden, weil seine Intention sich von Hobbes unterscheidet (praktische Handlungsanweisung versus Legitimationstheorie) und auch die Methode des Forschens eine andere ist (Rhetorik versus geometrische Methode).
Inwieweit Machiavelli doch ein Vorläufer von Hobbes ist
Trotz all dieser Einschränkungen muß darauf hingewiesen werden, daß die Parallelen zwischen Hobbes und Machiavelli so verblüffend sind, daß Gemeinsamkeiten sofort ins Auge fallen. Diese Gemeinsamkeiten sind im Bereich der Grundannahmen über Politik ebenso zu finden wie in den Endergebnissen ihres Denkens. Und das betrifft auch die Frage nach dem Daseinszweck des Staates. Obwohl Machiavelli, wie oben festgestellt, nicht die Absicht hatte, eine Legitimationstheorie zu entwerfen, streifen seine Schriften doch an Überlegungen, die sehr im Keim solche zu enthalten scheinen. Ich möchte an Gemeinsamkeiten von Hobbes’ und Machiavellis Denken folgende nennen:
Negatives Menschenbild und Primat des Eigeninteresses
Ausgangspunkt vieler Gedankengänge in den politischen Schriften beider Denker ist die Annahme der Schlechtigkeit der Menschen, die beide für eine ausgemachte Sache halten. Politische Theorien, die davon ausgehen, daß der Mensch gut ist, würden wahrscheinlich beide als naiv verlachen. In beiden Konzepten dient das negative Menschenbild als Faktor, mit dem zu rechnen ist - bei Hobbes muß die Grundstruktur des Staates diesem angemessen sein bzw. sich aus diesem ableiten, bei Machiavelli müssen die Handlungen des klugen Politikers dieses angemessen berücksichtigen.
Über das negative Menschenbild bei Hobbes ist oben näher geschrieben worden. Um das von Machiavelli zu illustrieren, reicht ein Zitat:
"Denn man kann von den Menschen im allgemeinen sagen, daß sie undankbar, wankelmütig, unaufrichtig, heuchlerisch, furchtsam und habgierig sind; und solange du ihnen Gutes erweist, sind sie dir völlig ergeben; sie bieten dir ihr Blut, ihre Habe, ihr Leben und ihre Kinder, wenn - wie ich oben gesagt habe - die Not fern ist; kommt diese dir aber näher, so begehren sie auf.
Ein Fürst, der sich völlig auf ihre Versprechungen verlassen hat, ohne andere Vorbereitungen zu treffen, ist dann verloren; denn Freundschaften, die man durch Geld und nicht durch Großmut und Seelenadel erwirbt, hat man zwar bezahlt, aber man besitzt sie nicht und kann sie in Zeiten der Not nicht in Anspruch nehmen; denn die Liebe wird durch das Band der Dankbarkeit aufrechterhalten, das, weil die Menschen schlecht sind, von ihnen bei jeder Gelegenheit des eigenen Vorteils wegen zerrissen wird; die Furcht aber wird durch die Angst vor Strafe aufrechterhalten, welche dich niemals verläßt."
Wie bei Hobbes dient bei Machiavelli die Furcht vor Strafe durch eine Autorität als Schutzwall gegen Bosheit, Abtrünnigkeit und Eigennutz der Menschen. Der Unterschied ist lediglich, daß Machiavelli dem Fürsten aus pragmatischer Hinsicht zum Einsatz der Strafe rät; der pragmatische Zweck ist die Aufrechterhaltung seiner Macht.
Für Hobbes liegt in der Schaffung eines Bollwerks gegen die menschliche Schlechtigkeit gerade Sinn und Daseinszweck des Staates, mithin sein Legitimationsgrund. Für Machiavelli ist eigentlich auch ausgemacht, was Hobbes in einer berühmten Formulierung aussprach, daß nämlich die Macht und nicht die Wahrheit Gesetze schafft und Autorität begründet.
Die Ablehnung der mittelalterlichen Legitimationstheorien
Wie sehr Hobbes den "summus philosophus" der Scholastik (Aristoteles) bekämpft, wurde bereits oben ausgeführt. Die mittelalterlichen Legitimationstheorien hält er verantwortlich für das Nicht-Funktionieren staatlicher Ordnung zu seiner Zeit und damit für das Ausbrechen von Bürgerkriegen. In Wahrheit waren es die Umbrüche seiner Zeit, die den alten Systemen tatsächlich vieles von ihrer Verbindlichkeit und Überzeugungskraft nahmen.
Wie Machiavellis Schriften war Hobbes’ politische Philosophie eine Antwort auf die Krise seiner Zeit, in der Glaubensspaltung und das Zusammenbrechen alter Ordungen längst zur Realität geworden waren. Seine Theorien sind ein Versuch, die Krise der frühen Neuzeit zu überwinden.
Das hatte er auch mit Machiavelli gemeinsam, der ebenfalls in einer Zeit der Krise erkannte, wie unzureichend die alten, mittelalterlichen Theorien zur Erklärung und Begründung von Politik geworden waren. Machiavelli löst sich fast vollständig von mittelalterlichen Legitimationstheorien mit ihrem christlich-metaphysischen Überbau. Unter Rückgriff auf die Antike wird politisches Denken von ihm säkularisiert. Weder bei Hobbes, noch bei Machiavelli ist Gott der Ausgangspunkt der politischen Ordnung, sondern die Interaktion von Menschen - wobei Machiavelli der Gedanke eines Gesellschaftsvertrags freilich noch fern lag. Machiavelli hatte sich wie Hobbes von den Fesseln mittelalterlicher Staatsbegründungen befreit, war aber noch nicht in der Lage, eine neue Legitimation von Politik zu geben, obwohl er bei der Beschreibung politischer Praxis sich manchmal daran annähert.
Auf jeden Fall löst Machiavelli Politik aus ihrem theologischen Begründungszusammenhang, wie ich bereits an anderer Stelle ausführte (siehe Kap. Machiavelli und die Religion). Im Prinzip beinhaltet Hobbes’ Werk eine Fortführung dieser Tendenz der Säkularisierung der Politikbetrachtung.
Der Staat als Beschützer seiner Bürger
Der Fürst in Machiavellis Werk darf sich nicht alles gegenüber seinen Bürgern erlauben. Vielmehr ist er dazu angehalten - wohl aus rein pragmatischen, nicht so sehr aus moralischen Gründen - das Leben und Eigentum der Bürger zu schützen, d.h. sich auch selbst nicht daran zu vergreifen. Auch die Tugend der Frauen hat er zu respektieren. Tut er dies nicht, macht er sich verhaßt und die Wahrscheinlichkeit, daß er stürzt, steigt.
"Gleichwohl darf ein Fürst nur so viel Furcht verbreiten, daß er, wenn er dadurch schon keine Liebe gewinnt, doch keinen Haß auf sich zieht; denn er kann sehr wohl gefürchtet werden, ohne verhaßt zu sein; dies wird ihm stets gelingen, wenn er das Eigentum seiner Bürger und Untertanen sowie ihre Frauen respektiert. Und wäre er auch gezwungen, einen hinrichten zu lassen, so tue er dies, wenn dafür eine entsprechende Rechtfertigung und ein offensichtlicher Grund bestehen; vor allem aber muß er das Eigentum anderer achten; denn die Menschen vergessen schneller den Tod ihres Vaters als den Verlust ihres Erbes."
"Verhaßt macht er (der Fürst) sich vor allem, wenn er - wie ich gesagt habe - raubgierig und gewalttätig nach der Habe und den Frauen seiner Untertanen trachtet; davon muß er sich fernhalten; solange man nämlich die Mehrheit der Menschen nicht um ihren Besitz und ihre Ehre bringt, leben sie zufrieden; man hat dann nur mit dem Ehrgeiz einiger weniger zu kämpfen, der sich auf vielerlei Weise und mit Leichtigkeit zügeln läßt."
Machiavelli gibt ferner den Fürsten eine ganz erstaunliche Handlungsanweisung, nämlich die, dem Bürger eine gewisse Rechtssicherheit zu gewähren - ein Beweis mehr, daß Machiavellis Staatsräson etwas anderes ist als schrankenloser Despotismus.
"Ferner muß ein Fürst sich als Freund der Tüchtigkeit zeigen, indem er tüchtige Männer fördert und die Hervorragenden jedes Faches ehrt. Außerdem muß er seine Bürger ermutigen, ruhig ihrer Beschäftigung nachzugehen im Handel, in der Landwirtschaft und bei jeder anderen Tätigkeit, damit der eine sich nicht scheut, sein Landgut zu verschönern, aus Furcht, es könnte ihm weggenommen werden, und der andere nicht fürchtet, einen Handel aufzumachen, aus Angst vor Steuern; er muß vielmehr Belohnungen aussetzen für diejenigen, die solches tun wollen und für jeden, der irgendwie darauf sinnt, den Wohlstand seiner Stadt oder seines Landes zu mehren."
Man sieht also, daß nach Machiavelli ein Fürst mehr als klug handelt, wenn er bestimmte Rechte des Bürgers schützt. Er tut gut daran, politische Stabilität und damit Sicherheit zu garantieren; jedes andere Verhalten würde sein Gemeinwesen zugrunde richten. Die Gemeinsamkeit zu Hobbes’ Argumentation ist im Prinzip folgende: Bei beiden tritt die Obrigkeit auf als Garant der Stabilität und Sicherheit der Bürger. Die staatliche Macht soll dafür sorgen, daß ein jeder friedlich seinen Geschäften nachgehen kann und ein gewisses Maß an Schutz genießt. Im Unterschied zu Hobbes ist für Machiavelli ein solches Verhalten der Obrigkeit aber vor allem aus pragmatischen Gründen ratsam. Nur, wenn man so vorgeht, macht man sich nicht verhaßt; nur, wenn man so vorgeht, kann man sein Gemeinwesen zur Blüte bringen. Hobbes geht einen Schritt weiter und verwandelt genau dies in eine Rechtfertigung eines politischen Systems. Der Staat findet nun seinen Legitimationsgrund und seine Existenzberechtigung in dem Schutz, dem er dem Bürger gibt. Dieser ist wiederum aufgrund dieses Schutzes zum Gehorsam verpflichtet. Die Ergebnisse der Hobbes’schen und der Machiavelli’schen Betrachtung sind ähnlich; nur was Machiavelli aus machtpolitischem Kalkül heraus gewinnt, verwandelt Hobbes in eine Legitimationstheorie. Der Schritt zwischen beidem ist klein.
Politische Ordnung als Antwort auf die Krise
Wie sehr Thomas Hobbes’ "Leviathan" einen Ausweg aus dem Chaos des Naturzustands darstellt, habe ich bereits oben ausgeführt.
Auch Machiavelli rechnet mit der Krise. Zwar sind seine Gedanken dazu nicht so entwickelt wie von Thomas Hobbes, die von ihm beobachtete Krise des Italien seiner Zeit ist aber allgegenwärtige Voraussetzung seiner politischen Konzeptionen. Die schreckliche Krise, in der sich Italien befand, sah Machiavelli als Chance für einen konstruktiven Neuanfang, als Chance für die Schaffung einer neuen politischen Ordnung, die Stabilität bringt gegenüber der wechselvollen Schläge Fortunas.
"...; so mußte auch gegenwärtig Italien in das Endstadium geraten, in dem es sich zur Zeit befindet, um die Tüchtigkeit eines bedeutenden Italieners zur Geltung zu bringen: es mußte unterdrückter als die Juden werden, geknechteter als die Perser, zerrissener als die Athener; ohne Führer, ohne gesetzliche Ordnung, geschlagen, geplündert, zerfleischt und von Feinden überrannt, hatte es jede Art der Vernichtung zu erleiden. (...) Solcherart, gleichsam leblos geworden, erwartet Italien den, der imstande wäre, seine Wunden zu heilen, den Plünderungen der Lombardei, der Ausbeutung des Königreichs Neapel und der Toskana ein Ende zu setzen und es von seinen seit langer Zeit brennenden Wunden genesen zu lassen."
Man sieht an solchen und ähnlichen Beschreibungen, die sehr an Hobbes’ Naturzustand erinnern, wie ähnlich Machiavellis Denken zu dem von Thomas Hobbes ist, zumal es wie dieses aus der Krise entspringt.
Herfried Münkler meint entsprechend über diese Parallelen, daß Machiavellis großer Plan der politischen Einigung Italiens unter Berufung auf das historische Vorbild des alten Roms auf der inneren Destabilisierung und äußeren Schwächung der italienischen Teilstaaten beruht, die diese Einigung bislang verhindert hatten, auf dem Zerfall der alten politischen Loyalitäten und der daraus erwachsenden Chance, neue Loyalitäten aufzubauen. Machiavelli nach Münkler hat die Krise der italienischen Teilstaaten als Gelegenheit für den politischen Aufstieg Italiens begriffen und gedrängt, sie zu nützen.
Machiavellis politische Theorie - und das bezeichnet einen der zahlreichen Brüche mit dem politischen Denken des Mittelalters - geht auch nicht von einer gegebenen Ordnung aus, die es zu bewahren und zu verteidigen gilt, sondern macht das Ordnungsdefizit, die Krise, den politischen Notstand zur Grundlage seiner Überlegungen. Ordnung ist für Machiavelli nichts Vorgefundenes, sondern etwas Herzustellendes, etwas, das dem Chaos der einander widerstreitenden Interessen und Leidenschaften der Menschen abzuringen ist. Die Härte in Machiavellis politischen Handlungsanweisungen, seine Rechtfertigung des Wortbruchs und der Gewalt gründen nach Münkler nicht zuletzt in diesem Wechsel des systematischen Ausgangspunkts politischer Theorienbildung. Und er führt weiter aus, daß aus der Erfahrung völliger Unordnung, zumal in Perioden des Bürgerkriegs die Sehnsucht nach einer neuen, starken Ordnung erwächst. Diese Ordnung ist der Staat, der als Machtstaat Ruhe, Ordnung, Frieden, Besitz und Sicherheit des Lebens gewährleisten soll. Doch diese Ordnung bleibt immer wieder gefährdet durch Rückfälle in die Instabilität. Bei Machiavelli wird die politische Norm formuliert in Kenntnis ihrer Gefährdung und Durchbrechung: Notstand und Ausnahme sind bei ihm zu den zentralen Bezugspunkten des politischen Denkens geworden. Im Leviathan hat Thomas Hobbes diese von Machiavelli eingeleitete theoretische Wende systematisch vollendet.

Teil II
Machiavellis Hauptwerke:
Discorsi und Fürst
Machiavellis Discorsi
1. Zur Rezeptionsgeschichte
Wie schon mehrfach angeführt, unterscheidet Niccolò Machiavelli zwischen zwei Staatsformen: den Fürstenherrschaften einerseits, in denen ein einzelner Machthaber herrscht, und den Republiken andererseits, in denen alle Staatsbürger an der Herrschaft beteiligt werden. Und so schrieb er auch je ein Buch zu den beiden Staatsformen: Der "Fürst" handelt von der Monarchie, die "Discorsi" handeln von der Republik.
Die Rezeptionsgeschichte von Machiavellis Werk verlief leider sehr unausgewogen. So ist den meisten Gebildeten nur der "Fürst" bekannt, die "Discorsi" kennt kaum jemand. Dieser Umstand ist aus drei Gründen bedauerlich:
Erstens sind die "Discorsi" das bessere Buch. Der "Fürst" ist knapper, mitreißender, voller provokanter Formulierungen - was alles sehr reizvoll ist. Aber er provoziert vielleicht auch deshalb mehr Mißverständnisse. Die "Discorsi" sind umfangreicher, ausführlicher. Machiavelli erklärt mehr, geht in die Tiefe, behandelt zahlreichere Facetten der Politik. Er beschäftigt sich dort "mit den meisten Problemen der inneren und äußeren Politik, der Staatsführung, der Verfassung und Verwaltung, der Volkswirtschaft, Kolonialpolitik und Kriegsführung."
Da zweitens heute in der westlichen Welt die Republik die am häufigsten anzutreffende Staatsform ist, kann man die "Discorsi" auch als durchwegs aktueller bezeichnen. Der Rat an den Fürsten, seinen Statthalter in Stücke zu hauen, nachdem dieser die Drecksarbeit für ihn erledigt hat, wird für einen Monarchen oder Diktator für den Machterhalt - auch in Zukunft - wichtig und durchführbar bleiben, aber was bitte sollen der amerikanische Präsident oder der österreichische Bundeskanzler mit diesem Tip anfangen, wo sie eine solche Tat aufgrund unseres Rechtsstaats nicht ausführen könnten? Hinweise Machiavellis aber, wie man z.B. in einer Republik einem aufsteigenden Demagogen das Handwerk legt, der im Begriff ist, das ganze Volk zu verführen, sind in der heutigen Zeit sicherlich besser anwendbar.
Drittens führte die ausschließliche Kenntnis des "Fürsten" zu einer einseitigen Sichtweise Machiavellis. Er erscheint dann der Nachwelt als bloßer Lobredner der Tyrannis. Nun hat Machiavelli im "Fürsten" den Machthabern tatsächlich möglichst unvoreingenommen Ratschläge zu Machtgewinn und Machterhalt erteilt. In den "Discorsi" enthüllt er aber seine eigentliche Gesinnung: Er ist überzeugter Republikaner und hält die Autokratie für eine verwerfliche und außerdem unkluge Staatsform. Machiavelli war kein Machiavellist.
2. Der Einfluß des Titus Livius
Die "Discorsi" beziehen sich stark auf das Geschichtswerk des Titus Livius.
Titus Livius wurde 59 v.Chr. in Padua geboren; in römischer Zeit war dies eine der reichsten und mächtigsten Städte Italiens. Die Sittenstrenge ihrer Bewohner, die durchwegs republikanisch gesinnt waren, haben ihn entscheidend geprägt. Seine Kindheit fällt in die Zeit, als Caesar Gallien eroberte. Auf den Heranwachsenden hinterließen der 49 v.Chr. ausbrechende Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius, Caesars Diktatur und seine Ermordung in den Iden des März 44 einen prägenden Eindruck. Daraufhin brachen wieder Bürgerkriege aus. Livius zog wahrscheinlich in den 30er Jahren nach Rom. Livius begegnete dem Putschisten und Diktator Caesar mit großer Skepsis. Pompeius hingegen soll er bewundert haben. Noch Augustus nannte ihn spaßenshalber einen Pompeianer.
Da Livius aus einer begüterten Familie stammte, konnte er sich ganz dem geistigen Leben widmen. Als Augustus die Macht übernahm, arbeitete Livius an einer römischen Geschichte "ab urbe condita", also von der Stadtgründung bis zur damaligen Gegenwart. Uns sind (und Machiavelli waren damals auch) nur die ersten zehn der ursprünglich 142 (!) Bücher erhalten. In diesen werden die Anfänge Roms behandelt. Das Geschichtsbild des Titus Livius orientiert sich u.a. an Sallust. Er bemüht sich, vor allem die reine, republikanische Gesinnung der Vorfahren herauszuarbeiten, die den Römern seiner Zeit verloren gegangen war. Er versucht schillernde Beispiele der alten, republikanischen Tatkraft, die Rom groß gemacht hat, wieder vor die Augen seiner Zeitgenossen zu führen. Diese sollten erneut für die alte Tüchtigkeit begeistert werden, die ihnen mittlerweile abhanden gekommen war; die glorreiche Vergangenheit sollte neu belebt werden.
Kaiser Augustus, der im Sinne seiner konservativen Politik die res publica zu erneuern gedachte, kam dieses Geschichtswerk recht; er förderte Livius nach Kräften und ehrte ihn durch persönlichen Umgang. Livius konnte aufgrund seiner Kontakte zur kaiserlichen Familie auch den jungen Claudius (den späteren Kaiser) zur Geschichtsschreibung ermuntern. Livius war schon zu Lebzeiten berühmt; wir wissen von einem Mann aus der spanischen Stadt Gades, der nach Rom reiste, nur um Livius zu sehen; als er sein Ziel erreicht hatte, kehrte er sogleich wieder um. Livius starb 17 n.Chr. in Padua.
Machiavelli hat aber mit den "Discorsi" nicht einfach einen "bloßen" Kommentar zum Werk des Livius geschrieben. Die römische Geschichte "ist vielmehr der Stoff, an dem sich das politische Ingenium Machiavellis entzündet, und zugleich das Mittel, um seine Gedanken, Erkenntnisse, Thesen, die ihm zum guten Teil auch die eigene Erfahrung eingab, seinen Zeitgenossen in einer ihrem Bildungsstand angemessenen Weise verständlich zu machen."
Gleichwohl übernahm Machiavelli vieles von Livius. Wie ihm erschien Machiavelli die römische Kaiserzeit als Zeit des Verfalls, nicht als einzigartige Blüte, wie augusteische Propaganda dies beschwor. Und er entwickelt seinen Republik-Begriff anhand des historischen Vorbilds der römischen Republik.
3. Machiavellis Republikbegriff
Die starke Republik
Bei einem Vorbild wie der römischen Republik ist es nicht verwunderlich, daß Machiavelli in seinen "Discorsi" keineswegs den Begriff eines pazifistischen, schwachen, braven, jedem Krieg und jeder Machtpolitik abgeneigten Staates entwickelt (das wäre nämlich der heute in Europa vorherrschende Demokratiebegriff), sondern daß Machiavellis Republik selbstbewußt ihre Interessen durchsetzt und unter Umständen auch Eroberungen durchführt.
Von dieser Grundhaltung zeugen viele Zitate aus den Discorsi. Er meint zum Beispiel in einer Kapitelüberschrift, daß die unmittelbare Aufeinanderfolge zweier tüchtiger Staatsführer große Erfolge hervorbringt. In gut geordneten Freistaaten würden daher immer tüchtige Männer einander in der Macht nachfolgen; "deshalb machen solche Staaten große Eroberungen und wachsen zu mächtigen Reichen an." Wenn das kein imperialistisches Programm für eine Republik ist...
An einer anderen Stelle meint Machiavelli, daß ein Staat mit einer freien Verfassung hat zwei Ziele hat: das eine ist, neues Land zu erobern, das andere, seine Freiheit zu erhalten. Er gibt in den Discorsi Ratschläge zu beidem; doch darauf komme ich später zurück (siehe Kap. Vom Erhalt der republikanischen Freiheit und Von der Vergrößerung einer Republik).
Daß Machiavellis Republik sicher nicht pazifistisch ist, sieht man auch z.B. an einer Kapitelüberschrift, in der es heißt, daß der Machthaber oder der Freistaat, der nicht gerüstet ist, schärfsten Tadel verdient.
Dort schreibt er: "Die heutigen Machthaber und neueren Freistaaten, die zu ihrer Verteidigung und zum Angriff kein eigenes Heer haben, sollten sich vor sich selber schämen und nach dem Beispiel des Tullus bedenken, daß ein solcher Fehler nicht daher rührt, daß waffenfähige Männer fehlen, sondern daher, daß sie es aus eigenem Verschulden nicht verstanden haben, ihre Untertanen militärisch zu erziehen."
Man kann, meint Machiavelli im selben Kapitel, auch ein verweichlichtes Volk in kurzer Zeit zu guten Soldaten ausbilden; man muß es nur geschickt anstellen. Machiavelli hält es für notwendig, auch im Frieden die Kriegskunst nicht zu vernachlässigen. Wer nicht für den Krieg gerüstet ist, sei es materiell, militärisch oder philosophisch, wird sich seiner Meinung nach nicht lange auf dem oft brutalen Feld der Politik behaupten können.
Die Überlegenheit der Republik gegenüber der Autokratie
Machiavelli hält die Republik sowohl in Hinblick auf die Moral, als auch in Hinblick auf die Selbstbehauptung der Autokratie für überlegen.
Davon zeugt z.B. schon eine Kapitelüberschrift wie: "Das Volk ist weiser und beständiger als ein Alleinherrscher."
Dort schreibt er:
"Sowohl Livius als auch alle anderen Geschichtsschreiber behaupten, daß es nichts Eitleres und Unbeständigeres gebe als das Volk. (...Machiavelli sagt aber, daß er anderer Meinung ist...) Ich sage also: Dieser Fehler, den die Schriftsteller dem Volk zur Last legen, kann allen Menschen und besonders allen Machthabern zur Last gelegt werden. (...) Die Natur der Volksmassen ist daher nicht schlechter zu beurteilen als die eines Machthabers. Beide lassen sich in demselben Maß Verfehlungen zuschulden kommen, wenn sie es können, ohne die Gesetze fürchten zu müssen. Hierfür sprechen (...) viele Beispiele aus der Geschichte der römischen Kaiser und anderer Tyrannen und Alleinherrscher, bei denen man größere Unbeständigkeit und jäheren Wechsel in ihrem Verhalten beobachtet, als man je bei irgendeiner Volksmenge finden wird."
Das Volk ist also weniger oder zumindest nicht mehr der Unbeständigkeit und des Wankelmuts zu bezichtigen als der Alleinherrscher. Ferner trifft es nach Machiavelli bessere politische Urteile und Personalentscheidungen.
Kenner des "Fürsten" wird diese Stelle, in der das Volk und sein Urteil so hoch gelobt wird, auf den ersten Blick verwundern. Spricht Machiavelli im "Fürsten" doch verächtlich vom sogenannten "Pöbel". So schreibt er:
"Alle sehen, was du scheinst, aber nur wenige erfassen, was du bist; (...) und bei den Handlungen der Menschen, zumal bei den Fürsten, sieht man auf den Enderfolg. Laß nur einen Fürsten siegen und seine Herrschaft behaupten, so werden die Mittel dazu stets für ehrenvoll gehalten und von jedermann gelobt werden; denn der Pöbel läßt sich immer von dem Schein und dem Erfolg mitreißen;..."
Ist dies nicht ein Widerspruch zu vorhin? Einerseits redet Machiavelli in den "Discorsi" lobend vom Volk, andererseits kommt der "Pöbel" im "Fürsten" gar nicht gut weg. Der renommierte Machiavelli-Forscher Herfried Münkler würde sagen, daß nur scheinbar ein solcher Widerspruch entsteht. So meint er zu der oben zitierten Stelle aus dem "Fürsten":
"Aber was auf den ersten Blick wie eine verächtliche Bemerkung über die Kurzsichtigkeit des Pöbels aussieht, entpuppt sich aber bei genauem Hinsehen als dessen Gegenteil. Machiavelli nimmt zwar die offenbar verbreitete Vorstellung auf, der Pöbel halte es mit dem äußeren Schein und dem Erfolg, entkleidet sie jedoch ihrer sozialdenunziatorischen Pointe, indem er, ausgehend von dieser Charakterisierung, alle Menschen als Pöbel bezeichnet."
Und tatsächlich gibt es bei genauem Hinsehen noch einen Nachsatz zu der oben zitierten Stelle aus Kapitel XVIII des "Fürsten"; so schreibt er im selben Atemzug: "...; und auf der Welt gibt es nur Pöbel;..."
Der Adel steht also in keinster Weise über dem Volk; bei genauem Hinsehen ist diese Stelle also durchaus republikanisch.
Noch eine kleinere Bemerkung zum Urteil des Volkes bei Wahlen. Machiavelli entwickelt hier auch noch sehr interessante Gedanken in dem Kapitel: "Die Menschen mögen sich im ganzen täuschen, im einzelnen täuschen sie sich nie."
Dort schreibt er, daß das Volk zwar irrt, wenn es um ein abstraktes Prinzip gefragt wird, im konkreten Einzelfall ist sein Urteil aber fast unfehlbar. Als Beispiel führt er eine Wahl an, wie sie im alten Rom stattfand. Als Souverän konnte das römische Volk die höchsten und wichtigsten Ämter nach freier Wahl besetzen; die Plebejer waren im Volk bei weitem in der Mehrheit. Alle waren sich im Prinzip einig, daß man mehr Plebejer in hohe Ämter setzen sollte. Doch nun kam es zur Wahl, in der die einzelnen Posten besetzt werden sollten; um diese Ämter bewarben sich nun bestimmte Einzelpersonen, Patrizier wie auch Plebejer. Und nun zeigte sich die erstaunliche Tatsache, daß in jeder Wahl ein Patrizier gewann, sodaß schließlich wieder alle Posten an den Adel fielen. Im konkreten Vergleich hatte sich das Volk nämlich für die plebejischen Kandidaten geschämt, die hinsichtlich Auftreten, politischem Programm, Bildung und Fähigkeit den Patriziern einfach nicht gewachsen waren. Und während sich so alle prinzipiell einig waren, man solle nur oder hauptsächlich Plebejer wählen, wurden konkret nur Patrizier gewählt, trotz der überwältigenden plebejischen Mehrheit im Wahlvolk.
Machiavelli macht sich auch Gedanken über die moralische Qualität von Republiken und Alleinherrschaften; und er beschäftigt sich u.a. auch mit der Frage, wer eher Bündnisse und Verträge bricht, Republiken oder Alleinherrscher. Er kommt zu dem Ergebnis, daß unerfüllbare Verträge von niemandem eingehalten werden; auch in der höchsten Not, wenn der ganze Staat gefährdet ist, wählen sowohl Republiken als auch Alleinherrscher meistens eher den Weg des Treuebruchs als den des Untergangs.
Trotzdem meint er, daß Republiken tendentiell ehrlicher und treuer sind als Alleinherrscher. Es gibt seiner Meinung nach viele Beispiele dafür, daß Alleinherrscher um geringster Vorteile willen Verträge brechen. Das Volk tut dies hingegen nicht, wofür er auch historische Beispiele anführt. Und so kommt er zur Schlußfolgerung:
"Da glaube ich nach dem oben Gesagten, daß sich hierin das Volk geringere Verfehlungen zuschulde kommen läßt als der Alleinherrscher, und daß man sich deshalb auf dieses mehr verlassen kann als auf den Alleinherrscher."
Ein weiteres Argument für die Überlegenheit der Republik über die Autokratie ist die Beobachtung Machiavellis, daß entartete und verdorbene Republiken immer noch besser sind als entartete und verdorbene Diktaturen. Man könne, meint Machiavelli, verdorbene Republiken auch leichter wieder bessern; in der Autokratie sei das schwieriger.
"Vergleicht man beide im gesetzlosen Zustand, so wird man beim Volk weniger, kleinere und leichter zu bessernde Fehler finden als bei einem Alleinherrscher. Denn zu einem zügellosen, aufrührerischen Volk kann ein Mann mit rechter Gesinnung sprechen und es leicht wieder auf den rechten Weg zurückführen, mit einem schlechten Alleinherrscher aber kann niemand reden, gegen ihn gibt es kein anderes Mittel als den Dolch. Hierauf läßt sich auf die Bedeutung der Krankheit bei beiden schließen: Wenn zur Heilung der Krankheit des Volkes Worte ausreichen und zur Heilung der Krankheit eines Alleinherrschers der Dolch nötig ist, so wird jeder sagen, daß da, wo es einer kräftigeren Kur bedarf, auch schwerere Fehler sein müssen."
Dieses Zitat ist nach Herfried Münkler insoferne besonders bemerkenswert, weil Machiavelli damit auch die in anderen Schriften auftauchende Metapher vom Politiker als Arzt, der Mißstände im Staat wie Krankheiten kuriert, entwirft. (Doch dazu mehr im Kapitel "Vom Erhalt der republikanischen Freiheit").
Republiken ermöglichen zudem im Unterschied zu Autokratien aufgrund der periodischen Wahlen einen häufigen Wechsel an der Staatsspitze. So ist es den Republiken leichter, sich an die erforderlichen Zeitumstände erfolgreich anzupassen. (Dazu mehr bei der Besprechung des "Fürsten", Kap. "Die Zeiten ändern sich").
Aut Caesar aut Brutus
Herfried Münkler schreibt in seinem Buch "Im Namen des Staates. Die Begründung der Staatsraison in der Frühen Neuzeit", daß die Frage, wie die Handlungen von Caesar und Brutus zu bewerten waren, und wer von beiden der Bessere war ("Aut Caesar aut Brutus") die Geister in der Renaissance geschieden hat. Diese Frage hatte eine große Bedeutung in der gelehrten Diskussion der damaligen Zeit.
Noch im Mittelalter hätte man diese Frage klar beantwortet: Dante z.B., neben Machiavelli sicher der berühmteste Florentiner, verbannt in seiner "Göttlichen Komödie" die beiden Anführer der Caesarenmörder, Brutus und Cassius, in den siebten Höllenkreis. Dort müssen sie schmachten, von den Zähnen Luzifers zerfleischt. Ihrem Verrat am erhabenen Caesar ist an Sündhaftigkeit nur noch eine Tat zur Seite zu stellen, nämlich der Verrat des Judas an Jesus Christus.
Münkler skizziert in seinem Buch den völlig anderen Diskurs, der sich gerade zu Machiavellis Zeit zu entfalten begann. Da gab es Verteidiger Caesars, die einerseits den Verrat und Mord an ihm als sündhafte Gewalttat anprangerten, andererseits Caesars unzweifelhaft große Leistungen um Rom lobten, seine überragenden Erfolge und seinen politischen Weitblick in Rechnung stellten. Es gab aber auch Kritiker Caesars, die meinten, er hätte immerhin die Republik durch einen rechtswidrigen Putsch gestürzt, Brutus und Cassius hingegen hätten die ehrenwerte Absicht gehabt, dem Vaterland die Freiheit durch einen Tyrannenmord zurückzugeben. Dagegen wurde damals wiederum von manchen eingewendet, die gute Absicht sei zwar in Ehren zu halten, Caesar aber wurde zu dem rechtswidrigen Akt gezwungen, weil ihn sonst seine Feinde, die Pompeianer, durch ähnlich rechtswidrige Mittel vernichtet hätten. Außerdem meinten manche, die Republik hätte sich damals in einer heftigen Krise befunden und wäre unfähig gewesen, ihre Probleme zu lösen - und dann sei es legitim, wenn ein überragender einzelner zum allgemeinen Wohl die Macht an sich bringt und den Staat neu ordnet. Und was hätten Brutus und Cassius denn schon erreicht? Nach dem Mord Caesars brach wieder ein Bürgerkrieg aus, der dem Volk viel Leid brachte - und letztlich setzte sich wieder ein Militärmonarch durch. Die Ermordung Caesars brachte dem Vaterland kein bißchen Freiheit, sondern nichts als einen neuen Bürgerkrieg.
Machiavelli konnte sich dieser heftigen Diskussion natürlich nicht entziehen. Es ist interessant zu sehen, und es zeigt Machiavellis wahre republikanische Gesinnung, daß er ohne Einschränkungen die Partei von Brutus und Cassius ergreift. Man sieht an seinen Aussagen diesbezüglich, nebenbei bemerkt, auch, wie grundfalsch die faschistische Vereinnahmung Machiavellis ist, die ihm heute noch manchmal angelastet wird.
So gibt Machiavelli einem Kapitel die Überschrift: "So lobenswert die Gründer eines Freistaats oder eines Königreichs sind, so schimpflich sind die Begründer einer Gewaltherrschaft". Darin schreibt er:
"Man darf sich nicht vom Ruhm Caesars blenden lassen, der von den Schriftstellern besonders gefeiert wird; die, die ihn loben, werden nur durch sein Glück verführt und durch die lange Zeit der kaiserlichen Gewalt eingeschüchtert, die unter Caesars Namen ausgeübt wurde und den Schriftstellern nicht gestattete, sich mit Freimut über ihn zu äußern. Will man jedoch wissen, was freie Schriftsteller über ihn sagen würden, so lese man nach, wie sie sich über Catilina äußern. Ja, Caesar ist noch verabscheuungswürdiger, weil der, der Unrecht getan, mehr Tadel verdient als der, der Unrecht nur tun wollte."
Catilina, der 63 v.Chr. in Rom einen Putsch versuchte, der aber an der Aufmerksamkeit des damaligen Konsuls Cicero scheiterte - vgl. Sallust "Die Verschwörung des Catilina" - wird von den Historikern als eindeutig schlecht und verdorben charakterisiert. Caesar hat aber eigentlich nichts anderes gemacht als er - mit dem Unterschied, daß er erfolgreich war. Machiavelli argumentiert im oben angeführten Zitat, daß die böse Handlung nicht besser wird, wenn sie erfolgreich ist (die Menschen glauben es nur). Für Machiavelli ist auch das Motiv von Brutus und Cassius zum Caesarenmord gerechtfertigt und ehrenwert. Sie wollten, schreibt er, das von Caesar "geknechtete Vaterland" befreien.
Machiavelli meint auch sinngemäß, Männer, die einen freien Staat zugrunde richten und eine Diktatur aufrichten, würden sich der ewigen Schande der Nachwelt preisgeben und zudem noch ihr eigenes Leben verderben; denn ein Diktator wird von allen gefürchtet, muß aber auch alle fürchten. Ein demokratischer Politiker braucht keine Leibwache, die ihn vor den eigenen Bürgern schützt. Bei schlechten Herrschern wie Nero hingegen reichen nicht einmal alle Armeen des Morgen- und Abendlandes aus, um sie gegen Aufstände zu verteidigen. Zudem hätten angesehene demokratische Politiker in ihrem Staat oftmals nicht weniger Macht als manche Diktatoren.
Betrachtet der Unvoreingenommene zudem, was die von Caesar begründete Militärmonarchie in den kommenden Jahrhunderten angerichtet hat, "so wird er gewahr, daß diese Zeiten durch Kriege verwildert, durch Aufstände zerrissen, grausam im Frieden und im Krieg sind: daß so viele Herrscher ermordet wurden, so viele Bürgerkriege und auswärtige Kriege geführt wurden, Italien gequält und von immer neuen Unglücksfällen heimgesucht, die Städte zerstört und geplündert wurden. Er wird sehen, daß Rom gebrandschatzt, das Capitol von den eigenen Bürgern zerstört, die alten Tempel verwüstet, die alten Gebräuche entweiht wurden und die Städte voller Ehebrecher waren. Er wird das Meer voller Verbannter und die Felsenriffe voller Blut sehen; er wird sehen, daß in Rom zahllose Grausamkeiten verübt wurden, daß Adel, Reichtum und einst verdiente Ehre und vor allem jede Art Tüchtigkeit als Kapitalverbrechen gegolten haben. Er wird sehen, daß die Angeber belohnt wurden, die Sklaven gegen ihre Herrn und die Freigelassenen gegen ihren Patron aufgewiegelt wurden, und die, die keine Feinde hatten, von ihren Freunden ermordet wurden. Dann wird er am besten erkennen, was Rom, Italien und die Welt Caesar zu danken haben".
Vom Erhalt der republikanischen Freiheit
Wie oben bereits zitiert, hat eine Republik nach Machiavelli zwei Ziele: Den Erhalt der eigenen Freiheit und die Eroberung neuer Gebiete.
Zunächst soll auf ersteres eingegangen werden. Dazu muß gesagt werden, daß Machiavellis politische Theorie von der Annahme ausgeht, daß alle Staaten, sowohl Autokratien, als auch Republiken, verderben können.
So schreibt er in den "Discorsi":
"Es ist unbedingt richtig, daß alle Dinge auf der Welt ihre Lebensgrenze haben. Doch nur diejenigen vollenden den ganzen, ihnen vom Himmel vorgezeichneten Weg, die ihren Körper nicht in Unordnung bringen, sondern ihn so in Ordnung halten, daß er sich nicht ändert, oder, wenn er sich ändert, zu seinem Wohl und nicht zum Schaden. (...) Da aber das Gute im Lauf der Zeit verdirbt, so muß der betroffene Körper notwendigerweise absterben, wenn nichts eintritt, das das ursprünglich Gute wiederherstellt."
In einem Staatswesen besteht nach Machiavelli die Tendenz, daß Mißstände aller Art nach und nach einreißen; zuerst merkt man davon kaum etwas, allmählich vergrößert sich aber die Gefahr für die Gesamtheit. Aus diesem Grund muß man Mißstände rechtzeitig bekämpfen.
Nach Machiavelli gilt dabei auch folgende Regel: "Sollen eine Religionsgemeinschaft oder ein Staat lange bestehen, so muß man sie häufig zu ihren Anfängen zurückführen." Als Begründung für diesen Ratschlag gibt er an, daß ein Staat ursprünglich immer gut gewesen sein muß - sonst hätte man diese Ordnung nicht eingeführt. Idealerweise sollten immer wieder große einzelne auftauchen, die den Staat wieder zu seinem Ursprung zurückführen und die nach und nach entstandenen Mißstände beseitigen.
Machiavelli meint im oben zitierten Kapitel auch, daß eine solche Neuordnung sehr oft im Gefolge einer heftigen Krise auftritt - dann sind Machthaber und Staaten gezwungen, Reformen durchzuführen. Krisen können nach Machiavelli also eine sehr heilsame Wirkung haben; sie eröffnen auch begabten Menschen den Zugang zu hohen Ämtern und glorreichem Nachruhm.
Das Wirken eines großen Reformers gleicht durchaus dem des umsichtigen Arztes. Auch im "Fürsten" findet man eine vergleichbare Stelle. Es steht mit politischen Übeln aller Art, schreibt Machiavelli, wie mit der Schwindsucht, die am Beginn der Erkrankung leicht zu heilen und schwer zu erkennen, aber im Laufe der Zeit leicht zu erkennen und nur schwer zu heilen ist. Ebenso verhält es sich nach Machiavelli mit dem Staatswesen; wenn man im voraus die darin aufkeimenden Mißstände erkennt, so kann man sie rasch kurieren. Läßt man sie jedoch, weil man sie nicht erkannt hat, auswachsen, bis jeder sie wahrnimmt, dann gibt es kein Mittel mehr dagegen.
Soweit zur Erhaltung von Staaten allgemein. Nun einige konkrete Gedanken zum Erhalt der republikanischen Freiheit.
Dieser ist nach Machiavelli sehr schwierig, wenn das Volk vor Einführung der Republik es lange Zeit gewohnt war, unter einem Alleinherrscher zu leben.
"Diese Schwierigkeit ist leicht verständlich, denn ein solches Volk ist in der gleichen Lage wie ein Raubtier, das zwar von Natur wild und unbändig, aber immer im Käfig und unter der Peitsche gehalten, durch einen Zufall ins Freie gelassen wird: Da es nicht gewohnt ist, sich seine Nahrung zu suchen, und die Schlupfwinkel nicht kennt, in denen es sich verbergen könnte, wird es die Beute des ersten besten, der es wieder an die Kette legen will."
Ich bin der Ansicht, daß die Einschätzung Machiavellis zu diesem Punkt völlig richtig ist; als modernes Beispiel fallen mir die Weimarer Republik in Deutschland und die 1.Republik in Österreich ein. In beiden Staaten gab es zuvor jahrhundertelang eine Monarchie und kaum demokratische Traditionen. Weite Teile der Bevölkerung konnten mit den Freistaaten nichts anfangen und sehnten sich nach einem "Ersatzkaiser" - der in Gestalt eines Diktators bald auch über sie hereinbrach. Den republikanisch gesinnten Politikern fehlte damals u.a. die demokratische Erfahrung und Routine, um diese Tendenzen abwehren zu können.
Die Aufrechterhaltung einer Demokratie wird nach Machiavelli auch bei allgemeiner Sittenverderbnis eines Volkes praktisch unmöglich. Dabei schwebt Machiavelli natürlich das Beispiel der römischen Republik vor. Die nichtstuenden römischen Massen, die es nur noch gewohnt waren, von den Sozialbeihilfen des Staates zu schmarotzen und sich an politischen und sportlichen Spektakeln zu amüsieren, ließen sich nach und nach von skrupellosen Demagogen wie Caesar verführen; gleichzeitig wurde im zunehmenden Egoismus und Parteienhader die römische Republik von Leuten zu Tode gehetzt, die nicht mehr das Gesamtwohl des Staates im Auge hatten, sondern nur mehr den Wunsch nach persönlicher Bereicherung. Der Verfall der Sitten, der Sexualmoral und der Religion taten wahrscheinlich noch ein übriges, um ein Klima zu schaffen, in dem nur mehr Bürgerkrieg, und um diesen zu beenden, die abscheulichste Diktatur blühen konnte.
"Ein Volk aber, bei dem völlige Sittenverderbnis eingerissen ist, vermag nicht einmal kurze Zeit, ja keinen Augenblick in Freiheit zu leben,..."
Die Römer waren nach Machiavelli ursprünglich unverdorben, daher freiheitsliebend. Später aber, meint er, reichten das Ansehen und die Strenge des Brutus mit allen Legionen des Ostens nicht aus, um das Volk zur Erhaltung der Freiheit zu bewegen. Machiavelli erklärt dies durch die Verderbtheit der Sitten, an der die demagogische Politik der Partei des Marius Schuld trug. Caesar, der Führer dieser Partei, nutzte seine Chance und verblendete die Massen derart, "daß sie des Jochs nicht gewahr wurden, das sie sich selbst auf den Nacken legten."
Machiavelli sah auch ganz klar, daß die Gefahr für eine Republik oft auch von einem Demagogen ausgeht, der das Volk verführt, von ihm groß gemacht wird - und der dann die Macht an sich reißt. Machiavelli gibt daher auch Ratschläge, wie man solche Demagogen am besten bekämpft. Er kommt dabei auf das Ergebnis, daß man einen aufsteigenden Demagogen nicht durch Ächtung, Isolation oder reine Gegnerschaft bezwingen kann, sondern indem man ihm seine erfolgreichen Methoden der Volksgewinnung stiehlt. Dann verliert er Wähler und wird geschwächt.
So schreibt Machiavelli ein Kapitel mit der Überschrift: "Um den Übergriffen eines Mannes, der in einem Freistaat zur Macht emporsteigt, Einhalt zu gebieten, gibt es kein sichereres und weniger beunruhigenderes Mittel, als ihm die Wege abzuschneiden, auf denen er zur Macht gelangt ist." In diesem Kapitel meint er:
"Hätte man dieses Verfahren bei Cosimo Medici angewandt, so wäre dies für seine Gegner eine viel bessere Maßnahme gewesen, als ihn aus Florenz zu vertreiben. Hätten nämlich die Bürger, die sich mit ihm um die Macht bewarben, seine Methode der Volksbegünstigung angewandt, so hätten sie ihm ohne Aufruhr und ohne Gewaltanwendung die Waffen entwunden, deren er sich am meisten bediente. (...Dasselbe gilt auch für Piero Soderini...) Sicher war es für die Bürger (...) viel leichter, viel ehrbarer und weniger gefährlich (...), ihm die Wege zu verlegen, auf denen er groß wurde, als sich ihm entgegenzustellen und damit die ganze Republik in seinen Sturz zu verwickeln."
Das letzte Kapitel der "Discorsi" trägt die Überschrift: "Um einer Republik die Freiheit zu erhalten, bedarf es jeden Tag neuer Maßnahmen; und für welche Verdienste Quintus Fabius den Beinamen Maximus erhielt."
Machiavelli vertritt auch dort das Konzept einer "wehrhaften Demokratie", die nicht vor ihren Gegnern widerstandslos kapituliert (wie z.B. manche Republiken in unserer jüngsten Vergangenheit), sondern sich allen äußeren und inneren Gefahren entschlossen entgegenstellt.
Und so lobt er die unseren heutigen Sitten als drakonisch erscheinenden Strafmaßnahmen der Römer, die er allesamt als Vorbild sieht.
Einmal war die Republik gefährdet durch eine merkwürdige und unvorhergesehene Verschwörung, in die zahllose römische Frauen verwickelt waren - diese hatten sich verschworen, ihre Männer umzubringen. Viele hatten ihre Männer bereits vergiftet, andere hatten das Gift schon zubereitet. Ein andermal drohte der Staat gestürzt zu werden durch die immer mehr überhandnehmenden Sektierer des Dionysos-Kultes, gegen die der Senat schließlich einschreiten mußte.
Die römische Republik meisterte aufgrund ihrer Größe und Durchschlagskraft alle Probleme, denn sie...
"...zögerte nicht, gelegentlich eine ganze Legion und eine ganze Stadt zum Tode zu verurteilen und acht- bis zehntausend Menschen unter außerordentlich harten Bedingungen zu verbannen (...) So erging es den Soldaten, die das Unglück hatten, bei Cannae geschlagen zu werden. Man verbannte sie nach Sizilien, wo sie sich nirgends niederlassen durften und stehend ihre Mahlzeiten einnehmen mußten.
Von allen Strafen aber war die schrecklichste das Dezimieren der Heere, wo, vom Los bestimmt, jeder zehnte Mann im ganzen Heer sterben mußte. Man konnte zur Züchtigung einer Masse von Menschen keine abschreckendere Strafe ersinnen. Denn wenn eine unbestimmbare Menge gemeinsam ein Verbrechen begeht und die Urheber unbekannt sind, so kann man nicht alle strafen, weil ihrer zu viele sind. Würde man aber einen Teil bestrafen und die übrigen frei ausgehen lassen, so würde man den Bestraften unrecht tun und die Unbestraften zu neuen Verbrechen ermutigen. Wird dagegen der zehnte Teil durch das Los zum Tode bestimmt, den an sich alle verdient haben, so beklagt sich der, den die Strafe trifft, über das Schicksal, und wer straflos ausgeht, fürchtet, die Strafe könnte ihn ein anderes Mal treffen und hütet sich künftig vor einer Verfehlung. Die Giftmischerinnen und die Verschwörer der Bacchanalien wurden so bestraft, wie es ihre Verbrechen verdienten. Obgleich solche Verbrechen üble Folgen für die Republik haben, sind sie für sie doch nicht tödlich, da man fast immer Zeit hat, sie auszumerzen. Bei Staatsverbrechen aber hat man keine Zeit, denn diese richten einen Staat zugrunde, wenn nicht ein kluger Mann dagegen einschreitet."
Schließlich stellt Machiavelli als Vorbild für jeden republikanisch gesinnten Politiker den Quintus Fabius dar. Als dieser merkte, daß durch die vielen Fremden, die das Bürgerrecht erhielten, sich die Regierung zu verändern und von ihren guten, alten Grundsätzen abzuweichen drohte, "teilte er alle neuen Leute, von denen dieser Mißstand herrührte, in vier Wahlbezirke, damit sie, auf so kleinen Raum beschränkt, nicht ganz Rom verderben konnten. Fabius hatte das Übel richtig erkannt und kaltblütig das geeignete Mittel dagegen angeordnet. Dies war der Bürgerschaft so willkommen, daß er den Beinamen Maximus verdiente."
Machiavellis Republik ist in der Lage, kaltblütig und skrupellos gegen alle inneren und äußeren Feinde aufzutreten - mit an sich undemokratischen Mitteln wird die demokratische Freiheit gewahrt. Machiavelli wäre sicher ein Befürworter der Verbotsgesetze der nationalsozialistischen Wiederbetätigung; wahrscheinlich träte er auch für das Verbot und die Bekämpfung von umstürzlerischen Sekten wie Scientology ein.
Von der Vergrößerung einer Republik
Nach Machiavelli haben Republiken drei Möglichkeiten, sich zu vergrößern. Die erste Methode, die der Römer, ist für ihn die beste. Eine mächtige Republik sucht kleinere und schwächere Verbündete, schließt mit ihnen einen engen Militärbund, behält sich aber den Oberbefehl über die gemeinsamen Truppen vor. So kann man seine Kräfte vervielfachen, große Eroberungen machen und alle Gefahren abwehren. Die Bundesgenossen aber geraten erfahrungsgemäß im Laufe der Zeit in immer größere Abhängigkeit, wie man am Beispiel Roms und seiner Bundesgenossen sieht. Eines Tages waren diese mit ihrer Stellung dermaßen unzufrieden, daß sie sich gegen Rom verschworen - doch Rom war bereits zu stark geworden und unterwarf die Bundesgenossen wieder.
Die zweite Möglichkeit ist die Methode der Etrusker. Sie ist für Machiavelli die zweitbeste Möglichkeit. Diese besteht darin, daß sich mehrere gleichstarke Republiken zu einem Bund zusammenschließen - jede Republik hat in diesem Staatenbund gleiche Rechte. So kann eine effiziente militärische Schlagkraft und eine bedeutende Stellung erreicht werden. Das einzige Problem besteht darin, daß die Expansionsfähigkeit des Bundes begrenzt ist. Denn wenn die Mitgliederzahl 13 oder 14 übersteigen sollte, würde die Vielzahl der Bundesgenossen, von denen jeder gleiches Mitspracherecht hat, nur Verwirrung stiften und die Handlungsfähigkeit des Bundes ernsthaft gefährden.
Diese besagten Bünde sind auch friedlicher; denn da die Mitglieder ihre Entscheidungen mühsam untereinander absprechen müssen, sind sie schwerfälliger, was sie zum Krieg nicht unbedingt geeignet macht; auch müßte die eventuelle Beute unter so vielen Mitgliedern geteilt werden, was die Eroberungslust beträchtlich mindert.
Die dritte Methode taugt nach Machiavelli überhaupt nichts; es ist jene, die schon in der Antike Athen und Sparta zugrunde richtete. Sie besteht darin, andere Staaten zu erobern, zu besetzen und das dortige Volk schlecht zu behandeln. Machiavelli ist der Ansicht, daß es fast unmöglich ist, ein fremdes Volk mit Gewalt und gegen seinen Willen zu regieren; ständig muß man Aufstände unterdrücken, erneut Kriege führen, riesige und teure Streitkräfte im betreffenden Land stationiert halten etc. Wenn man nicht starrt vor Waffen, läßt sich so ein Unternehmen kaum durchführen; und beim kleinsten Moment der äußeren oder inneren Schwäche würde es erneut zu Problemen kommen.
Machiavelli rät also allen Republiken zum Abschluß enger Staatenbünde als zweckmäßigste und gangbarste Methode ihrer Vergrößerung. Zu seiner Zeit war diese Forderung revolutionär, weil kaum praktiziert; heute ist dieses Modell weitverbreitet (siehe NATO oder EU).
4. Machiavelli und die Religion
Die Religion als Mittel der Politik
In vielen Kapiteln der "Discorsi" lobt Machiavelli die Religion als Grundlage des Staates.
"Monarchien oder Freistaaten, die sich unverdorben halten wollen, müssen vor allem die religiösen Gebräuche rein erhalten und immer Ehrfurcht vor ihnen bezeugen; denn es gibt kein schlimmeres Zeichen für den Verfall eines Landes als die Mißachtung des religiösen Kultes. (...) Die Häupter eines Freistaates oder eines Königsreiches müssen daher die Grundlagen der Religion, zu der sich ihre Völker bekennen, bewahren; dann wird es ihnen leicht sein, ihren Staat in Gottesfurcht und damit gut und einträchtig zu halten."
Auf den ersten Blick scheint sich Machiavelli in rein traditionellen Bahnen zu bewegen und ganz fromm und konservativ die Religion als Grundlage des Staates und der Gesellschaft zu preisen. Doch Machiavellis Lob entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als wenig schmeichelhaft für die Religion. Denn sie wird von Machiavelli zwar gelobt, aber völlig der weltlichen Gewalt untergeordnet. Er begründet sein positives Urteil über die Religion nämlich damit, daß man sie als Mittel der Politik einsetzen kann. Mit ihr kann man das Volk manipulieren und so zu Handlungen bewegen, die man sonst von ihm nicht erreichen würde. Man kann unter Berufung auf himmlische Kräfte die Soldaten der eigenen Armee motivieren und zum Durchhalten in schwierigen Situationen bewegen. Ferner lassen sich durch die Religion Aufstände unterdrücken; die Stellung des Machthabers kann somit genauso wie der soziale Friede gestärkt werden.
Machiavelli vertritt also sinngemäß etwa jene Argumentationslinie: Die Religion ist gut, man muß sie fördern und stärken, aber nicht, weil sie etwa wahr ist, sondern weil sie ein gutes Werkzeug für politische Ziele abgibt. Wie wenig die Wahrheit der Religion für Machiavelli zur Debatte steht, zeigt seine Aussage, die Machthaber müßten alles, was für die Religion spricht, unterstützen und fördern, "auch wenn sie es für falsch halten". Machiavelli verwandelt so, meint Herfried Münkler, die Religion von der Norm der Politik zu ihrem Mittel.
Die alten Römer sind für Machiavelli das Vorbild hinsichtlich des instrumentellen Einsatzes von Religion. Sie benutzten z.B. religiöse Vorzeichen dazu, um die Soldaten zum Kampf zu motivieren. Es wurde keine Schlacht geführt, ohne daß günstige Vorzeichen zuvor den Sieg verheißen hätten. Dies hatte aber vor allem psychologische Gründe; man wollte die Zuversicht der Soldaten stärken. Wie wenig die Feldherren an die Vorzeichen selbst glaubten, zeigt schon allein der Umstand, daß sie diese nach dem Gebot der Stunde auslegten.
So hatten die Römer heilige Hühner, denen vor jeder Schlacht Futter vorgeworfen wurde. Fraßen die Hühner gierig, galt dies als Verheißung des Siegs. Wenn die Hühner nicht fressen wollten, war dies ein schlechtes Zeichen. Einmal führte Konsul Papirius einen großen Krieg gegen die Samniten; und vor der Entscheidungsschlacht wollten die Hühner nicht fressen. Er ließ aber überall herumerzählen, die Hühner hätten gierig gefressen; die Soldaten wurden so begeistert und erkämpften einen Sieg - nicht zuletzt wegen ihrer Begeisterung. Man sieht also, daß Papirius wohl wußte, daß die heiligen Hühner ein Unfug sind; aber er hütete sich, dies offen zu sagen; vielmehr benutzte er diesen Umstand zu seinem und des Staates Vorteil.
Ein anderer Feldherr, Appius Pulcher, handelte nicht so klug und besonnen. Als ihm gemeldet wurde, daß die Hühner vor der Schlacht gegen die Karthager nicht fressen wollten, ließ er sie ins Meer werfen und rief erbost: "Nun wollen wir sehen, ob sie saufen können!" Appius Pulcher verlor die Schlacht, nicht zuletzt, weil sein Verhalten die Soldaten verunsicherte oder zumindest nicht motivierte. Machiavelli kritisiert Pulchers Verhalten, natürlich aber nicht, weil das Federvieh wirklich in Verbindung mit den Göttern stand, sondern weil Pulcher eine Möglichkeit der Beeinflussung des Heeres leichtfertig aus der Hand gab.
Nicht zuletzt Machiavellis Unterordnung der Religion unter politische Zwecke führte zur heftigen Polemik der Jesuiten gegen ihn. Auf deren Drängen wurde Machiavelli von Papst Paul VI. auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt.
Die Kritik an der christlichen Lehre
Machiavelli hält den christlichen Glauben nicht für die optimale Staatsreligion. Dies kommt schon zum Ausdruck, wenn er im Vorwort zu den "Discorsi" die "Kraftlosigkeit" beklagt, "die unsere gegenwärtige Religion der Welt anerzogen hat."
Erklärbar wird diese Aussage vor allem durch Passagen aus Discorsi II,2. Er versucht darin zu erklären, warum in der Antike so viele Völker in Freiheit lebten, die republikanische Staatsform wählten und Monarchie und Diktatur leidenschaftlich ablehnten, während zu seiner Zeit die Republik die Ausnahme, die Autokratie die Regel war. Er führt dies auf den knechtenden Einfluß der christlichen Religion zurück, die er als weit schlechter bewertet als die heidnischen Kulte.
Machiavellis Kritik spricht für sich selbst:
"Wenn ich bedenke, woher es kommen konnte, daß im Altertum die Völker die Freiheit mehr liebten als je, so scheint mir dies aus derselben Ursache herzurühren, welche heute die Menschen weniger kraftvoll macht. Sie liegt nach meiner Meinung in der Verschiedenheit der heutigen und der antiken Erziehung, die wiederum in der Verschiedenheit der heutigen und der antiken Religion begründet liegt. Unsere Religion (...) läßt uns die Ehren dieser Welt weniger schätzen, während die Heiden diese sehr hoch schätzten, ihr höchstes Gut darin erblickten und deshalb in ihrer Tat viel kühner waren. (...)
Die Religion der Alten sprach ferner nur Männer von großem weltlichen Ruhm heilig, wie Feldherrn und Staatsmänner. Unsere Religion hat mehr die demütigen und in Betrachtung versunkenen Menschen verherrlicht als die tatkräftigen. Sie sieht das höchste Gut in Demut, Selbstverleugnung und in der Geringschätzung der weltlichen Dinge. Die Religion der Alten dagegen sah es in der Größe des Muts, in der Kraft des Körpers und überhaupt in allen Eigenschaften, die die Menschen möglichst tapfer machen. Wenn auch unsere Religion fordert, daß man stark sei, so will sie dabei mehr die Stärke des Duldens als die der Tat. Diese Regel hat, wie mir scheint, die Weltgeschichte den Bösewichten ausgeliefert, die ungefährdet ihr Unwesen treiben können; denn sie sehen, daß die große Mehrheit der Menschen, um ins Paradies einzugehen, mehr darauf bedacht ist, Schläge zu ertragen als zu rächen."
Machiavellis Kritik am Christentum stößt sich vor allem an der zu großen Jenseitigkeit dieser Religion, die die Gläubigen so für Staat und Gesellschaft wenig brauchbar macht. Außerdem kritisiert er die Werte der Demut und Duldung, die zu einer Untertanengesinnung beitragen. Nietzsche hat das Christentum später als "Sklavenmoral" bezeichnet; Machiavelli würde diese Einschätzung teilen. Er schränkt aber auch ein, daß man das Christentum durch eine weltlichere Interpretation aber auch verbessern könnte. Machiavellis Religionskritik ist im Zusammenhang mit der in der Renaissance verstärkt einsetzenden Säkularisierung zu sehen.
Die Kritik an der Katholischen Kirche
An der Katholischen Kirche läßt Machiavelli kein gutes Haar. Sein Urteil ist vernichtend. Dies hängt auch damit zusammen, daß es in der Katholischen Kirche des 16.Jahrhunderts besonders viele Mißstände gab - was zu jener Zeit auch zu der von Luther initiierten Reformation führte.
Zunächst kritisiert er, daß die Kirche nicht nach der Lehre lebt, die sie predigt. Das mag erstaunen, da er ja, wie oben beschrieben, die christliche Lehre auch ablehnt. Kritiker können Machiavelli dies vielleicht als Widerspruch ankreiden: Er kritisiert eine gewisse Lehre und stößt sich dann daran, daß die Prediger dieser Lehre nicht danach leben. Ich persönlich bin aber der Meinung, daß Machiavelli gegen diesen Vorwurf zu verteidigen ist, da falsch und falsch sich ja nicht notwendigerweise aufheben. Man kann eine falsche Meinung haben und diese dann noch inkonsequent umsetzen; durch die Inkonsequenz der Tat wird die Falschheit der Lehre ja nicht bekämpft, sondern verstärkt; außerdem erkennt ein jeder dann die dem jeweiligen Charakter zugrundeliegende Heuchelei.
"Wäre von den Spitzen der Christenheit die christliche Religion erhalten worden, wie sie ihr Stifter gegründet hat, dann wären die christlichen Staaten und Länder einträchtiger und glücklicher, als sie es jetzt sind. Nichts spricht mehr für den Verfall des christlichen Glaubens als die Tatsache, daß die Völker, die der römischen Kirche, dem Haupt unseres Bekenntnisses, am nächsten sind, am wenigsten Religion haben."
Machiavelli meint ferner, daß Italien durch das "böse Beispiel des päpstlichen Hofes" alle Gottesfurcht und alle Religion verloren hat. "Wir Italiener verdanken es also in erster Linie der Kirche, daß wir so religionslos und schlecht geworden sind."
Er geht sogar so weit, zu behaupten, daß wer sich von der Verderbnis der Kirche überzeugen wolle, die Macht haben müßte, den päpstlichen Hof mit der ganzen Autorität, die er in Italien hat, in die Schweiz zu versetzen, einem Land, das Machiavelli aufgrund seiner freien politischen Einrichtungen und der Tüchtigkeit seines Volkes außerordentlich schätzte. Mit all seiner Korruption und Mißwirtschaft würde das Papsttum dort mehr Schaden anrichten, als jedes unglückliche Ereignis es könnte und das Land vollständig verderben.
Machiavelli erhebt aber auch einen anderen schweren Vorwurf gegen die Kirche: Seiner Meinung nach trägt sie und ihr die Mitte Italiens umfassender Kirchenstaat die Schuld an der Zersplitterung Italiens. Und tatsächlich war dieser Staat lange Zeit ein Haupthindernis der italienischen Einigungsbewegung, die erst im 19.Jahrhundert erfolgreich war.
Machiavelli aber ist ein Vordenker der italienischen Einigung; dieses Ziel ist bereits im "Fürst" ausgesprochen. Die Kirche habe, meint Machiavelli in den "Discorsi", "unser Land immer in Zersplitterung gehalten". Denn sie war nicht stark und nicht mutig genug, Italien zu einen; sie hat aber auch verhindert, daß die von anderen begonnenen Einigungsbestrebungen scheiterten. Daher sei sie schuld daran, daß Italien "nicht unter ein einziges Oberhaupt kommen konnte, sondern von vielen Machthabern und Herrn regiert wird. Dies hatte solche Uneinigkeit und Machtlosigkeit zur Folge, daß Italien nicht nur zur Beute mächtiger Barbaren, sondern überhaupt eines jeden wurde, der es angriff. Dies haben wir Italiener allein der Kirche zu verdanken und sonst niemandem."
5. Ratschläge zu Machtgewinn und Machterhalt
In dieser Arbeit kann aus Platzgründen nicht die ganze Vielfalt der allgemeinen strategischen Ratschläge dargestellt werden, die Machiavelli in den "Discorsi" erteilt. In einer Auswahl möchte ich aber auf jene Passagen eingehen, die mir besonders bemerkenswert erscheinen.
Entweder gut oder böse handeln - kein Mittelweg
In den "Discorsi" steht ein Kapitel mit dem Titel: "Die Menschen verstehen in den seltensten Fällen, ganz schlecht oder ganz gut zu sein." In dem Kapitel beschreibt Machiavelli, wie Papst Julius II. nach Perugia zog, um den dortigen Tyrannen Giovanni Pagolo abzusetzen. Er zog dabei ohne den Schutz seines Heeres, nur mit seiner Leibwache begleitet, in die feindliche Stadt ein und nahm Pagolo gefangen; dieser leistete keinen nennenswerten Widerstand, obwohl es ihm leicht möglich gewesen wäre, den Papst zu vernichten. Dies wagte er aber nicht; religiöse Scheu kann es aber kaum gewesen sein, die ihn abhielt, denn er war ein skrupelloser Mörder und lebte sogar mit der eigenen Schwester in Blutschande zusammen. Auch hätte ihn die Ermordung dieses Papstes nach Meinung Machiavellis eher beliebt als unbeliebt gemacht. Pagolos Fehler war der verderbliche Mittelweg zwischen Gut und Böse: Er war nicht stark genug, gut zu sein, sondern beging viele Verbrechen und schuf sich Feinde; er war aber auch nicht stark genug, böse zu sein, weil ihn plötzlich doch die moralischen Skrupel überfielen.
Bescheidenheit - keine erfolgreiche Strategie
"Die Menschen täuschen sich häufig, wenn sie glauben, durch Bescheidenheit den Hochmut bezwingen zu können", betitelt Machiavelli ein Kapitel der "Discorsi".
Darin meint er:
"Man sieht oft, daß Bescheidenheit gar nichts nützt, ja daß sie nur schadet, besonders wenn man es mit unverschämten Menschen zu tun hat, die einen aus Neid oder einem anderen Grunde mit ihrem Haß verfolgen. (...) Ein Herrscher darf daher nie seiner Würde etwas vergeben und nie freiwillig, wenn es in Ehren geschehen soll, auf etwas verzichten, es sei denn, daß er in der Lage ist, seinen Besitz tatsächlich zu halten, oder daß man es wenigstens von ihm glaubt. Ist es soweit gekommen, daß er nicht ehrenvoll auf seinen Besitz verzichten kann, so ist es fast immer besser, sich ihn mit Gewalt entreißen zu lassen, als ihn aus Furcht vor Gewalt abzutreten. Denn wenn du aus Furcht einen Verzicht leistest, so tust du es, um einen Krieg zu vermeiden. Meistenteils vermeidest du aber dadurch den Krieg nicht; denn der Feind, dem du aus offensichtlicher Feigheit dieses Zugeständnis gemacht hast, wird sich damit nicht zufrieden geben, er wird dir vielmehr alles entreißen wollen und noch heftiger auf dich erpicht sein, da er dich weniger achtet. Andererseits wirst du deine Verteidiger kühler gegen dich gesinnt finden, da du ihnen schwach und feige erscheinst. Rüstest du aber sofort, wenn die Absichten deines Gegners offenbar werden, deine Streitkräfte, obwohl sie den seinigen unterlegen sind, so wirst du in seiner Achtung steigen. Auch die anderen Herrscher ringsum achten dich höher, und mancher bekommt, wenn du unter Waffen stehst, Lust, dir zu helfen, während er dir nie beistehen würde, wenn du dich selbst aufgibst. Dies gilt für den Fall, daß du nur einen Gegner hast. Hast du deren mehrere, so ist es immer klug, einem von ihnen, auch wenn der Krieg schon ausgebrochen ist, einen Teil deiner Besitzungen abzutreten, um ihn für dich zu gewinnen und ihn von den anderen gegen dich verbündeten Feinden zu trennen."
Wie sehr die Kenntnis Machiavellis der Selbstbehauptung der Demokratien im 20.Jahrhundert genutzt hätte, sieht man an diesem Zitat. Als das "Dritte Reich" die Tschechoslowakei zu verschlucken drohte, konnte sich der britische Premier nicht entschließen, dem mit Gewalt entgegenzutreten - offensichtlich aus als Pazifismus getarnter Feigheit. Und so versuchte er durch eine Beschwichtigungspolitik ("appeasement policy"), den Krieg mit Hitler durch Einlenken zu vermeiden. Er wollte durch sein Nachgeben eine mäßigende Wirkung erreichen.
Hätte er Machiavelli gekannt, dann hätte er gewußt, daß man durch Bescheidenheit den Hochmut nicht bezwingen kann, sondern den Gegner nur noch übermütiger macht. Auch wurde der 2.Weltkrieg nicht vermieden, durch Zögern und mangelnde Entschlossenheit wurde er aber zuungunsten der Allierten aufgeschoben. Machiavellis Grundüberzeugung ist, daß man nicht zögern sollte, einen notwendigen Krieg zu führen, denn manchmal kann man eben den Krieg nicht vermeiden, sondern nur zum eigenen Nachteil aufschieben, wie er u.a. auch im "Fürsten", Kap.III schreibt.
Was auf den ersten Blick als Kriegstreiberei erscheint, entpuppt sich auf den zweiten Blick 1.) als richtige Einschätzung und 2.) sogar als menschlich. Wären die Alliierten Hitler bereits bei seinen ersten Völkerrechtsbrüchen entgegengetreten, hätten sie ihn ohne größere Gefahr stürzen können. Doch durch das alliierte Zögern wurde die Sache immer schlimmer; schließlich mußten sie doch Krieg führen, diesmal aber unter wesentlich größeren Risken gegen eine mittlerweile hochgerüstete Deutsche Wehrmacht. Statt vielleicht einiger zehntausend Tote hatte man am Ende derer 55 Millionen zu beklagen.
Mit Ungestüm und Kühnheit ist man oft erfolgreich
Machiavelli führt in den "Discorsi" das Beispiel der gegen die Römer kämpfenden Samniten an, die mit den Etruskern verbündet waren. Die Etrusker hatten jedoch einen Waffenstillstand mit den Römern geschlossen, was die Samniten entscheidend schwächte; also marschierten diese, nach einer schnellen Entscheidung, mit ihrem gesamten Heer auf etruskisches Gebiet. Dort verlangten sie von den Etruskern, wieder die Waffen zu ergreifen, und legten ihre Gründe für den Krieg dar. Die Etrusker nahmen, durch die kühne Handlung gedrängt, den Kampf gegen Rom wieder auf. Daraus schließt Machiavelli: "Mit Ungestüm und Kühnheit erreicht man oft, was man mit gewöhnlichen Mitteln nie erreichen würde." Und weiters, daß "wenn ein Machthaber bei einem anderen etwas erreichen will, so darf er ihm, wenn es irgendwie möglich ist, keine Zeit zur Überlegung lassen und muß alles tun, damit der Gebetene die Notwendigkeit eines schnellen Entschlusses einsieht und erkennt, daß Weigerung oder auch nur Aufschub den gefährlichen Unwillen des Bittenden hervorrufen würde". Machiavelli führt weitere historische Beispiele an, die diese Einschätzung bestätigen.
Machiavelli als Ratgeber für Privatleben und Beruf?
Machiavellis Überlegungen sind in den angeführten Fällen nicht abwegig; zeigt doch auch schon die Erfahrung im praktischen Leben, daß es durchaus eine erfolgreiche Strategie sein kann, andere Menschen z.B. vor vollendete Tatsachen zu stellen oder zu schnellen Entscheidungen zu zwingen. Wahrscheinlich hat die vielfältige Möglichkeit der Anwendung von Machiavellis Thesen im privaten oder beruflichen Bereich dazu geführt, daß die Annäherung an Machiavelli in der Literatur oftmals in Form von Ratgebern passiert - frei nach dem Motto: So wenden Sie Machiavellis Thesen in Ihrem Leben an und werden erfolgreich, schlau und reich.
Ich persönlich glaube, daß eine solche Annäherung zwar möglich, aber ihrem Wesen nach begrenzt ist; wird doch die so wichtige politische oder ethische Dimension von Machiavellis Werk auf diese Art weitgehend ausgeklammert und Machiavelli in einer eher flachen Form rezipiert - oder sollte man lieber sagen, im Sinne des Zeitgeistes konsumiert? Aus diesem Grunde möchte ich keine weiteren Beispiele zum Thema "Ratschläge zu Machtgewinn und Machterhalt" anführen, sondern zur weitaus wichtigeren philosophischen Betrachtung zurückkehren. Philosophische Reflexion gilt zwar gemeinhin als nutzlos und unbrauchbar - und dies hat seine Richtigkeit, wenn man keine anderen Formen des "Nutzens" und der "Brauchbarkeit" zuläßt als solche, die dem Freßtrieb, dem Sexualtrieb und dem Geldverdienen entgegenkommen. Vertreter eines solchen Begriffes sollten sich zwar die Frage stellen, ob die höchste Entfaltung des menschlichen Lebens nicht in anderen Bereichen zu suchen ist - im Falle der Beschäftigung mit Machiavelli liegt es aber etwas anders: Hier kann man sogar rechtfertigen, daß seine Gedanken von der Art sind, daß man unter Umständen auch in der Praxis auf sie zurückgreifen kann.
Machiavellis Fürst
1. Der Begriff des "Fürsten"
Für den heutigen Leser mutet der von Machiavelli verwendete Begriff "Fürst" sehr mittelalterlich und feudal an. Ein Buch, das von der Fürstenherrschaft handelt, könnte uns daher zunächst als überholt erscheinen. Tatsächlich muß man sagen, daß Machiavelli an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit lebte; und zumindest seine Zeitgenossen dachten, wenn sie sich einen Fürsten vorstellten, wahrscheinlich an einen König aus edlem und heiligem Geschlecht, der auf einem prunkvollen Roß einherreitet und der allein aufgrund der göttlichen Gnade und der Reinheit seines Blutes berechtigt ist, irdische Macht auszuüben. Daß eine solche Vorstellungswelt heutzutage überholt ist, steht außer Frage.
Wie wenig Machiavelli besagte altmodische Sichtweise teilt, wird deutlich, wenn man sein wohl berühmtestes und umstrittenstes Buch liest. Er verwendet darin zwar den Begriff "Fürst", die Heiligkeit seines Blutes oder ein Gottesgnadentum steht für ihn aber überhaupt nicht zur Debatte. Für Machiavelli ist ein Fürst lediglich ein Machthaber. Wie im nächsten Kapitel gezeigt wird, kann er sowohl seine Macht geerbt haben, also ein Monarch sein; er kann aber durchaus auch aus dem Stande eines einfachen Bürgers zur Herrschaft aufgestiegen, also so etwas wie ein Diktator sein. Nicht-adeliges Blut hindert Machiavelli keineswegs daran, jemanden als Fürsten anzusehen, es zählt lediglich die Macht, die er innehat. Machiavelli bezeichnet also mit dem Begriff des Fürsten eigentlich den Alleinherrscher - oder, um Hans Kelsens Begriff zu verwenden: den Autokraten.
Als Illustration der Tatsache, wie wenig Machiavelli die Heiligkeit des Blutes und ähnliches als Voraussetzung für einen Fürsten ansieht, mag die aus seiner Feder stammende Lebensbeschreibung eines ihm als vorbildlich erscheinenden Fürsten, des Castruccio Castracani aus Lucca, dienen. Dieser Mann war nach Machiavellis Angaben ein Findelkind, wurde aber durch seine persönliche Tüchtigkeit Herr über die Stadt Lucca. Machiavelli bezeichnet ihn klar als "Fürst".
Es muß in diesem Zusammenhang gesagt werden, daß sich in Machiavellis Begriff von einem Fürsten längst die politische Realität des damaligen Italien widerspiegelt. "Gottesgnadentum war hier schon lang am Ende. Es wurde nur noch von außen durch die Opponenten herangetragen, die Italien zum Kampfplatz ihrer Interessen machten..."
Trotzdem erkennt man an Machiavellis Verwendung des Begriffs des Fürsten die Modernität seines Denken.
2. Realistische Politikbetrachtung
Die "Machiavellische Ermächtigung"
Machiavelli gilt der Politikwissenschaft als Vater der realistischen Betrachtung von Politik. Zuvor dominierte der normative Ansatz: Es wurde viel darüber geschrieben, wie Politik sein sollte, d.h. welchen moralischen Ansprüchen ein Politiker oder ein Staat zu entsprechen hätte.
Dies war ein beliebtes Thema der Schriften des Mittelalters, in denen politische Macht natürlich vor allem in Bezug zur christlichen Religion gesetzt und beurteilt wurde. Thomas von Aquino, der berühmte Kirchenlehrer, meint z.B., daß das Leben nach der - natürlich christlich verstandenen - Tugend das Endziel menschlicher Gemeinschaft sei.
Aber auch die Schriften des Humanismus beschreiben ideale Zustände der Politik. Noch Machiavellis Zeitgenosse Thomas Morus verfaßt ein Werk namens "Utopia", in dem ein idealer Staat beschrieben wird. Machiavelli verwirft dieses Paradigma aber gründlich und vollständig.
"Da es aber meine Absicht ist, etwas Nützliches für den zu schreiben, der es versteht, schien es mir angemessener, der Wirklichkeit der Dinge nachzugehen als den bloßen Vorstellungen über sie. Viele haben sich Republiken oder Fürstentümer vorgestellt, die nie jemand gesehen oder tatsächlich gekannt hat; denn es liegt eine so große Entfernung zwischen dem Leben, wie es ist, und dem Leben, wie es sein sollte, daß derjenige, welcher das, was geschieht, unbeachtet läßt zugunsten dessen, was geschehen sollte, dadurch eher seinen Untergang als seine Erhaltung betreibt; denn ein Mensch, der sich in jeder Hinsicht zum Guten bekennen will, muß zugrunde gehen inmitten von so viel anderen, die nicht gut sind. Daher muß ein Fürst, wenn er sich behaupten will, die Fähigkeit erlernen, nicht gut zu sein, und diese anwenden oder nicht anwenden, je nach dem Gebot der Notwendigkeit."
Ich halte dieses Zitat, obwohl es von Machiavelli an eine eher unauffällige Stelle seines Traktates gesetzt wurde, für ein zentrales Argument des "Fürsten" wie für sein gesamtes Werk. In dieser Passage stecken mehrere wichtige Gedanken.
1.) Machiavelli will die Politik beschreiben, wie sie ist, nicht wie sie sein soll. Werke, in denen irgendwelche niemals existierende Staaten beschrieben werden, hält er für wertlose Luftschlösser.
2.) Er verwehrt sich auch gegen das Moralisieren bei der Politikbetrachtung. Es ist seiner Meinung nach gar nicht möglich für einen Politiker, sich immer moralisch korrekt zu verhalten. Denn im schmutzigen Feld der Politik wird allgemein unmoralisch gehandelt; der Staatsmann ist umgeben von vielen Konkurrenten, die sich nicht unbedingt an moralische Gebote gebunden fühlen. Ist er aber nun der einzige Ehrliche inmitten lauter Lügner, der einzige Treue inmitten lauter Vertragsbrüchiger, der einzige Pazifist inmitten lauter Gewaltmenschen, wird er sich nicht auf Dauer behaupten können - genausowenig wie das einzige unschuldige Lamm inmitten eines Wolfsrudels lange überleben könnte. Machiavelli erlaubt also seinem Fürsten in gewissen Situationen unmoralisches Handeln - ich möchte diese oben zitierte Textstelle, die mir so zentral für sein Werk erscheint, die "Machiavellische Ermächtigung" nennen.
3.) Das heißt allerdings nicht, daß Machiavelli - und das ist ein häufiges Mißverständnis! - dem blinden und sinnlosen Wüten des Tyrannen eine Generalabsolution erteilt. Machiavelli meint also nicht, daß ein Fürst immer lügen muß oder soll. Er schreibt ausdrücklich - siehe oben -, ein Fürst muß die Fähigkeit nicht gut zu handeln erlernen und "diese anwenden oder nicht anwenden, je nach dem Gebot der Notwendigkeit." Er kann sie also auch nicht anwenden - und wenn er sie anwendet, darf er es nur nach dem Gebot der Notwendigkeit (necessità).
Es gibt also Situationen, in denen der Fürst unmoralisch handeln muß, will er nicht untergehen; sein unmoralisches Handeln ist aber nur in diesen Situationen gerechtfertigt. Mit "Notwendigkeit" ist vor allem - dies erschließt sich meiner Meinung nach aus dem Textzusammenhang - "Notwendigkeit für die Selbstbehauptung" gemeint. Die "Machiavellische Ermächtigung", gilt also nur unter der Grundvoraussetzung, daß von ihr Gebrauch gemacht wird, wenn es für die Selbsterhaltung notwendig ist. Die Handlungen eines Caligula, der die Menschen seiner Umgebung nach Lust und Laune tötete, ohne daß dies seiner Selbstbehauptung in irgendeiner Form zugute kam, ist also durch Machiavellis Schriften keinesfalls abgedeckt.
Ich werde im Teil III der vorliegenden Arbeit die These vertreten, daß Machiavelli seine Ermächtigung zu unmoralischem Handeln in seinen weiteren Texten noch auf drei weitere Arten einschränkt.
Der unbewaffnete Prophet
Ein Beispiel für einen Fürsten, der in der grausamen Welt gerade deshalb unterging, weil er ausschließlich moralisch handelte, war für Machiavelli der Bruder Girolamo Savonarola, der zu seinem warnenden Symbol für das wurde, was Machiavelli den "unbewaffneten Propheten" nennt. Er führt im Kapitel VI des "Fürsten" aus, wie schwierig es ist, selbst die besten Neuerungen einzuführen. Denn wer erneuert, macht sich alle zum Feind, die aus der alten Ordnung ihre Vorteile zogen. In all jenen aber, denen die neue Ordnung nützen würde, findet er nur lasche Verteidiger. "Diese Laschheit entsteht teils aus Furcht vor den Gegnern, welche die Gesetze auf ihrer Seite haben, teils aus dem Mißtrauen der Menschen, die erst an die Wahrheit von etwas Neuem glauben, wenn sie damit verläßliche Erfahrungen gemacht haben..."
Machiavelli meint hier also, daß die Menschen, zumindest die meisten, von Natur aus konservativ sind und das Alte, Vertraute eher bewahren wollen. Daher ist es für ihn entscheidend, ob ein Neuerer auf eigenen Füßen steht - und das heißt bei Machiavelli meist, über eine eigene, bewaffnete Macht verfügt - oder nicht. Wenn ein Neuerer nicht auf irgendeine Art Zwang ausüben kann, nimmt es nach Machiavelli mit ihm stets ein schlimmes Ende. "So kommt es, daß alle bewaffneten Propheten gesiegt haben und die unbewaffneten gescheitert sind."
Machiavelli schreibt dem Volk großen Wankelmut zu. Leicht sei es, das Volk zu überzeugen; bei der Überzeugung halten kann man es aber nur, wenn man auch Zwang ausüben kann. Bruder Savonarola, ein Geistlicher und Zeitgenosse Machiavellis, der in Florenz eine Art christlichen Gottesstaat errichten wollte, kläglich daran scheiterte und trotz seiner Rechtschaffenheit und moralischen Integrität schließlich auf dem Scheiterhaufen landete, hatte diesen Umstand verkannt. Er scheiterte trotz oder gerade wegen seiner hohen moralischen Standards.
Er symbolisiert den Moralisten, der an der Realität zugrunde geht, weil er es verabsäumt, nach ihren grausamen Regeln zu spielen. Savonarola hat sich keine bewaffnete Macht geschaffen, mit der er seine Ziele durchsetzen konnte - und er mußte dafür teuer bezahlen.
Negatives Menschenbild
Schon im vorhergehenden Abschnitt ist das negative Menschenbild Machiavellis angeklungen.Besonders ausführlich geht er auf die Natur der Menschen ein, anläßlich der von ihm diskutierten Frage, ob es für einen Fürsten besser sei, geliebt oder gefürchtet zu werden.
Die Antwort, die er gibt, ist, daß man das eine wie das andere sein sollte; da es aber schwerfällt, beides zu vereinigen, ist es nach Machiavelli viel sicherer, gefürchtet als geliebt zu werden, wenn man schon einen Mangel an einem von beidem in Kauf nehmen muß. Er begründet dies v.a. unter Hinweis auf besagtes negatives Menschenbild; so bezeichnet er die Menschen im allgemeinen als "undankbar, wankelmütig, unaufrichtig, heuchlerisch, furchtsam und habgierig." Solange er ihnen Gutes erweist, sind sie ihrem Herrscher völlig ergeben; "sie bieten dir ihr Blut, ihre Habe, ihr Leben und ihre Kinder, wenn - wie ich oben gesagt habe - die Not fern ist; kommt diese dir aber näher, so begehren sie auf."
Daher darf sich ein Fürst nicht völlig auf ihre Versprechungen verlassen, sondern muß andere Vorbereitungen treffen. Die Liebe und Zuneigung der Untergebenen ist auch insoferne eine schlechte Machtbasis, weil sie durch das Band der Dankbarkeit aufrechterhalten wird. Dieses würden die Menschen, meint Machiavelli, aber wegen jedes geringsten Vorteils zerreissen. Ihre Furcht vor Strafen im Falle des Zuwiderhandelns pflegt die Menschen aber nicht so schnell zu verlassen.
Der Fürst muß also jederzeit mit der Schlechtigkeit der Menschen rechnen und seine Handlungen entsprechend darauf einstellen. Machiavellis realistische Politikbetrachtung beinhaltet u.a. ein sehr skeptisches Welt- und Menschenbild. Sein Realismus besteht gerade darin, daß er auch die unangenehmen Seiten der Realität betrachtet, von denen man am liebsten nichts sehen und hören würde.
3. Der Begriff der "virtù"
Anknüpfung an das antike Tugendideal
Verstand man noch im Mittelalter unter "virtus" eine christlich interpretierte Tugendhaftigkeit, ging diese Bedeutung spätestens bei Machiavelli vollkommen verloren. Sein Begriff der "virtù" orientiert sich mehr am weltlicheren Verständnis der "virtus" bzw. "areté" in der Antike, wo beides im Prinzip "Vortrefflichkeit" bedeuteten - Vortefflichkeit sowohl in moralischer Sicht, aber auch in Hinblick auf die praktische Tüchtigkeit im Staat, was den antiken Menschen nicht unbedingt als Widerspruch erschien.
Virtù als "Inbegriff politischer Energie und Kompetenz"
Bei Machiavelli nimmt der Begriff "virtù" eine spezifische Bedeutung an. Nach Münkler hat Machiavelli darin alles zusammengefaßt, was auf der Seite des einzelnen und der Völker vorhanden sein mußte, um das Ziel der Selbsterhaltung des politischen Gemeinwesens erreichen zu können. Alle ethischen und bildungsbürgerlichen Implikationen treten zurück; für Machiavelli ist virtù der Inbegriff all dessen, was geeignet ist, die Lebensfähigkeit und Stabilität des Gemeinwesens zu gewährleisten. Wie sich diese virtù nun im Einzelfall darstellt, war für ihn nicht apriorisch entscheidbar, sondern eine Frage der politischen Situation, in der sich der Staat jeweils befand. Virtù meint also vorrangig politische Tüchtigkeit, die sich in weltlichem Erfolg messen läßt - allein, gänzlich gibt Machiavelli die moralische Dimension des Begriffs auch nicht auf (davon wird später noch die Rede sein).
Weitere Charakteristika des virtù-Begriffs
Der virtù-Begriff ist auf das Diesseits orientiert, auf das Erreichen weltlicher, politischer Ziele. Er ist nicht nur Ausdruck des verstärkten Rückgriffs auf die Antike, sondern darüber hinaus auch Symbol für eine weitere Haupttendenz der Renaissance: die Säkularisierung. In gewisser Weise ist er auch Ausdruck des gesteigerten Selbstvertrauens des neuzeitlichen Individuums - ist doch der mit virtù begabte Einzelmensch souveräner Gestalter seiner politischen Umwelt. Fürsten benötigen virtù zur Selbstbehauptung. Machiavelli gibt dem Begriff aber auch eine gewisse bürgerlich-republikanische Ausdeutung: Auch ein Volk kann virtù besitzen. Ja, zum Erhalt der Republik ist dies sogar notwendig: Muß das Volk doch mit Politik umgehen und die republikanischen Institutionen mit Sinn erfüllen können.
4. Der Begriff der "fortuna"
Politik ist Schicksal
Machiavelli ist ein sehr auf die empirische, greifbare Realität bezogener Denker, der für metaphysische Spekulationen und mystische Religiosität nicht viel übrig hat. Umso erstaunlicher ist es zu sehen, daß er zumindest in einem Punkt seiner Werke Thesen über Dinge aufstellt, die man fast als transzendent bezeichnen könnte. Vielleicht stimmt für ihn, was Schopenhauer einst in Bezug auf den Schicksalsgedanken meinte:
"Der Glaube an eine specielle Vorsehung, oder sonst eine übernatürliche Lenkung der Begebenheiten im individuellen Lebenslauf, ist zu allen Zeiten allgemein beliebt gewesen, und sogar in denkenden, aller Superstition abgeneigten Köpfen findet er sich bisweilen unerschütterlich fest, ja, wohl gar außer allem Zusammenhange mit irgendwelchen bestimmten Dogmen."
Vielleicht ist der Widerspruch nur ein scheinbarer, denn schon Münkler meint, daß die Göttin Fortuna als Inbegriff des Zufalls und Irrtums immer dann in den Vordergrund trat, wenn der Glaube an die alten Götter zu zerfallen drohte. Sie sprang immer dann als Ersatz ein, wo persönliches Schicksal und politische Entwicklungen nicht mehr fraglos als von den Göttern gegeben hingenommen wurden.
Machiavellis "private Religiosität" in diesem Bereich erklärt sich möglicherweise eben aus dem Zusammenbruch des alten Glaubenssystems, das zu seiner Zeit immer fragwürdiger geworden ist.
Machiavelli stellt fest, daß viele seiner Zeitgenossen der Meinung sind, daß das Schicksal alles vorherbestimmt und der Mensch am Laufe der Dinge - selbst bei allen Anstrengungen nichts ändern könne. Er gibt zu, daß er manchmal selbst dieser Ansicht zuneige, jedoch schränkt er ein: "Dennoch halte ich es - um unseren freien Willen nicht auszuschließen - für wahrscheinlich, daß Fortuna, zwar zur Hälfte Herrin über unsere Taten ist, daß sie aber die andere Hälfte oder beinahe so viel unserer Entscheidung überläßt."
Virtù und fortuna
Machiavelli vergleicht Fortuna mit einem jener reißenden Ströme, die, wenn sie im Zorn anschwellen, die Ebenen überfluten, Bäume und Häuser niederreißen und andere große Zerstörungen anrichten; jeder flieht vor ihnen, alles weicht vor ihrer Gewalt zurück, ohne auf irgendeine Art Widerstand leisten zu können. Obwohl diese Fluten, einmal losgebrochen, kaum mehr aufzuhalten sind, haben die Menschen in ruhigeren Zeiten doch die Möglichkeit, Deiche und Dämme bauen, sodaß der Schaden begrenzt bleibt. Ähnlich verhält es sich nach Machiavelli mit Fortuna, denn auch sie wird ihre Macht dort zeigen, wo man nicht die Kraft aufbringt, ihr zu widerstehen, ja, sogar dort ihre zerstörerischen Kräfte hinlenken, wo man ihr nichts entgegenzusetzen hat.
Die Aufgabe des klugen Politikers ist also, schon vorsorglich Dämme und Deiche aufzubauen und Kraft seiner virtù dem Schicksal gewisse Widerstände entgegenzusetzen. Das Schicksal schlägt dort am heftigsten zu, wo man nicht die Kraft hat, ihm zu trotzen; man darf sich ihm gegenüber keine Blößen leisten.
Mit der Lebensbeschreibung des Castruccio Castracani illustriert Machiavelli an einem Fallbeispiel, was er im "Fürsten" theoretisch beschreibt. Castruccio hatte in einer Schlacht die Florentiner besiegt und war auf dem Weg zum Aufbau eines großen italienischen Reiches. Doch ein Moment der Unachtsamkeit kostete ihm das Leben auf eine fast schon banale Art: er erkältete sich, woran er starb. Und so, meint Machiavelli, nahm ihm Fortuna, "Feindin seines Ruhms", das Leben, kurz bevor er seine Pläne verwirklichen konnte. Eine kleine Unachtsamkeit, eine kleine Blöße, die er sich gegeben hatte, war sein Verhängnis - sie lieferte Fortuna die Möglichkeit, zuzuschlagen.
Die Rede, die Castruccio am Sterbebett an sein Mündel hält, handelt entsprechend auch vom Schicksal:
"Wenn ich geglaubt hätte, mein Sohn, daß mir Fortuna inmitten der Lebensbahn den Weg zu jenem Ruhm abschneiden wollte, den ich mir bei so vielen glücklichen Erfolgen versprochen hatte, hätte ich mich weniger angestrengt und dir, wenn auch einen kleineren Staat, so doch auch weniger Feinde und weniger Neid hinterlassen. Denn, zufrieden über die Herrschaft von Lucca und Pisa, hätte ich Pistoia nicht unterworfen und die Florentiner nicht durch so viele Kränkungen aufgebracht; stattdessen hätte ich, beide zu Freunden, wenn schon kein längeres, so doch gewiß ein ruhigeres Leben geführt und dir den Staat zwar kleiner, hingegen zweifellos sicherer und gefestigter hinterlassen. Aber Fortuna, die Schiedsrichterin über alle menschlichen Dinge sein will, schenkte mir nicht soviel Einsicht, daß ich das gleich erkennen konnte, noch soviel Zeit, daß ich sie hätte niederringen können."
Und dann redet Castruccio noch weiter über Taktiken und Strategien - bis zum Schluß ist er ein Fürst. Gott, das Seelenheil oder ähnliches erwähnt er nicht einmal auf dem Sterbebett, so eine geringe Rolle spielen sie für ihn.
Berücksichtigt man Machiavellis historischen Roman über Castruccio Castracani und viele Passagen aus dem "Fürsten", erscheint Fortuna als eine Art "dea maligna" der Geschichte, die selbst dem Tüchtigsten einen Strich durch die Rechnung macht und Menschen fallen läßt, wenn sie es will.
In gewisser Weise ist es für Machiavelli aber auch möglich, das Glück zu zwingen. "...; denn Fortuna ist ein Weib, und es ist notwendig, wenn man sie niederhalten will, sie zu schlagen und zu stoßen."
Dieses berühmte Zitat von Machiavelli weckt heute, im Zeitalter des Feminismus, viele negative Gefühle - und es wird dazu benutzt, Machiavellis Schriften mit dem Etikett "frauenfeindlich" zu versehen. Und tatsächlich lebte Machiavelli im 16.Jahrhundert, wo man noch andere Vorstellungen vom familiären Zusammenleben hatte als heute. Darum geht es hier aber nicht. Machiavelli wollte mit diesem Zitat vielmehr ausdrücken: Es ist die Aufgabe des Politikers, dem unberechenbaren Schicksal den eigenen Willen durch heldenhafte Taten aufzuzwingen. Insoferne sind virtù des Politikers und fortuna fundamentale Gegensätze in Machiavellis politischer Philosophie.
Daß ein Mann mit großer virtù dem Schicksal Widerstände entgegensetzen oder es gar zwingen kann, ist eine Sache. Andererseits sind virtù und fortuna für Machiavelli auch wieder nur bedingt Gegensätze. Denn es zeigt sich nach Machiavelli oft, daß Fortuna den jungen, stürmischen, tüchtigen Menschen am meisten zugeneigt ist, die mit größerem Ehrgeiz befehlen. Im deutschen Sprachraum würde man das von Machiavelli Gemeinte als "Glück des Tüchtigen" bezeichnen. Dieses ist für Machiavelli ein wichtiger, nicht zu unterschätzender Faktor. Trotz der Tatsache, daß sowohl Castruccio Castracani, als auch Cesare Borgia das Glück des Tüchtigen nicht hatten (darin liegt ihre Tragik), ist es für Machiavelli klar, daß Glück und Tüchtigkeit eng miteinander zusammenhängen.
Ein Beispiel dafür sind die Römer. In den "Discorsi" untersucht Machiavelli, ob es Glück oder Tüchtigkeit war, das ihnen zum Aufbau eines großen Reiches geholfen hat. Im Gegensatz zu vielen antiken Autoren vertritt Machiavelli die Meinung, daß die herausragendste Leistung der Römer ihre Tüchtigkeit war. Das Glück, welches ihnen zweifellos auch des öfteren hold war, ist für Machiavelli wesentlich das Glück des Tüchtigen.
"Ich bin daher überzeugt, daß alle Fürsten, die wie die Römer zu Werke gingen und die gleiche Tüchtigkeit besäßen wie diese, in dieser Hinsicht auch das gleiche Glück hätten wie die Römer."
Gelegenheit macht Fürsten
Das Glück kann dem Tüchtigen auch insoferne hold sein, als es ihm eine Gelegenheit (occasione) bieten kann, die er wahrnehmen und anhand derer er seine Fähigkeiten unter Beweis stellen kann.
Bei der Betrachtung des Lebens der großen Männer der Vergangenheit kann man nach Machiavelli erkennen, daß sie vom Schicksal oftmals nichts anderes erhielten, als eine Gelegenheit, ihre Fähigkeiten einzusetzen und zu entfalten. Vor allem die Krise betrachtet Machiavelli von ihrer positivsten Seite: als Chance: "So war es notwendig, daß Moses das Volk Israel in Ägypten unterdrückt antraf, damit es, um der Knechtschaft zu entkommen, sich bereit machte, ihm zu folgen. (...) Theseus hätte seine Tüchtigkeit nicht beweisen können, wenn er die Athener nicht verstreut wohnend vorgefunden hätte."
Ein guter Politiker muß die Gelegenheiten erkennen und nützen, die ihm das Schicksal bietet. Das Schicksal wählt zu diesem Zweck solche Männer als Werkzeuge aus und führt sie zur Größe. Auch stellt es, wenn es große Zusammenbrüche herbeiführen will, Männer an die Spitze, die den Zusammenbruch beschleunigen. Männer, die sich ihr in den Weg stellen könnte, so beseitigt Fortuna oder nimmt ihnen jede Möglichkeit, wirksam einzugreifen. Und Machiavelli fährt fort: "Es ist unumstößlich richtig, und die ganze Geschichte bezeugt es, daß die Menschen das Schicksal nur unterstützen, sich ihm aber nicht widersetzen können. Sie können seine Fäden spinnen, nicht aber sie zerreißen. Doch dürfen sie sich nie selber aufgeben. Da sie die Absicht des Schicksals nicht kennen und dieses auf krummen und unbekannten Pfaden wandelt, so sollen sie immer Hoffnung haben und nie sich selber aufgeben, in welcher Lage und welcher Not sie auch sein mögen."
In dieser Stelle der "Discorsi" tendiert Machiavelli wieder stärker zum Schicksalsglauben als in vergleichbaren Passagen im "Fürsten", wenn er es hier als unmöglich bezeichnet, das Schicksal niederzuringen. Seine Philosophie läuft letztlich aber doch darauf hinaus, die Selbsterhaltung und virtù des Einzelmenschen zu begründen - auch gegenüber dem übermächtigen Schicksal.
Die Zeiten ändern sich...
...und andere Zeiten fordern andere Mittel. Niemand war sich darüber so bewußt wie Machiavelli. "Um aber mehr auf Einzelheiten einzugehen, so stelle ich fest, daß man einen Fürsten heute Erfolg haben und morgen untergehen sieht, ohne daß eine Veränderung seines Wesens oder irgendeiner seiner Eigenschaften zu bemerken gewesen wäre. Dies beruht meiner Meinung nach zunächst auf den vorher ausgeführlich erörterten Gründen, daß nämlich ein Fürst, der sich ganz auf das Glück verläßt, untergeht; ferner glaube ich, daß der Glück hat, der seine Handlungen den Zeitumständen anpaßt, und ebenso jener ins Unglück gerät, dessen Handlungsweise nicht den Zeitumständen entspricht. Sieht man doch, daß die Menschen auf verschiedene Weise vorgehen, um das Ziel zu erreichen, das ein jeder vor Augen hat, nämlich Ruhm und Reichtum: der eine verfährt mit Besonnenheit, der andere mit Ungestüm; dieser mit Gewalt, jener mit List; einer mit Geduld, der andere mit deren Gegenteil; so kann jeder auf unterschiedliche Weise an sein Ziel gelangen. Auch beobachtet man, daß von zwei Besonnenen einer sein Ziel erreicht, der andere nicht; dies liegt allein an den Zeitumständen, die mit der betreffenden Handlungsweise übereinstimmen oder nicht."
Und manchmal kommen eben Zeiten, die besonnenes Verhalten ratsam erscheinen lassen, es gibt aber auch Zeiten, in denen das Gegenteil gefragt ist. Das ist auch der Grund, warum manchen das Glück holder ist als anderen: Ihre Methoden sind im Einklang mit dem in einer gewissen Zeit Geforderten. Machiavelli meint, daß einem Menschen das Glück immer hold bliebe, wenn er es verstünde, mit der Zeit zu gehen und seinen Charakter und seine Methoden mit der Zeit zu wandeln. Allerdings ist er sehr skeptisch, ob eine solche Wandlungsfähigkeit und Flexibilität überhaupt möglich ist. Wäre sie aber möglich, schiene sie ein Garant für Erfolg zu sein. Republiken ist es möglich, aufgrund des häufigen Wechsels der Staatsspitze, diesem nötigen Wechsel der Zeiten zu entsprechen. So kann immer ein Mann mit dem Charakter und den Begabungen eingesetzt werden, die gerade gebraucht werden. "Dies ist auch der Grund, warum eine Republik eine längere Lebensdauer und länger Glück hat als eine Alleinherrschaft. Die Republik kann sich bei der verschiedenen Veranlagung ihrer Bürger besser den verschiedenen Zeitverhältnissen anpassen als ein Alleinherrscher. Denn ein Mensch, der an eine bestimmte Art zu handeln gewöhnt ist, ändert sich, wie gesagt, nie und muß, wenn die veränderten Zeitverhältnisse zu seinen Methoden nicht mehr passen, notwendig scheitern."
5. Machiavellis Typologie der Herrschaftsformen
Allgemeines
Machiavelli unterscheidet allgemein zwischen Fürstenherrschaften (Autokratien) und Republiken, wobei er, wie schon gesagt, den ersteren sein Buch vom Fürsten widmet; die Republiken behandelt er in den "Discorsi". Während die Republiken keine weitere systematische Einteilung in verschiedene Typen erfahren, unterscheidet Machiavelli bei den Fürstenherrschaften drei Grundtypen: ererbte, neuerworbene und ein Mittelding zwischen beiden.
Die neuerworbenen Fürstentümer werden erneut in vier Typen aufgegliedert: Man kann durch Tüchtigkeit und eigene Waffen, durch Glück und fremde Waffen, durch Verbrechen und durch die Gunst der Mitbürger die Macht erlangen.
Nicht in der Graphik berücksichtigt wurde die Sonderform der "geistlichen Fürstenherrschaft", über die Machiavelli aber nicht allzuviel schreibt. "Da sie aber höheren Gesetzen unterliegen, an die der menschliche Verstand nicht heranreicht, will ich es unterlassen, von ihnen zu reden; da sie nämlich von Gott geschaffen und erhalten werden, wäre es überheblich und vermessen, darüber Erörterungen anzustellen." Er tut es dann aber trotzdem und schreibt über die weltliche Macht der Kirche und die Methoden diverser Päpste, diese zu erlangen; darauf bin ich im Kapitel über Machiavelli und die Religion schon eingegangen.
Ererbte Fürstenherrschaft
Ererbte Macht stützt sich auf Tradition; diese macht es nach Machiavelli leichter, einen Staat zu regieren. "Genügt es doch, die politischen Einrichtungen der Vorfahren lediglich nicht zu vernachlässigen und sich im übrigen dem Zeitgeschehen anzupassen. Auf diese Weise wird sich auch ein Fürst von durchschnittlichen Fähigkeiten in seinem Staat behaupten,..."
Ein Fürst, der seine Herrschaft ererbt, muß nicht so viel Gewalt anwenden, um sie zu behaupten; wahrscheinlich mit ein Grund, warum die Herrschaft eines Königs weniger blutrünstig ist als die eines Diktators - obwohl beide eigentlich Alleinherrscher sind.
Gemischte Fürstenherrschaft
Wenn der Herrscher eines Landes, das er erbt, einen Krieg führt und ein neues Land erobert, womöglich noch von Teilen des anderen Volkes herbeigerufen, herrscht er über einen Machtkomplex, der zum einen Teil ererbt, zum anderen Teil erworben ist. Machiavelli nennt diese Herrschaftsform "gemischt".
Um die Herrschaft über den neuerworbenen Teil behaupten zu können, empfiehlt Machiavelli vier Maßnahmen:
1.) Verlegung des eigenen Hauptquartiers ins eroberte Gebiet
Dies hat den Vorteil, daß man einerseits schnell über Aufstände informiert ist, andererseits die Bürger einen unmittelbaren Zugang zum Herrscher genießen, was sich für sie vielfach als vorteilhaft herausstellt.
2.) Anlegung von Kolonien
Besatzungen hält Machiavelli für ineffizient. Man macht sich durch sie aufgrund der Einquartierungen verhaßt und außerdem sind sie teuer. Legt man hingegen Kolonien durch eigene Siedler an, schafft man "Inseln" loyaler Bewohner, mit denen man die anderen in Schach hält und das Land dauerhaft sichert.
3.) Schutz der Schwachen
Um ein Land dauerhaft unter seiner Herrschaft zu halten, muß man die bisher Mächtigen schwächen; dies gelingt einerseits mithilfe der eigenen Streitkräfte, andererseits dadurch, daß man die bisherige Opposition, die Unzufriedenen und die Schwachen um sich sammelt und schützt.
4.) Verdrängung aller anderen mächtigen Ausländer
Nach Machiavelli muß man um jeden Preis vermeiden, daß ein anderer mächtiger Ausländer im eroberten Land Fuß faßt - denn sonst erwächst einem bald ein gefährlicher Konkurrent. "Wer bewirkt, daß ein anderer mächtig wird, der richtet sich selbst zugrunde..."
Neuerworbene Fürstenherrschaften
Durch Tüchtigkeit und eigene Waffen erworbene Fürstenherrschaft
Als Beispiele für besondere Tüchtigkeit hebt Machiavelli Persönlichkeiten wie Moses, Kyros, Romulus, Theseus u.a. hervor. Ihnen gilt es nachzueifern, um ihre Größe wenigstens annähernd zu erreichen; Machiavellis Fürst kennt überhaupt die Geschichte und eifert ihren größten Persönlichkeiten nach. Was diese großen politischen Gestalten nach Machiavelli vor allem auszeichnete war, daß sie eigene Truppen aufstellten, die nur ihnen ergeben waren. Auf diese Art schufen sie für ihre Macht ein sicheres Fundament, das sie auch benötigten, um die von ihnen geplanten Neuerungen einzuführen. Letzteres ist nach Machiavelli überhaupt das schwierigste Unterfangen der Politik; sind doch die meisten Menschen seiner Meinung nach meistens konservativ. Dies ist, wie oben besprochen, der Grund, warum nach Machiavelli letztlich nur die bewaffneten Propheten erfolgreich sind; nur sie setzen sich durch.
Durch Glück und fremde Waffen erworbene Fürstenherrschaft
Es gibt in der Politik immer wieder Menschen, denen ihre Macht durch Glück in den Schoß fällt - sie kommen durch die Gunst der Fortuna schnell und ohne sonderliche Mühen zur Macht. Als Beispiele führt Machiavelli Fürsten in Griechenland an, die von den Persern zur Macht erhoben wurden, aber auch Privatleute im alten Rom, die Kaiser wurden aufgrund von Geldgeschenken an die Soldaten. Es zeigt sich nach Machiavelli, daß diese Leute meistens sehr schnell wieder stürzen - Machiavelli bedient sich der Analogie des Baumes, um zu sagen, daß ihrer Macht keine Zeit bleibt, Wurzeln zu schlagen. Wer durch Tüchtigkeit zur Macht kommt, schafft den Aufstieg hingegen, wie oben gesagt, langsam, dafür legt er feste Fundamente für seine Macht.
Dennoch ist es auch für die durch Glück zur Macht gekommenen möglich, die Fundamente nachträglich zu legen; Cesare Borgia dient Machiavelli hierbei als Vorbild. Bald nach seiner Machtergreifung, die er seinem Vater verdankte, tat er alles, um sie zu behaupten. Seine wahrscheinlich wichtigste Erkenntnis bestand nach Machiavelli darin, daß er sich eigene Truppen aufbauen mußte, um nicht länger von "fremden Waffen", seien es ausländische Truppen oder Söldner abhängig zu sein. Interessant ist, daß Machiavelli die Armee als eine Art Verlängerung des eigenen politischen Willens begreift. Es ist auffallend, daß Machiavelli in den entsprechenden Kapitelüberschriften "Tüchtigkeit" und "eigene Waffen" sowie "Glück" und "fremde Waffen" jeweils in einen Zusammenhang bringt: So sehr ist er überzeugt, daß ein Fürst die Abhängigkeit vom Schicksal nur überwinden kann, wenn er sich eigene Truppen schafft, auf die er wirklich zählen kann, anstatt von fremder Gunst abhängig sein zu müssen. Mit dieser Erkenntnis verband sich für Machiavelli zeitlebens die Forderung nach einer umfassenden Heeresreform in seiner Heimatstadt.
Besonders mit den Söldnern geht Machiavelli hart ins Gericht: "Wer nämlich seine Herrschaft auf Söldner stützt, wird niemals einen festen und sicheren Stand haben; denn sie sind uneinig, herrschsüchtig, undiszipliniert und treulos; mutig unter Freunden und feige vor dem Feind; ohne Furcht vor Gott und ohne Treue gegenüber Menschen; du schiebst deinen Untergang nur so lange auf, wie du den Angriff aufschiebst; im Frieden wirst du von ihnen ausgeplündert und im Krieg vom Feind." Welche Motivation hätten auch die von Zeit zu Zeit angeheuerten Söldner, ihr Leben zu riskieren für ein wenig Geld? Der Aufbau einer Armee von kampfmotivierten Bürgern schien Machiavelli daher vordringlich - in seinen Schriften wie in seiner praktischen politischen Tätigkeit.
Durch Verbrechen erworbene Fürstenherrschaft
Von den durch Tüchtigkeit und denen durch Glück erworbenen Herrschaften unterscheidet er Machterlangung durch Verbrechen. An dieser Stelle, die im dritten Teil noch ausführlich besprochen werden soll, zeigt sich, daß Machiavelli durchaus einen Unterschied zwischen Machterwerb durch "Tüchtigkeit" und "Verbrechen" zieht; woraus sich wiederum ergibt, daß sich sein politisches Denken nicht gänzlich von jeder moralischen Vorstellung verabschiedet hat.
Durch die Gunst der Mitbürger erworbene Fürstenherrschaft
Auch durch die Gunst der Mitbürger kann ein Fürst zur Macht aufsteigen; diese Fürstenherrschaft ähnelt schon teilweise der Republik. Die beste Voraussetzung dafür ist "eine vom Glück begünstigte Schläue". Man kann hier wieder zwei Möglichkeiten unterscheiden: Entweder man wird von den "Großen" ins Amt gehoben oder von den "kleinen Leuten", dem Volk. Zwischen beiden besteht nach Machiavelli ein großer, moralischer Unterschied: "Denn in jeder Stadt finden sich diese zwei unterschiedlichen Gesinnungen, was daher rührt, daß sich das Volk von den Großen weder beherrschen noch unterdrücken lassen will, die Großen aber das Volk beherrschen und unterdrücken wollen." Entsprechend sind auch die Motive, warum sie einen Fürsten zur Macht bringen, verschieden: Die Großen wollen von ihm die Absicherung ihrer Macht, das Volk will Schutz vor der Macht der Großen.
Machiavelli läßt keinen Zweifel, daß er mit dem Volk mehr sympathisiert und seine Anliegen für gerechter hält. Aber auch aus pragmatischen Gründen rät er dem Fürsten, sich auf die Seite des Volkes zu stellen - selbst, wenn er durch die Großen zur Macht gekommen ist. Wer durch die Großen zur Macht gekommen ist, hat Schwierigkeiten, sich zu behaupten; denn diese betrachten sich als gleich mit dem Fürsten und sind weniger bereit, ihm zu gehorchen. Ihre Wünsche, die unmoralisch sind, können auch nicht befriedigt werden, ohne daß Ungerechtigkeiten begangen werden. Wer durch das Volk zur Macht gelangt, hat weniger Konkurrenten; auch muß ein Fürst immer mit seinem Volk zusammenleben, ohne dieselben Großen kann er aber sehr gut auskommen. Selbst, wer durch die Großen zur Macht gekommen ist, sollte sich also aus ganz egoistischen Gründen mit dem Volk verbünden, meint unser Florentiner.
Diese Ausführungen, die ein Plädoyer an den Fürsten darstellen, bedingungslos die Partei des Volkes zu ergreifen, sind auch ein Beweis für Machiavellis zutiefst republikanische Gesinnung. Die Rücksichtnahme auf das Volk empfiehlt sich für ihn schon allein deshalb, damit dem Gemeinwesen Stabilität verliehen wird.
6. Der revolutionäre Fürstenspiegel
Die Bombe im Gebetbuch
Seit dem Mittelalter gibt es die Tradition der sogenannten Fürstenspiegel. Humanistische Autoren der frühen Neuzeit (wie z.B. Erasmus von Rotterdam) setzten diese Tradition fort. Die Fürstenspiegel waren Bücher, die, wie der Name schon sagt, an den Fürsten gerichtet waren und den idealen Fürsten beschrieben. Dabei wurde den Herrschern tugendhaftes Verhalten nahegelegt; besagte Bücher dienten zur moralischen Belehrung und Erbauung.
Machiavelli schließt scheinbar an diese Tradition an, wenn er auch ein Buch vom Fürsten schreibt. Diese Anknüpfung ist allerdings nur eine rein formale; inhaltlich hätte man aber nicht ärger mit der bestehenden Tradition brechen können, als es Machiavelli tat. Denn statt seinen idealen Fürsten als Abbild hehrer Tugend darzustellen, sind die Qualitäten seines Fürsten hauptsächlich von der Art, daß er durch sie zur Selbstbehauptung im Machtkampf der Politik befähigt wird. Machiavellis "Fürst" wird so, wie es oft heißt, zu einer "Bombe im Gebetbuch".
Der Politiker als Tiermensch
Daß Achill der Sage nach vom Zentauren Chiron unterrichtet wurde, sieht Machiavelli als ein tiefgründiges Symbol. Die Alten hätten dadurch, daß sie dem großen politischen Anführer der Griechen ein Wesen, das halb Mensch, halb Tier ist, zum Lehrmeister gaben, zu verstehen gegeben, "daß ein Fürst beide Naturen annehmen können muß und daß die eine ohne die andere nicht von Dauer ist." Dies ist vor allem so zu verstehen, daß sich ein Fürst - von Fall zu Fall - auch der Waffe des Tieres, nämlich der Gewalt, bedienen können muß.
Machiavelli, dies ist typisch für sein Denken in Analogien und Bildern, führt in seinem "Fürst" auch an, welche Tiere sich der Politiker seiner Meinung nach zum Vorbild nehmen soll: Löwe und Fuchs; "denn der Löwe ist wehrlos gegen die Schlingen und der Fuchs gegen Wölfe. Man muß also ein Fuchs sein, um die Schlingen zu erkennen und ein Löwe, um die Wölfe zu schrecken. Diejenigen, welche sich einfach auf die Natur des Löwen festlegen, verstehen hiervon nichts." Löwe und Fuchs sind stark und schlau; oder negativ ausgedrückt: gewalttätig und gerissen. Beide Eigenschaften sind nach Machiavelli Grundbedingung für Erfolg in der Politik. Die darstellende Kunst der folgenden Jahrhunderte hat Machiavellis Löwe und Fuchs übrigens übernommen und zu Attributen des zugleich faszinierenden und gefährlichen Machtpolitikers verarbeitet.
Machiavellis Fürst ist also eine Art Tiermensch, ein mit Verstand begabtes Raubtier, eine hochintelligente Bestie. Und er muß es auch sein, um sich im Machtkampf effizient behaupten zu können.
Die Kunst der Tarnung
Ein weiteres Tier, das Machiavelli nicht erwähnt, wäre wohl ebenfalls geeignet, den von ihm beschriebenen Fürsten zu charakterisieren: das Chamäleon. Denn für Machiavelli ist klar, daß ein Politiker, der sich behaupten will, die Kunst der Lüge, Täuschung und Verstellung, kurzum, die Tarnung seiner wahren Absichten und Persönlichkeit, perfekt beherrschen muß. Seine Ansichten zur Frage, inwieweit Fürsten ihr Wort halten müssen, spricht für sich selbst:
"Wie löblich es für einen Fürsten ist, sein Wort zu halten und aufrichtig statt hinterlistig zu sein, versteht ein jeder; gleichwohl zeigt die Erfahrung unserer Tage, daß diejenigen Fürsten Großes vollbracht haben, die auf ihr gegebenes Wort wenig Wert gelegt und sich darauf verstanden haben, mit List die Menschen zu hintergehen; und schließlich haben sie sich gegen diejenigen durchgesetzt, welche auf die Redlichkeit gebaut hatten. (...) Ein kluger Herrscher kann und darf daher sein Wort nicht halten, wenn ihm dies zum Nachteil gereicht und wenn die Gründe fortgefallen sind, die ihn veranlaßt hatten, sein Versprechen zu geben. Wären alle Menschen gut, dann wäre diese Regel schlecht; da sie aber schlecht sind und ihr Wort dir gegenüber nicht halten würde, brauchst auch du dein Wort ihnen gegenüber nicht zu halten. Auch hat es noch nie einem Fürsten an rechtmäßigen Gründen gefehlt, um seinen Wortbruch zu verschleiern."
Als Beispiel dafür nennt Machiavelli Papst Alexander VI., der nach seiner Einschätzung nie etwas anderes tat, als die Menschen zu täuschen. Es gab, meint er, noch nie einen Menschen, der mit größerer Eindringlichkeit Versicherungen abgegeben, mit heiligeren Eiden Versprechen gemacht und sie weniger gehalten hätte; dennoch war er mit seinen Betrügereien stets erfolgreich.
Ein Fürst muß nach Machiavelli zu jeder Zeit "milde, treu, menschlich, aufrichtig und fromm" erscheinen und es auch sein; allerdings muß er "geistig darauf vorbereitet sein, dies alles, sobald man es nicht mehr sein darf, in sein Gegenteil verkehren zu können". Und er begründet dies ganz pragmatisch damit, daß ein Fürst, besonders ein neu zur Macht gekommener, nicht all das befolgen kann, dessentwegen die Menschen für gut gehalten werden - weil dies seiner Selbstbehauptung schaden würde.
Verstellung sei zudem ganz einfach - erfaßt doch die große Masse der Menschen mehr den Schein als das Sein eines Politikers. Und läßt sich vom Erfolg eines Fürsten mitreißen, egal auf welchem Wege dieser zustande kommt.
Letztendlich handelt es sich bei Machiavellis Rechtfertigungen für Lüge, Täuschung und Verstellung in der Politik um Modifikationen der zuvor besprochenen "Machiavellischen Ermächtigung". Der Politiker darf Abmachungen brechen und lügen, denn die anderen tun es auch; täte er es als einziger nicht, wäre seine Fähigkeit zur Selbstbehauptung massiv eingeschränkt. Derjenige, der täuscht und sich verstellt, siegt in Praxis über den Redlichen, so wie Alexander VI. über seine Gegner. Daher wird der, welcher von diesen Mitteln nicht Gebrauch macht, untergehen.
Es ließe sich noch viel sagen über Machiavellis Ratschläge für den Fürsten: So rät er ihm z.B., ständig große Projekte in Angriff zu nehmen, um das Volk wie die Mächtigen seines Landes ständig in Spannung zu halten und zu beschäftigen. Oder er sagt sinngemäß, der Fürst solle, so lange er sich auf dem Weg zur Macht befindet, großzügig, ja verschwenderisch mit seinem Geld und seinen Gunstbeweisen umgehen; sobald er aber zur Macht gekommen ist, muß er sparsam mit seinem und der Bürger Geld sein; Großzügigkeit ist ihm von diesem Zeitpunkt an nur mehr mit dem Geld der anderen (also letztlich mit der Beute aus seinen Feldzügen) erlaubt. Aber ich denke, es wird schon jetzt klar, worauf Machiavellis "revolutionärer Fürstenspiegel" hinausläuft: Er entwirft technisches Handlungswissen zu Machterwerb und Machterhalt und legitimiert durch seine "Machiavellische Ermächtigung" unter gewissen Voraussetzungen die Unmoral. Die in diesem Kapitel zitierten Passagen sind übrigens die am heftigsten kritisierten Teile von Machiavellis Werk.
Ich möchte im Teil III der vorliegenden Arbeit allerdings die Meinung vertreten, daß Machiavelli seine eben zitierten, vor Unmoral strotzenden Handlungsmaximen für den Fürsten im Laufe seiner weiteren Texte auf mehrerlei, genauer gesagt, auf dreifache Art und Weise einschränkt, obwohl das, was ich zuvor "Machiavellische Ermächtigung" nannte, in seinem ganzen Werk prinzipiell Gültigkeit behält. Die ausschließliche Konzentration auf die in diesem Kapitel erwähnten Textstellen wäre aber einseitig, weil Machiavelli schließlich doch Mittel und Wege findet, moralisches Handeln gegenüber der Unmoral zu legitimieren - ohne dabei allerdings seinen realistischen Ansatz von Politik oder andere Grundvoraussetzungen seines Denkens zu verlassen.

Teil III
Machiavellis "Drei-Schranken-Theorie"
Über Agathokles
Oder: Das Konzept des Ruhmes
Machiavelli behandelt in Kapitel VIII des "Fürsten" den Erwerb der Herrschaft durch Verbrechen. Er nennt in diesem Zusammenhang Agathokles, der es in der Antike vom einfachen Privatmann zum Tyrann von Syrakus brachte. Sein Aufstieg erfolgte über eine militärische Karriere, in deren Verlauf der aus niederem Stande stammende Agathokles viel Tüchtigkeit bewies. Eines Tages nutzte er die Gunst der Stunde und griff in einem gewaltsamen, verbrecherischen Putsch erfolgreich nach der Macht.
Machiavelli lobt, fast bewundernd, die politische Tatkraft dieses Mannes, der u.a. auch erfolgreich gegen die Übermacht der Karthager kämpfte und nennt ihn hinsichtlich seiner Fähigkeiten in einem Atemzug mit den erfolgreichsten und begabtesten Politikern der Geschichte. Doch dann macht Machiavelli eine ganz "unmachiavellistische", sehr überraschende Einschränkung zu diesem Lob.
"Andererseits kann man es auch nicht Tüchtigkeit nennen, seine Mitbürger umzubringen, seine Freunde zu verraten und ohne Treue, Mitleid oder Religion zu sein; auf solche Weise kann man zwar Macht erwerben, aber keinen Ruhm. Wenn man aber die Tüchtigkeit betrachtet, mit der Agathokles sich in Gefahr begab und wieder daraus hervorging, und die Seelengröße, mit der er Widrigkeiten ertrug und überwand, dann läßt sich nicht einsehen, warum er geringer einzuschätzen ist als irgendein anderer hervorragender Feldherr; dennoch erlauben seine brutalen Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten mitsamt seinen unzähligen Verbrechen nicht, ihn als einen unter den hervorragendsten Männern zu preisen."
Machiavelli unterscheidet hier also eindeutig zwischen Tüchtigkeit (virtù) und Verbrechen. Zu große Unmoral schränkt die virtù - trotz des Erfolgs - ein, ja schafft sie in gewisser Weise ab. Man sieht allein an der oben zitierten Textstelle, daß es verfehlt ist, Machiavellis Konzept der virtù als reine politische Schlagkraft ohne moralische Schranken oder gar reine Machtgier zu betrachten. Virtù ist für Machiavelli sicherlich, wie oben besprochen, politische Tüchtigkeit, die hauptsächlich weltlich verstanden wird und sich auch in weltlichem Erfolg messen läßt. Aber: Wenn diese Tüchtigkeit sich im Zusammenhang mit äußerst schweren Verbrechen äußert, kann man sie nicht mehr Tüchtigkeit nennen.
Dabei scheint es mir, als ob für Machiavelli erst ein gewisser unerträglicher Grad an moralischen Verfehlungen die virtù einschränkt - dies wäre eine plausible Auflösung des eigentlichen Widerspruchs, daß Machiavelli dem Fürsten zwar gewisse Tugendverstöße in anderen Stellen durchaus erlaubt und ihm trotzdem "virtù" zuspricht (bei Cesare Borgia ist dies z.B. der Fall), in der Stelle über Agathokles aber plötzlich virtù und Verbrechen in einen unbedingten Gegensatz zueinander bringt. Obwohl ich weiß, daß es eine gewagte Interpretation ist, verstehe ich Machiavelli hier sinngemäß so: Unter gewissen Umständen mögen Moralverstöße in der Politik erlaubt und mit Tüchtigkeit vereinbar sein. Wenn es ein Politiker aber, um es salopp zu sagen, zu arg treibt, indem er Massenmorde, Deportationen, Verrätereien, Brutalitäten und andere Unmenschlichkeiten aneinanderreiht, er also eine gewisse Grenze überschreitet, wird ihm niemand mehr Tüchtigkeit zusprechen. Er wird daher auf diese Art vielleicht sogar Erfolg haben in dem Sinne, daß er Macht gewinnt - ein weiteres erstrebenswertes Gut bleibt ihm aber vorenthalten: der Ruhm.
In gewisser Weise liegt in dieser Stelle über Agathokles noch ein Widerspruch zu anderen Kapiteln des "Fürsten", meint Machiavelli doch auch, die Masse würde bei der Bewertung eines Fürsten nur auf den Erfolg sehen, wie dieser zustande gekommen ist, sei egal. Und jetzt auf einmal soll Unmoral (zumindest ab einer gewissen Größe) dem Ruhm abträglich sein? Eine Inkonsequenz unseres Florentiners? Vielleicht. Der Widerspruch läßt sich aber mit der Interpretation lösen, daß Machiavelli im Ruhm wahrscheinlich eher etwas Dauerhaftes versteht, also etwa nicht den momentanen Jubel der zusammengelaufenen Menge, sondern die Bewunderung der Nachwelt.
Wie dem auch sei, auf jeden Fall gilt die Feststellung Kerstings über die Agathokles-Stelle:
"Machiavelli knüpft mit den Moralisten seiner Zeit an den altrömischen Ruhmesgedanken an, bejaht ausnahmslos den Ruhm als erstrebenswertes Gut und erkennt die cupido gloriae als militärisches und politisches Handlungsmotiv an." Es gibt also auch "für Machiavelli in der Politik Handlungs- und Verhaltensweisen, die eindeutig unrühmlich, schändlich und verabscheuungswürdig sind. Sein Konzept des Ruhmes besitzt ein stark normatives Element; in ihm sind wesentliche Wertvorstellungen der klassischen Politik aufbewahrt".
Machiavelli rettet also einen Teil der "traditionellen" Moral, indem er sie - wenigstens zum Teil in sein Konzept des Ruhmes aufgehen läßt. Wenn ein Politiker also nach dauerhaftem Ruhm strebt - und Machiavelli hält es offenbar in Anknüpfung an das antike Denken für natürlich, daß einem Politiker sein Ansehen bei der Nachwelt nicht vollkommen egal ist - sollte er von zu argen Moralverstößen absehen. In gewisser Weise setzt Machiavelli mit dem Konzept des Ruhmes der Unmoral in der Politik eine Grenze. Daß die Agathokles-Stelle nicht ein einmaliger "Ausrutscher" Machiavellis ist, beweist, daß es auch in anderen Werken Machiavellis vergleichbare Abschnitte gibt. So heißt es z.B. in den "Discorsi": "Für jeden, der die Macht in einer Stadt oder in einem Staat erobert hat, ist es das beste Mittel, sich an der Macht zu halten, wenn er gleich von Anfang an alles im Staat von Grund auf neu gestaltet; er muß eine neue Regierung mit neuen Titeln, mit neuen Machtbefugnissen und neuen Personen bilden, er muß die Armen reich machen, wie es David getan hat, als er König wurde. Er muß neue Städte bauen, die alten zerstören, die Einwohner von einem Ort an den anderen versetzen, kurz, er darf nichts im Land unangetastet lassen, damit es keinen Rang, keinen Stand und keinen Reichtum gibt, den der Besitzer nicht ihm zu verdanken hat. Zu seinem Vorbild muß er sich Philipp von Makedonien, den Vater Alexanders, nehmen (...) Sein Biograph sagte, daß er die Menschen von Land zu Land getrieben habe wie Hirten ihre Herde. Diese Mittel sind grausam und lebensfeindlich. Nicht nur als Christ, sondern auch aus Menschlichkeit sollte sie jeder meiden und lieber als unbekannter Bürger leben denn als König zum Verderben so vieler Menschen."
Man sieht an diesem Zitat, daß Machiavelli durchaus nicht nur eine Vorstellung von ethischem Verhalten hat, sondern dieses auch vielfach empfiehlt. Sein Ansatz besitzt allerdings einige Besonderheiten, auf die in weiterer Folge noch eingegangen werden soll.
Machiavelli -
ein Verantwortungsethiker?
Oder: Der Zweck heiligt die Mittel
Gesinnungs- und Verantwortungsethik nach Max Weber
"Wir müssen uns klar machen, daß alles ethisch orientierte Handeln unter zwei voneinander grundverschiedenen, unaustragbar gegensätzlichen Maximen stehen kann: es kann ‘gesinnungsethisch’ oder ‘verantwortungsethisch’ orientiert sein. Nicht daß Gesinnungsethik mit Verantwortungslosigkeit und Verantwortungsethik mit Gesinnungslosigkeit identisch wäre. Davon ist natürlich keine Rede. Aber es ist ein abgrundtiefer Gegensatz, ob man unter der gesinnungsethischen Maxime handelt - religiös geredet -: ‘der Christ tut recht und stellt den Erfolg Gott anheim’, oder unter der verantwortungsethischen: daß man für die (voraussehbaren) Folgen seines Handelns aufzukommen hat."
Nach Max Weber, dem berühmten deutschen Soziologen und Verfasser auch philosophisch relevanter Werke, kann man ethische Positionen aller Art in zwei unterschiedlichen Tyopologien erfassen: der Gesinnungs- und Verantwortungs- bzw. Handlungsethik. Im Falle der Gesinnungsethik handelt es sich um eine ethische Position, bei der, wie der Name schon sagt, eine Person nur in Übereinstimmung mit ihrer Gesinnung handelt. Der Gesinnungsethiker zieht die Folgen einer Handlung bei der Beurteilung von Moral nicht in Betracht. Auch der Nutzen einer Handlung wird außer acht gelassen. Relevant ist für ihn nur, daß die Handlung aus einer bestimmten ethisch-moralischen Vorstellung, also aus der richtigen Gesinnung heraus entsprungen ist.
"Sie mögen einem überzeugten gesinnungsethischen Syndikalisten noch so überzeugend darlegen: daß die Folge seines Tuns die Steigerung der Chancen der Reaktion, gesteigerte Bedrückung seiner Klasse, Hemmung ihres Aufstiegs sein werden, - und es wird auf ihn gar keinen Eindruck machen. Wenn die Folgen einer aus reiner Gesinnung fließenden Handlung üble sind, so gilt ihm nicht der Handelnde, sondern die Welt dafür verantwortlich, die Dummheit der anderen Menschen oder - der Wille Gottes, der sie so schuf."
Der Verantwortungsethiker dagegen denkt anders. Er rechnet mit den "durchschnittlichen Defekten der Menschen". Er will die Verantwortung für die Folgen seines Tuns nicht auf andere abwälzen. Er berücksichtigt die Folgen seiner Handlungen und versucht, durch rationales Abwägen der Mittel seine Ziele und Ideen kompromißhaft zu verwirklichen.
Der Hauptunterschied zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik offenbart sich aber in der verschiedenen Beantwortung einer Frage: ob der Zweck die Mittel heiligt. Ist es also erlaubt auch einmal gegen moralische Normen zu verstoßen, wenn es langfristig einem moralischen Zweck dient? Oder umgekehrt: Muß man sich selbst an die moralischen Normen halten, wenn dadurch eine unmoralische Folge gefördert wird?
Nun könnte man freilich die Meinung vertreten, daß aus Gutem nur Gutes folgen kann und daher niemals aus einer guten Tat sich moralisch schlechte Folgen ergeben könnten oder aus einer schlechten Tat moralisch gute. Max Weber würde darauf allerdings antworten: "Dann existierte freilich diese ganze Problematik nicht. Aber es ist doch erstaunlich, daß 2500 Jahre nach den Upanischaden eine solche These noch das Licht der Welt erblicken kann. Nicht nur der ganze Verlauf der Weltgeschichte, sondern jede rückhaltlose Prüfung der Alltagserfahrung sagt ja das Gegenteil. (...) Wer das nicht sieht, ist in der Tat politisch ein Kind." Ein Beispiel, das mir spontan dazu einfällt, ist der Tyrannenmord. Mord ist ein Verbrechen, ein Verstoß gegen jede Gesinnung des Friedens, der Gewaltlosigkeit etc. Aber die Ermordung des Tyrannen kann einem ganzen Volk die Freiheit bringen, dazu Millionen Menschenleben retten, die im nächsten Krieg oder in der nächsten Säuberungsaktion umkommen würden. Kann eine schlechte Tat aber durch die moralisch guten Folgen gerechtfertigt werden, also der Zweck die Mittel heiligen? Ich persönlich würde - mit Cicero - in einem solchen Fall dafür plädieren. Die Katholische Kirche - eher gesinnungsethisch ausgerichtet - ist freilich in diesem Punkt anderer Meinung und würde dem Tyrannenmord entsprechend skeptisch gegenüberstehen.
Welche Antworten geben Gesinnungs- und Verantwortungsethik auf die Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt? Die Gesinnungsethik muß diese Frage - da sie Folgen, Nutzen bei der Beurteilung von Moral außer acht läßt - konsequent verneinen. Eine ethisch verwerfliche Handlung wird abgelehnt, auch wenn sie im Endeffekt ethisch gerechtfertigte Folgen hat bzw. zur Erreichung von guten Zielen dient. Die Verantwortungsethik, die die (vorhersehbaren) Folgen in Betracht zieht, ist hier freilich anderer Meinung. In bestimmten Situationen kann man, sagt sie, gegen ethische Vorstellungen verstoßen - hier muß aber jeder einzelne eine Entscheidung treffen und die Verantwortung für sein Tun tragen; er soll seine Handlungen und Entscheidungen vor sich selbst und vor anderen rechtfertigen können.
Machiavelli und die Verantwortungsethik
Machiavelli ist ganz sicher kein Gesinnungsethiker, eher ein Schreckensbild für einen solchen. Sein Fürst ist wahrlich kein Muster für Gesinnungstreue. Milde, Barmherzigkeit etc. als Gesinnung soll der Fürst nach Machiavelli bei jeder sich bietenden Gelegenheit vorspielen; wenn es aber aus pragmatischen, machtpolitischen Gründen ratsam erscheint, soll er nicht wirklich danach handeln.
Es fällt nicht sehr schwer, dies durch einschlägige Zitate zu belegen.
"Für einen Fürsten ist es also nicht wirklich erforderlich, alle oben genannten guten Eigenschaften wirklich zu besitzen, wohl aber den Anschein zu erwecken, sie zu besitzen. Ich wage gar zu behaupten, daß sie schädlich sind, wenn man sie besitzt und ihnen stets treu bleibt; daß sie aber nützlich sind, wenn man sie nur zu besitzen scheint; so mußt du mild, treu, menschlich, aufrichtig sowie fromm scheinen und es auch sein; aber du mußt geistig darauf vorbereitet sein, dies alles, sobald man es nicht mehr sein darf, in sein Gegenteil verkehren zu können. Man muß nämlich einsehen, daß ein Fürst, zumal ein neu zur Macht gekommener, nicht all das befolgen kann, dessentwegen die Menschen für gut gehalten werden, da er oft gezwungen ist - um seine Herrschaft zu behaupten -, gegen die Treue, die Barmherzigkeit, die Menschlichkeit und die Religion zu verstoßen. Daher muß er eine Gesinnung haben, aufgrund deren er bereit ist, sich nach dem Wind des Glücks und dem Wechsel der Umstände zu drehen und - wie ich oben gesagt habe - vom Guten so lange nicht abzulassen, wie es möglich ist, aber sich zum Bösen zu wenden, sobald es nötig ist."
Die Frage, die sich nun stellt ist die, ob Machiavelli ein Verantwortungsethiker ist. Zunächst offenbar nicht. Denn die Begründung, warum ein Politiker wenigstens von Zeit zur Zeit gegen die Moral verstoßen muß, hört sich eigentlich sehr pragmatisch-egostisch an: z.B. um nicht zugrunde zu gehen. So heißt es auch: "...denn ein Mensch, der sich in jeder Hinsicht zum Guten bekennen will, muß zugrunde gehen inmitten von so viel anderen, die nicht gut sind."
Moralisches Handeln wird bei Machiavelli also zunächst deshalb relativiert, weil es der Selbstbehauptung schadet. Dies allein wäre aber keine verantwortungsethische Position; denn Verantwortungsethik erlaubt ja nicht unmoralische Mittel im Namen eines egoistischen Zwecks, sondern im Namen eines moralischen Zwecks.
Dann aber tauchen bei Machiavelli immer wieder Zitate auf, die eine Interpretation als Verantwortungsethik im Sinne Webers zulassen. So beschäftigt er sich in seinem Traktat "Der Fürst" mit der Grausamkeit und der Milde. Er meint dazu: "Indem ich zu den übrigen der obengenannten Eigenschaften komme, sage ich, daß jeder Fürst danach trachten muß, für milde und nicht für grausam gehalten zu werden; doch muß er sich vorsehen, keinen falschen Gebrauch von der Milde zu machen. Cesare Borgia galt als grausam; nichtsdestoweniger hat er durch seine Grausamkeit die Romagna geordnet und geeint sowie dort Frieden und Ergebenheit wiederhergestellt. Bei genauer Betrachtung wird man feststellen, daß er so viel mehr Milde besaß als das Volk von Florenz, das - um dem Ruf der Grausamkeit zu entgehen - zuließ, daß Pistoia zerstört wurde. Einen Fürsten darf es daher nicht kümmern, der Grausamkeit bezichtigt zu werden, wenn er dadurch bei seinen Untertanen Einigkeit und Ergebenheit aufrechterhält; er erweist sich als milder, wenn er nur ganz wenige Exempel statuiert als diejenigen, die aus zu großer Milde Mißstände einreißen lassen, woraus Mord und Raub entstehen; denn hierdurch wird gewöhnlich einem ganzen Gemeinwesen Gewalt angetan, während die Exekutionen auf Befehl des Fürsten nur gegen einzelne Gewalt üben."
Man kann also nach Machiavelli einen falschen Gebrauch von Tugend (hier von der Milde) machen. Dieser falsche Gebrauch liegt dann vor, wenn diese Milde langfristig zu mehr Grausamkeiten führt - etwa durch Zerrüttung der öffentlichen Ordnung -, als wenn man die politische Ordnung auch um den Preis der Grausamkeit herstellt. So argumentiert eigentlich ein Weberscher Verantwortungsethiker, für den der Zweck die Mittel heiligt. Wenn hartes, vielleicht grausames Durchgreifen gute Folgen hat, ist es für Machiavelli gerechtfertigt, ja sogar unbedingt angebracht. Man sieht an der vorliegenden Textstelle aber nicht nur, daß für Machiavelli der gute Zweck die Mittel heiligt, sondern auch, was er als den obersten politischen Zweck ansieht, nämlich die "Gründung und Stabilisierung des Staates."
Zusammenfassend möchte ich also feststellen, daß Machiavelli sicherlich kein Gesinnungsethiker ist. Auf den ersten Blick ist er auch kein Verantwortungsethiker, weil er in vielen Stellen seines Werkes den Einsatz unmoralischer Mittel nicht durch moralische Zwecke legitimiert, sondern mit simplen pragmatischen, machtpolitischen Argumenten. In anderen Stellen seines Werkes nähert er sich aber einer Verantwortungsethik an, weil er den Einsatz unmoralischer Mittel explizit durch moralische Zwecke rechtfertigt, wobei der oberste Zweck für Machiavelli die Gründung und Stabilisierung eines Staatswesens ist. Diese Einstellung nennt Friedrich Meinecke "Staatsräson", als deren "Entdecker" er Machiavelli sieht. Sehr schön illustriert wird diese neue Grundhaltung mit dem berühmten Zitat Machiavellis aus der Florentiner Geschichte, in der er denen höchste Anerkennung zollt, die das Vaterland höherschätzen als ihr Seelenheil. In eine prägnantere Formel könnte man Machiavellis Verantwortungsethik gar nicht bringen.
Die taktische Selbst-
beschränkung der Politik
Oder: Moral als langfristiger Egoismus?
Es gibt noch andere Argumente Machiavellis als die bisher angeführten, die zu moralischem Handeln raten; in ihnen scheint Machiavelli eine Art taktische Selbstbeschränkung der Politik anzudeuten.
Menschenrechte als Staatsräson?
Ich habe schon oben angedeutet, daß in Machiavellis "Fürst" Überlegungen angestellt werden, die in vielem in die Nähe einer Forderung nach grundlegenden Menschenrechten kommen. So empfiehlt Machiavelli seinem Fürst, daß er sich nicht am Eigentum und den Frauen seiner Bürger vergreifen soll, weil er sich sonst so verhaßt machen würde, daß seine Herrschaft bald zu Ende wäre. Auch ist der Schutz des Eigentums, das hat Machiavelli schon erkannt, eine Voraussetzung für wirtschaftliche Prosperität eines Staates, die ja auch politische Macht nach sich zieht. Die Förderung der Tüchtigen jedes Faches, auch z.B. der Wissenschaft, empfiehlt er aus ähnlichen Gründen.
Natürlich wäre die These, Machiavelli sei der Begründer eines Menschenrechtsbegriffes im heutigen Sinne, ohne zusätzliche Ausführungen und mancherlei größere Einschränkungen nicht haltbar. Machiavelli besitzt einen ausschließlich instrumentellen Zugang zur Politik. Normative Forderungen, die von außen an die Politik herangetragen werden, sind ihm, wie schon an zahllosen Stellen ausgeführt, im wesentlichen fremd. John Locke sollte lange nach Machiavellis Zeit einmal die Ansicht vertreten, einem jeden Menschen kämen gewisse angeborene, unveräußerliche Rechte zu, die keineswegs nur gelten, damit andere politische Zwecke erfüllt werden, sondern die selbst Zweck der Politik sind (der den Staat begründende Gesellschaftsvertrag wird nach Locke ja nur abgeschlossen, um besagte natürliche Rechte effizient zu schützen, wobei Locke vor allem das Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum in den Vordergrund stellt).
Eine solche Vorstellung entfaltet Machiavelli natürlich nicht. Er hat allerdings erkannt, daß es für die Stabilität und Machtentfaltung einer politischen Gemeinschaft von Vorteil wäre, wenn jedem Bürger gewisse grundlegenden Rechte zukämen (wie oben gesagt, z.B. der Schutz seines Eigentums). Diese grundlegenden Rechte, und dies sei nochmals betont, würden bei Machiavelli (anders als bei Locke) aber nicht um ihrer selbst willen gelten. Sie wären für ihn vielmehr notwendig, um die oben genannten politischen Ziele zu erreichen. Man könnte auch sagen: Was für Machiavelli ein Mittel ist, wird für Locke ein Zweck.
Man kann Machiavellis Ansicht zu diesem Aspekt dahingehend zusammenfassen, daß seine politische Theorie der Politik gewisse Verhaltensbeschränkungen auferlegt. Diese Verhaltensbeschränkungen schließen ein, gewisse Rechte der Bürger zu respektieren. Man mag freilich kritisieren, daß diese Selbstbeschränkung der Politik für Machiavelli nur ihr langfristiger Egoismus ist, wobei man aber nicht übersehen darf, daß Hobbes’ Philosophie uns lehrt, daß sich ein Modell eines langfristig gedachten Egoismus durchaus zur Moralbegründung eignet.
Bei aller trotzdem möglichen Kritik an unserem Florentiner halte ich es dennoch für beachtlich, daß ein Denker des frühen 16.Jahrhunderts in die Nähe eines Menschenrechtsbegriffes gelangte - egal, auf welchem Weg -, noch dazu, wenn dieser Denker vielen bis heute als Inbegriff des Bösen gilt. Und auch heute kann ein Anhänger einer von allen politischen Zwecken enthobenen und selbst zum obersten politischen Zweck gewordenen Menschenrechtsidee von Machiavelli lernen, welche Vorteile es der Stabilität und Machtentfaltung eines Staates bringt, wenn diese edle Idee umgesetzt wird.
Moralisches Handeln - manchmal ein Weg zum Erfolg?
Machiavellis "idealer" Fürst hat kein falsches Mitleid; von Gewissensbissen ist er auch nicht unbedingt geplagt. Machiavelli hat nur Hohn und Spott übrig für Idealisten wie Savonarola, die es vor lauter Moralismus unterließen, geeignete Maßnahmen zur Festigung ihrer eigenen Macht zu schaffen. Voll Verachtung blickt er auch auf die Florentiner, die aus übertriebener Milde heraus dabei versagten, Ordnung in der Romagna herzustellen, weil sie es aus moralischen Skrupeln heraus nicht fertigbrachten, die alte unruhestiftende Herrschaftsclique zu beseitigen. Stattdessen bewundert Machiavelli Cesare Borgia, der mit diesen kurzen Prozeß machte, dazu bei jeder sich bietenden Gelegenheit ohne Bedenken log, betrog, sowie Hinterhalte und Intrigen ausheckte.
Dennoch scheint Machiavelli der Meinung zu sein, daß in gewissen Fällen ein Politiker andere Menschen durch Taten für sich einnehmen kann, die von Menschlichkeit oder Großmut zeugen. Daß man Menschen, die man einmal beleidigt hat, selbst durch neue Wohltaten nicht zu gewinnen vermag, weil diese viel zu nachtragend sind, bleibt zwar ebenso ein unverrückbares Dogma Machiavellis wie seine Ansicht, daß die Menschen einen Politiker in erster Linie nach seinem Erfolg beurteilen und nicht nach moralischen Gesichtspunkten. Die Möglichkeiten der Gewinnung von Menschen durch moralisches Handeln ist also eng begrenzt. Dennoch führt Machiavelli in seinen Discorsi mehrere Beispiele aus der römischen Geschichte an, wo dies funktionierte. Eines handelt vom römischen Feldherrn Camillus, der eine Stadt des Volksstammes der Falisker belagerte. Bei ihm sprach ein Schulmeister vor, der die vornehmsten Kinder der Stadtbewohner unter einem Vorwand aus der Stadt gelockt hatte und sie an die Römer ausliefern wollte. Mit ihnen als Geiseln, meinte er, könnten die Römer die Stadt in die Hände bekommen. Camillus ließ den Verräter entkleiden, ihm die Arme auf den Rücken binden und wies die Knaben an, ihn in die Stadt zurückzutreiben. Die Stadtbewohner waren von seinem hochherzigen Verhalten so gerührt, daß sie sich ergaben.
"Aus dieser wahren Begebenheit sieht man, daß manchmal ein Akt der Menschlichkeit und Güte mehr über die Gemüter der Menschen vermag als eine grausame, gewalttätige Handlung, und wie oft Länder und Städte, die durch Waffen, Kriegsmaschinen und andere von Menschen ersonnene Gewaltmittel nicht bezwungen werden konnten, durch einen Akt der Menschlichkeit und Güte, der Zurückhaltung oder des Großmuts bezwungen wurden."
Und Machiavelli nennt noch andere Beispiele dafür: Pyrrhus war so gerührt vom Hinweis seiner Feinde, der Römer, daß sein Leibarzt ihnen die Vergiftung seines Königs angeboten hatte, daß er sich zurückzog. Und Scipio erwarb sich viel Ruhm, als er eine junge, schöne Frau, die unter seiner Obhut stand, unberührt ihrem Gatten zurückgab. Man muß nach Machiavelli aber folgendes bedenken: Hannibal war grausam, tückisch, brutal, lüstern. Dennoch war er im höchsten Maße angesehen. Machiavelli erklärt dies damit, daß letztendlich doch die - von der Moral weitgehend unabhängige - Tüchtigkeit eines Politikers das wesentlichste Kriterium für die Menschen ist, wenn sie über ihre Zuneigung entscheiden. Die Wirkung moralischen Verhaltens auf die Menschen zu überschätzen wäre also verhängnisvoll; diese Wirkung existiert allerdings - und vielleicht kann man sie nützen.
Nur ein gerechter Friedensvertrag ist von Dauer
Daß in der Politik Verträge gebrochen werden, sobald sich für einen der beiden Vertragsschließenden Vorteile daraus ergeben oder die bisherige Regelung für einen zu große Nachteile bringt, war Machiavelli klar. Dennoch gibt es dauerhaftere und weniger dauerhafte Verträge; und über ihre Dauer entscheidet zumeist, ob ein wahrer Interessensausgleich gefunden wurde oder nicht. Es empfiehlt sich nach Machiavelli also für einen Sieger beim Abschluß von Friedensverträgen große Nachsicht, Milde und Gerechtigkeit. Er erzählt in diesem Zusammenhang eine weitere Episode aus der römischen Geschichte: Der römische Senat mußte über das Schicksal eines besiegten Volkes, der Privernaten, entscheiden. Als man den Gesandten der Besiegten fragte, welche Strafe sein Volk seiner Meinung nach verdiente, entgegnete dieser: Eine Strafe, die Männer verdienen, die sich der Freiheit würdig fühlen. Danach fragte ihn der Senat, was man von einem Friedensvertrag erwarten durfte, wenn man einen solchen unter Erlassung der Strafe abschließt; und der Gesandte antwortete: Wenn ihr uns einen guten gebt, einen zuverlässigen und beständigen; wenn ihr uns einen schlechten gebt, einen kurzen. Der Senat war von dieser mutigen Entgegnung so angetan, daß er den Privernaten nicht nur die Strafe erließ, sondern auch das römische Bürgerrecht verlieh - also sich für eine großzügige Friedensregelung gegenüber ehemaligen Feinden entschied. Machiavelli legt jedem Politiker in den "Discorsi" nahe: Entweder muß man seine besiegten Feinde umbringen. Wenn dies aber nicht zweckmäßig oder durchführbar ist, soll eine gerechte, großzügige, von Milde und Verzeihung geprägte Regelung gefunden werden. Der größte Fehler ist es, einem besiegten Volk zur Strafe einen ihm unerträglichen Vertrag mit quälenden Bedingungen zu diktieren - der nächste Krieg ist hierbei vorprogrammiert. Wenn man also nicht so böse sein kann oder will, sich zu einem Genozid durchzuringen, soll man eben gut und gerecht handeln - aus ganz pragmatischen Gründen.
Die Forderung nach dem Rechtsstaat
Auch Machiavelli - hier erinnern seine Ansichten fast ein wenig an Konfuzius - weiß um die Bedeutung der Beispielwirkung des Politikers. "Denn ich glaube nicht, daß man in einem Staat ein schlechteres Beispiel geben kann, als ein Gesetz zu erlassen und es nicht zu beachten; das schlimmste aber ist, wenn der Gesetzgeber selber es nicht einhält." Savonarola, Machiavellis liebster Prügelknabe, hat diesen Fehler angeblich begangen. Verhalten sich die Politiker gesetzlos, kostet sie dies viel Achtung und ihr negatives Verhalten hat Beispielwirkung. Außerdem löst das Fehlen von Rechtssicherheit Angst bei den Bürgern aus, wohl weil der Staat dadurch unberechenbar und unzuverlässig wird. "Man sieht daraus, wie schädlich es für einen Freistaat oder einen Alleinherrscher ist, die Gemüter der Untertanen durch fortwährende Strafen oder Kränkungen in Unruhe und Furcht zu halten. Ohne Zweifel läßt sich kein verderblicheres Verfahren denken; denn fürchten die Menschen erst für ihr Leben, so suchen sie sich auf jede Weise vor der Gefahr zu sichern. Sie werden kühner und scheuen sich weniger, Umwälzungen zu versuchen." Für die Herstellung politischer Stabilität ist also ein Rechtsstaat unerläßlich.
Unrecht muß in einem Staat auch bestraft werden; denn bleibt es von der Obrigkeit ungesühnt, wird der Beleidigte und Verletzte auf Rache sinnen - was wiederum die politische Stabilität und auch das Leben des Machthabers selbst gefährdet. Als Beispiel nennt Machiavelli zwei Vorfälle aus der Antike: Einmal verstießen römische Gesandte gegen das Völkerrecht und verletzten dadurch die Gallier. Als sich diese beschwerten, wurde ihre Klage nicht gehört; stattdessen wurden die Gesandten noch befördert. Die Gallier erklärten daraufhin Rom den Krieg und eroberten es mit Ausnahme des Capitols. Das andere Beispiel ist für Machiavelli die Ermordung von Philipp von Makedonien, des Vaters Alexander des Großen, die ein gewisser Pausanias durchführte. Dieser junge Mann war ursprünglich von Attalos, einem Mann aus des Königs Umgebung, vergewaltigt und öffentlich gedemütigt worden. Er führte Klage beim König, wurde allerdings nicht gehört. Vielmehr schützte Philipp den Verbrecher, ja, beförderte ihn sogar. Darauf ermordete der Gekränkte den König. Nach Machiavelli muß Unrecht, das einem Bürger zugefügt wurde, auch bestraft werden, um der Stabilität eines Staates sowie der Sicherheit der Machthaber willen. "Ist jemand vom Staat oder von einem Privatmann schwer beleidigt worden und erhält er keine befriedigende Genugtuung, so sucht er, wenn er in einem Freistaat lebt, sich zu rächen, selbst wenn der Staat darüber zugrunde geht. Lebt er unter der Herrschaft eines Machthabers, so wird er, wenn er nur einiges Ehrgefühl besitzt, nicht eher ruhen, als bis er sich auf irgendeine Weise an ihm gerächt hat und sollte er dabei auch in sein eigenes Verderben rennen."
Für die Einsetzung unabhängiger Gerichte findet Machiavelli auch ein wesentliches Argument: Er erzählt von Frankreich und der dort herrschenden Rivalität zwischen den Großen und dem Volk; und vom König, der zwischen diesen Fronten stand, indem er Streitfälle schlichten und Entscheidungen treffen mußte. Um sich nicht bei den rivalisierenden Gruppen unbeliebt zu machen, setzte er ein unabhängiges Gericht ein, "das die Großen züchtigen und die Kleinen begünstigen sollte, ohne dem König Vorwürfe einzutragen". Überhaupt sei es, meint Machiavelli, sehr schlau, wenn ein Fürst die Durchführung unliebsamer Maßnahmen anderen überträgt, sich selbst aber die Erteilung von Gunstbeweisen vorbehält. Ein Regierender, der zugleich richtet, macht sich immer bei einer Partei unbeliebt. Es ist auch aus der Perspektive der Machthaber gut, diese Unbeliebtheit und ihre Nachteile zu meiden und unabhängige Gerichte einzusetzen.
Zwei Arten der Moralbegründung in der Tradition
Ich habe oben festgestellt, daß Machiavelli, der angeblich so böse Machiavelli, letztlich für politische Einrichtungen plädiert, die man, was ihr Ergebnis betrifft, von einem ganz alltäglichen, intuitiven Standpunkt aus als moralisch bezeichnen würde. Er entwickelt eine Art Menschenrechtsbegriff, indem er fordert, der Bürger müsse von gewissen Übergriffen der Staatsgewalt geschützt werden (Unverletzlichkeit des Eigentums). Er fordert ferner, daß Friedensverträge, wenn sie schon abgeschlossen werden, milde und gerecht gegenüber dem Besiegten sein sollen. Er will einen Staat, der für den Bürger berechenbar ist, weil sein Handeln an Gesetze gebunden ist; er lobt die Einrichtung von unabhängigen Gerichtshöfen und meint, jeder Bürger sollte das Recht haben, vor einem Gericht zu klagen, wenn ihm Unrecht geschehen ist. Wir würden solche von Machiavelli gewollten Einrichtungen wahrscheinlich als "Rechtsstaat" bezeichnen. Nimmt man Machiavellis im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit genanntes Bekenntnis zur Republik hinzu, die er der Alleinherrschaft für überlegen hält und das ebenfalls bereits behandelte, von ihm entwickelte politische Konzept, daß sich Republiken zu engen, festgefügten Allianzen und Bündnissystemen aller Art zusammenschließen können und sollen, stellt sich angesichts eines solchen politischen Programmes mehr denn je die Frage, warum Machiavelli von vielen eigentlich noch immer als Apostel der Unmoral angesehen wird. Im Laufe der vorliegenden Arbeit habe ich manche Erklärungen dafür abgegeben, z.B. die Ächtung durch die Kirche seit der Frühen Neuzeit, die fälschliche Einvernahme durch die Faschisten und, auch dies stellte ich fest, die unausgewogene Rezeptionsgeschichte, die dazu führte, daß der von den Monarchien handelnde "Fürst" weltberühmt wurde, hingegen Machiavellis wichtigeres, besseres und von den Republiken handelnde Buch, die "Discorsi", bis heute eigentlich kaum gelesen werden, was für ein umfassendes Verständnis seines politischen Denkens aber eigentlich notwendig wäre. All die angeführten Gründe sind richtig; allein sind sie aber noch nicht hinreichend.
Wesentlich ist vor allem, auf welche Art Machiavelli all die zuvor genannten moralischen Einrichtungen begründet: durch letztlich pragmatische Argumente. Man darf nicht vergessen, daß die schon oben besprochene "Machiavellische Ermächtigung", die besagt, der Politiker dürfe aus Gründen der politischen Notwendigkeit unmoralisch handeln, in seinen Schriften zu jeder Zeit prinzipiell Gültigkeit besitzt. Aber Machiavelli entwickelt ein Konzept von Moral, das davon ausgeht, daß Moral so etwas wie "langfristiger Egoismus der Politik" ist.
Ein konkretes Beispiel: "Kurzfristiger Egoismus" der dem Bürger übergeordneten politischen Instanzen (etwa einer Regierung, egal welcher Staatsform) bestünde darin, den Bürgern ihren Besitz nach Lust und Laune wegzunehmen. Wenn dem Regierungschef z.B. das Haus eines Bürgers gefällt, könnte er es ihm einfach rauben, um selbst darin zu wohnen. Oder wenn das Geschäft des Bürgers gutgeht, hätte er die Macht, ihn zu enteignen und den Laden an irgendwelche Günstlinge weiterzuschenken. Wenn eine Regierung dies aber tut bzw. zuläßt, wird sich im betreffenden Staat niemals eine prosperierende Wirtschaft entfalten können, weil die Rahmenbedingungen dafür zu ungünstig sind. Dies wiederum schadet der Stabilität und der Macht des Gemeinwesens. Daher ist eine Regierung gut beraten, das Eigentum der Bürger unverletzt zu lassen - dies ist "langfristiger Egoismus der Politik". Ein anderes Beispiel: Ein König könnte seine Macht nutzen, um die Frauen seiner Bürger nach Herzenslust zu vergewaltigen. Geht man von seiner großen Triebhaftigkeit aus, hätte er zweifellos ein "kurzfristig" egoistisches Interesse daran. Wenn er es aber tut, wird er sich durch die Entehrung ganzer Familien bald überall verhaßt machen. Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis ein Attentäter ihn zur Strecke bringt; und nicht einmal eine riesige Armee könnte ihn langfristig davor schützen. Es kann nur in seinem "langfristigen" egoistischen Interesse liegen, die Frauen unangetastet zu lassen. Oder: Ein Staat besiegt einen anderen und diktiert diesem einen Friedensvertrag. Wenn dieser wirklich auf Dauer gelten und nicht wenige Jahre später mit großem Aufwand gleich ein neuer Krieg gekämpft werden soll, ist es für die Siegermacht empfehlenswert, sich aus freien Stücken auf eine milde und faire Regelung zu beschränken.
Man kommt Machiavellis Ansicht vielleicht näher, wenn man sich vor Augen hält, daß sich in der Geschichte der politischen Philosophie zwei unterschiedliche Modelle der Moralbegründung unterscheiden lassen (siehe nächste Seite).
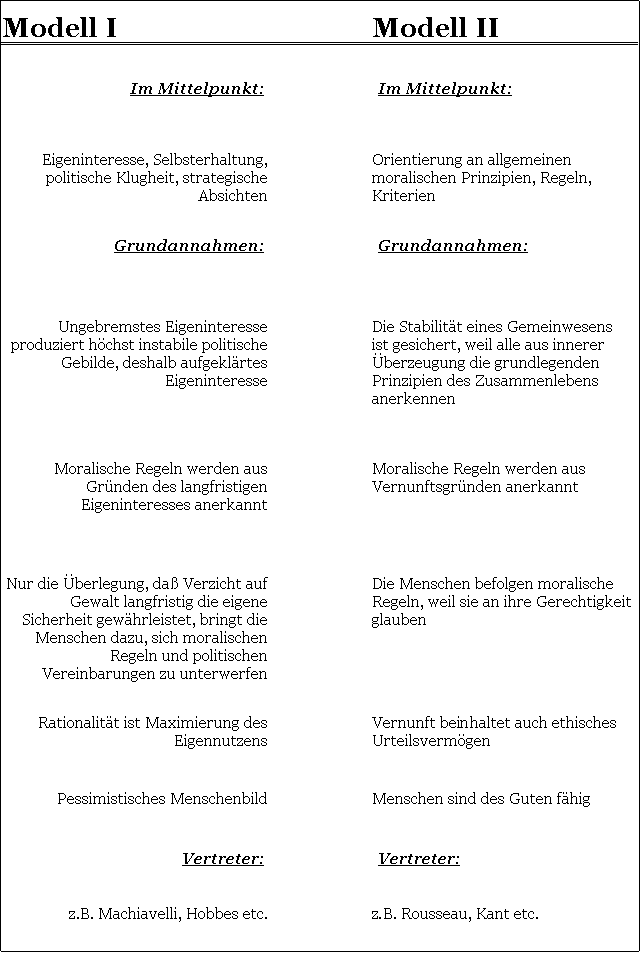
Machiavelli ist, wie schon aus der Tabelle ersichtlich, zweifellos ein Vertreter des ersteren Modells, was eine weitere Gemeinsamkeit zu Hobbes darstellt (man kann diesen Hinweis auch als Nachtrag zu dem entsprechenden Kapitel in Teil I verstehen). Unser Florentiner entwickelt auf die vorhin dargestellte Art ein neuartiges Bild von Moralität, das wahrscheinlich in seinem Wesen mißverstanden wurde - was auch zur Verdammung Machiavellis beitrug. Für Machiavelli liegt die Begründung politischer Moral im "langfristigen Egoismus der Politik". Kurzfristiger Egoismus produziert instabile politische Gebilde; im Namen der Selbstbehauptung des Politikers wie der Stabilität des Staatswesens kann es immer wieder angebracht sein, wenn die Politik sich insoferne gewisse Selbstbeschränkungen auferlegt.
So findet Machiavelli eine Rechtfertigung für Menschenrechte und Rechtsstaat, für Republik und internationale Allianzen: Sie liegen im langfristigen Eigeninteresse, sowohl der Staaten, der herrschenden Politiker als auch des Volkes. Anhänger des in der Tabelle beschriebenen zweiten Modells mögen diese Art der Begründung zwar als unzureichend empfinden; bei unvoreingenommener Betrachtung kann sich Machiavellis Zugang aber als vorteilhaft erweisen. Kann man mit einem solchen Modell nicht realistischerweise mehr Menschen von ethischem Handeln oder von der Sinnhaftigkeit von Republik und Rechtsstaat überzeugen als mit hehren moralischen Betrachtungen? Und außerdem: Schließen die beiden skizzierten Modelle einander wirklich aus? Immerhin könnten sie sich ergänzen.
Auf jeden Fall baut Machiavelli der Unmoral in der Politik eine weitere Schranke in seinem Werk auf: indem er ausführt, wie schädlich dort "kurzfristige" Egoismen sein können.
Machiavellis "Drei-Schranken-Theorie"
Ich möchte ein wichtiges Ergebnis des dritten Teils der vorliegenden Arbeit zusammenfassend hervorheben. Im Teil II der vorliegenden Arbeit wurde in der Besprechung des "Fürsten" herausgearbeitet, daß Machiavelli im Kapitel XV eine Art "Ermächtigung" an den Politiker vergibt, unmoralisch zu handeln (ich nannte sie die "Machiavellische Ermächtigung"). Diese ist, wie im Teil II ausgeführt, nach Machiavelli aus ganz pragmatischen Gründen notwendig: In der Politik, die er wesentlich als Kampf um Macht und Interessen ansieht, geht es in der Regel unmoralisch zu; man kann seiner Meinung nach von einem Politiker schon alleine deshalb nicht verlangen, den moralischen Anforderungen vollends zu genügen, weil dies seine Selbstbehauptung unmöglich machen würde. Oder wie soll sich der einzige Wahrhaftige unter lauter Lügnern, der Ehrliche unter lauter Vertragsbrüchigen, der unbewaffnete Prophet unter lauter bewaffneten Banditen, kurzum, das einzige Lamm unter lauter Wölfen langfristig behaupten können? Da die Verletzung moralischer Normen in der Politik allgemein ist, sagt Machiavelli sinngemäß, ist es doch weltfremd und unrealistisch, von einem Politiker zu verlangen, als einziger diesen Normen zu genügen! Wenn sie allgemein gelten würden, wäre dies vielleicht ein guter Ratschlag - aber angesichts ihrer ununterbrochenen Verletzung in der Praxis... (Diese von Machiavelli entfaltete Argumentation erinnert, nebenbei bemerkt, stark an die oben im Zusammenhang mit Hobbes besprochene Situation des Gefangenendilemmas).
Natürlich soll auch nach Machiavelli ein Politiker moralisch handeln, wenn es ihm möglich ist. Unmoralisches Handeln ist natürlich nur unter der Voraussetzung angebracht, daß es die Notwendigkeit gebietet - gemeint ist wohl, dies geht aus dem Zusammenhang von Kapitel XV des "Fürsten" deutlich hervor, die Notwendigkeit für die Selbstbehauptung des Politikers. Explizit ist für Machiavelli unter der Voraussetzung der Existenz dieser Notwendigkeit das Brechen moralischer Normen zweckmäßig, natürlich und zulässig. Machiavelli gibt also eine Erlaubnis für unmoralisches Handeln in der Politik - unter der Grundvoraussetzung, daß pragmatische Gründe für die Selbstbehauptung des Politikers dies verlangen ("Machiavellische Ermächtigung").
Machiavelli schränkt seine "Ermächtigung" im Laufe seines Werkes aber noch auf drei andere Arten ein, als wäre der Hinweis auf die Voraussetzung der "Notwendigkeit" nicht schon Einschränkung genug. In den Punkten A, B und C des dritten Teils habe ich diese Einschränkungen im Detail angeführt. Es handelt sich dabei um:
A.) Machiavellis Konzept des Ruhmes und seine Annahme, daß der Erwerb von dauerhaftem, historischem Ruhm die Einhaltung oder zumindest die nicht zu exzessive Überschreitung gewisser moralischer Standards nötig macht - wobei er es in Anknüpfung an die Antike offenbar als selbstverständlich annimmt, daß große Politiker eine solche cupido gloriae auch besitzen und es ihnen nicht völlig egal ist, wie es um ihren historischen Nachruhm bestellt ist.
B.) Die Zitate Machiavellis, die seine moralische Ansicht als Verantwortungsethik ausweisen, in denen er die Meinung vertritt, daß der gute Zweck die Mittel heiligt und daher der Einsatz unmoralischer Mittel durch moralische Zwecke gerechtfertigt werden kann. Dabei scheint ihm der für die Politik höchste moralische Zweck in der Schaffung und Erhaltung der Stabilität eines Staatswesens zu liegen. Somit löst sich Machiavelli nicht von jeder Form von Moralität, wie die ursprüngliche Formulierung der "Machiavellischen Ermächtigung" nahelegt, sondern schafft eine alternative Moral zur traditionellen, christlichen Gesinnungsethik.
C.) Auch hält er in manchen Fällen eine taktische Selbstbeschränkung des Politikers für zweckmäßig - durch moralisches Handeln kann man nämlich manchmal doch wichtige politische Ziele umsetzen. Machiavelli entwickelt hierbei, wie oben ausgeführt, noch ein Modell von Moral, das man als "langfristigen Egoismus der Politik" bezeichnen könnte. Diese wird dem kurzsichtigen Egoismus der Politik, der höchst instabile politische Gebilde produziert, gegenübergestellt.
Es wird vielleicht eine Hilfe für das Verständnis von Machiavellis politischem Moralbegriff sein, wenn man seine in den Punkten A, B und C zusammengefaßte Ansicht mit dem Namen "Drei-Schranken-Theorie" bezeichnet; denn er setzt dort seiner eigenen "Machiavellischen Ermächtigung", der seiner Meinung nach erlaubten Unmoral also, besagte drei Schranken - moralisches Handeln wird damit auf dreifache Art gegenüber der Unmoral legitimiert. Natürlich hat Machiavelli niemals den Begriff "Drei-Schranken-Theorie" verwendet; doch ich bin der Meinung, daß man eine solche aus seinen zahllosen Einzelaussagen quasi destillieren kann - was als Interpretationshilfe seiner Schriften dienen mag. Man kann seine moralischen Hinweise für nicht ausreichend oder in ihrer Begründung ungenügend halten (oder auch nicht) - Machiavellis Denken losgelöst von jedweder ethischen Verbindlichkeit zu sehen, ist allerdings nicht haltbar. Es ist nur eben keine ethische Verbindlichkeit im Sinne Kants, sondern eine im Sinne eines "egoistischen" Ansatzes der Moralbegründung.

Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Teile:
Teil I
Hier wird versucht, Machiavelli im geistesgeschichtlichen Kontext einzuordnen. Der Florentiner wird dabei als Denker dargestellt, der die politischen Legitimationstheorien und Denkmuster des Mittelalters radikal ablehnt, um nicht zu sagen, zerschmettert. Während noch für Thomas die menschliche Gemeinschaft auf die christlich verstandene Tugend ausgerichtet war und damit letztlich auf das Seelenheil, interessiert sich Machiavelli vor allem für die "Dauerhaftigkeit, innere Stabilität und äußere Expansionsfähigkeit der staatlichen Gemeinschaft" (Münkler). Machiavelli schafft eine realistische Theorie der Politik, die er aus normativen, christlichen Zusammenhängen löst - ähnlich wie Kopernikus die Naturwissenschaft aus der Umarmung der Religion befreite. Machiavellis starker Rückgriff auf die Antike, seine Verwandlung der Religion in ein Mittel der Politik und sein Lob des Selbstvertrauens, das er an die Stelle des Gottvertrauens setzt, zeigen ihn als überaus modernen Denker.
Machiavelli wird - mit Einschränkungen - auch als Vorläufer von Thomas Hobbes aufgefaßt. Die Einschränkungen sind zweierlei: Erstens wollte Machiavelli im Gegensatz zu Hobbes keine Legitimationstheorie für staatliche Gemeinschaften oder politische Macht entwerfen, sondern schlicht und einfach politische Realitäten erfassen. Zweitens unterscheiden sich die beiden Denker hinsichtlich ihrer Methode: Während Hobbes streng logisch nach der "geometrischen Methode" der Mathematik Ableitungen trifft, versucht Machiavelli seinen Standpunkt vor allem durch bildhafte Analogien und historische Beispiele zu untermauern.
Die Gemeinsamkeiten sind allerdings so zahlreich, daß man sie kaum übersehen kann. Beide lehnen die mittelalterlichen Legitimationstheorien ab, beide vertreten ein ähnlich negatives Menschenbild. Und beide fassen politische Ordnung als etwas künstlich herzustellendes auf, das Chaos allerdings als ursprünglich gegeben. Dies ist ein fundamentaler Unterschied zu der Philosophie des Mittelalters, die, ihrem Wesen nach konservativ, eine bestimmte Ordnung als gott- und naturgegeben ansah. Machiavelli und Hobbes lebten überdies beide in historischen Situationen, die man als krisenhaft bezeichnen kann - so war Hobbes mit dem englischen Bürgerkrieg, Machiavelli mit den Zerrüttungen seiner Heimatstadt Florenz konfrontiert. Dies erklärt u.a. auch ihre Suche nach einer neuen, stabileren politischen Ordnung.
Teil II
Der zweiten Teil liefert im Prinzip ein Kommentar zu den beiden wichtigsten Werken Machiavellis, "Discorsi" und "Fürst". Es wird auf die unterschiedlich verlaufene Rezeptionsgeschichte beider Texte aufmerksam gemacht: Während der "Fürst" allgemein bekannt ist, bleiben die "Discorsi" sogar bis heute weitgehend unbeachtet. Dies führte leider zu einer einseitigen Sichtweise Machiavellis, sind doch gerade die "Discorsi" jenes Buch, in dem er seine republikanische Gesinnung am deutlichsten ausdrückt.
Neben zahlreichen anderen Themen wird besonders Machiavellis Republikbegriff herausgearbeitet. In den "Discorsi" entwirft er das Bild eines Staates, in der das Volk Souverän ist und durch Wahlen die höchsten Staatsämter besetzt. Machiavellis Republik kann sich gegen äußere und innere Feinde aber auch machtpolitisch behaupten und ist somit so etwas wie eine "wehrhafte Demokratie". Machiavelli meint, die Republik sei autokratischen Staatsformen überlegen, sowohl hinsichtlich ihrer höheren Moralität, als auch hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Selbstbehauptung. Machiavellis Konzept, Republiken sollten sich zur weiteren Steigerung dieser Selbstbehauptung zu engen Allianzen zusammenschließen, läßt diesen Denker des 16.Jahrhunderts auch im Zeitalter von NATO und EU aktuell erscheinen.
Machiavellis "Fürst" machte nicht minder Epoche. Der Angelpunkt des ganzen Denkens des Philosophen ist eine berüchtigte Textstelle aus dem Kapitel XV, die ich als "Machiavellische Ermächtigung" bezeichne. Dort stellt Machiavelli fest, daß es einem Politiker nicht immer möglich ist, alle moralische Normen zu erfüllen, weil er sich sonst einfach nicht in der Politik behaupten könnte, in der es eben nicht immer moralisch zugeht. Wie soll sich der einzige Ehrliche unter lauter Lügnern, der einzige Treue unter lauter Vertragsbrüchigen, der unbewaffnete Prophet unter lauter bewaffneten Banditen behaupten können? Der Politiker soll nach Machiavelli moralisch handeln, wenn er es vermag; es kann aber Situationen geben, wo dies realistisch gesehen nicht möglich ist. Wenn die Notwendigkeit (für seine Selbstbehauptung) es verlangt, und nur unter dieser Voraussetzung, darf Machiavellis Politiker gegen moralische Normen verstoßen. Machiavellis "Fürst" bricht radikal mit allen normativen Ansätzen; vielmehr soll erfaßt werden, was die Realität der Politik ausmacht. Doch nicht nur inhaltlich, auch formal läßt der "Fürst" die Traditionen des Mittelalters hinter sich: ist er doch auf den ersten Blick in der Form eines traditionellen, zur Tugend ermahnenden, mittelalterlichen Fürstenspiegels verfaßt. Der explosive Inhalt, der dem Politiker die Lüge und Täuschung oder gar die Gewalt in bestimmten Situationen sogar anempfiehlt, macht das Buch zu einer "Bombe im Gebetbuch" (Kersting) und verhöhnt damit auf fast schon perfide Weise die mittelalterlichen und humanistischen Tugendprediger.
Die beiden fundamentalen Gegensätze der politischen Philosophie Machiavellis sind "virtù" und "fortuna". "Virtù" ist eher weltlich verstandene, politische Kompetenz (wobei zwar nicht jede moralische Dimension fallgelassen, aber doch mithilfe eines Rückgriffs auf die antike Begrifflichkeit stark eingeschränkt wird). "Fortuna" ist das unberechenbare Schicksal, die Allegorie der Willkür und der wechselnden Umstände. Es ist die Aufgabe des Politikers, mithilfe seiner politischen Kompetenz das Schicksal niederzuringen und ihr Stabilität (Machiavellis oberstes politisches Ziel) abzutrotzen.
Teil III
Der dritte Teil der vorliegenden Arbeit stellt den wesentlichsten Fortschritt dar, den diese Arbeit zur Machiavelli-Forschung beizutragen versucht. Die Grundthese lautet, daß Machiavelli seine unter der Voraussetzung der Notwendigkeit für die Selbstbehauptung gültige Ermächtigung zu unmoralischem Handeln im Laufe seines Werkes noch auf drei zusätzliche Arten einschränkt, als wäre der Hinweis auf die "Notwendigkeit" nicht schon Einschränkung genug. Moralisches Handeln wird gegenüber der Unmoral also auf dreifache Weise legitimiert (was ich naheliegenderweise als Machiavellis "Drei-Schranken-Theorie" bezeichnete): 1.) durch ein Konzept des Ruhmes, in dem wesentliche normative Wertvorstellungen aufbewahrt sind, 2.) durch Textstellen, die Machiavellis Philosophie als Verantwortungsethik im Sinne Max Webers ausweisen und 3.) durch ein neuentworfenes ethisches Modell, in dem Moral als langfristiger Egoismus der Politik gesehen wird, der zur Erreichung des Ziels der Vergrößerung der Stabilität gewisse Schranken für die obrigkeitliche Macht setzt. In diesem Zusammenhang plädiert Machiavelli u.a. für rechtsstaatliche Institutionen und entfaltet Überlegungen, die in die Nähe eines Menschenrechtsbegriffes kommen. Machiavelli ist, zumindest was die Endergebnisse seines Denkens anbelangt, moralischer als sein Ruf.

Literatur
Edmond Barincu: Machiavelli mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Hamburg (5.Auflage) 1995.
M.P. Basiliankov: Machiavelli im Management. Erfolg durch Karriere und Bewußtsein. Berlin 1995.
Deborah Baumgold: Hobbes’ political theory. Cambridge 1988.
Dirk Berg-Schlosser, Theo Stammen: Einführung in die Politikwissenschaft. München (6.Auflage) 1995.
Isaiah Berlin: Die Originalität Machiavellis. In: Ders.: Wider das Geläufige. Frankfurt am Main 1981.
David Boucher: The social contract from Hobbes to Rawls. London 1994.
August Buck: Machiavelli. Darmstadt 1985.
James Burnham: Die Machiavellisten. Verteidiger der Freiheit. Zürich 1949.
Vere Chappell: Thomas Hobbes. New York 1992.
Paul Cooke: Hobbes and christianity. New Jersey 1996.
Michael Crawford: Die römische Republik. München (5.Auflage) 1994.
Herbert Butterfield: The statecraft of Machiavelli. Darmstadt 1985.
Frank Deppe: Niccolò Machiavelli. Köln 1987.
Hans-Joachim Diesner: Die politische Welt des Niccolò Machiavelli. Berlin 1992.
Roger Fisher: Jenseits von Machiavelli. Kleines Handbuch der Konfliktlösung. Berlin 1992.
Kurt Flasch: Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin zu Machiavelli. Stuttgart 1988.
Hans Freyer: Machiavelli. Weinheim (2.Auflage) 1986.
Friedrich von Preußen: Der Antimachiavell oder Untersuchung von Machiavellis "Fürst". Leipzig 1991.
Felix Gilbert: Machiaveli und Guicciardini. Politics and History in the Sixteenth Century Florence. New York 1965.
Peter Godman: From Polziano to Machiavelli. Florentine humanism in the high Renaissance. New York 1998.
Werner Goez: Grundzüge der Geschichte Italiens in Mittelalter und Renaissance. Darmstadt 1984.
Bernhard Grimm: Macht und Verantwortung. Ein Anti-Machiavelli für Führungskräfte. Wiesbaden 1996.
Agnes Heller: Der Mensch der Renaissance. Köln 1982.
Karl Heyer: Machiavelli und Ludwig XIV. Stuttgart (3.Auflage) 1991.
Thomas Hobbes: Leviathan. Stuttgart 1996.
Thomas Hobbes: Vom Menschen. Vom Bürger. Hamburg 1959.
Lonnie Johnson: Thomas Hobbes. Wien, Dissertation 1983.
Maurice Joly: Ein Streit in der Hölle. Gespräche zwischen Machiavelli und Montesquieu über Macht und Recht. Frankfurt am Main 1991.
Bernd Jordan, Alexander Lenz: Weltpolitik im 20.Jahrhundert. Lexikon der Ereignisse und Begriffe. Reinbek bei Hamburg 1996.
Hans Kelsen: Vom Wesen und Wert der Demokratie. Tübingen 1929.
Wolfgang Kersting: Niccolò Machiavelli. München 1998.
Wolfgang Kersting: Thomas Hobbes zur Einführung. Hamburg 1992.
Preston King: Thomas Hobbes. Critical assessments. London 1990.
Claudia Knauer: Das "magische Viereck" bei Machiavelli - fortuna, virtù, occasione, necessità. Würzburg 1990.
Leszek Kolakowski: Über die Richtigkeit der Maxime "Der Zweck heiligt die Mittel". In: Ders.: Der Mensch ohne Alternative. München 1946.
Ludwig Kroeber-Keneth: Machiavelli und wir. Der Florentiner in neuer Sicht. Stuttgart 1980.
Jens Kulenkampff: David Hume. München 1989.
Titus Livius: Die Anfänge Roms. München 1991.
John Locke: Über die Regierung. Stuttgart 1996.
Niccolo Machiavelli: Discorsi. Stuttgart 1977.
Niccolo Machiavelli: Der Fürst. Stuttgart 1986.
Niccolo Machiavelli: Geschichte von Florenz. Stuttgart 1986.
Niccolo Machiavelli: Das Leben Castruccio Castracanis aus Lucca. München 1998.
Aloysius Martinich: Hobbes - a biography. Cambridge 1999.
Roger Masters: Fortuna ist ein reißender Fluß. Wie Leonardo da Vinci und Niccolò Machiavelli die Geschichte verändern wollten. München 1999.
Valeriu Marcu: Machiavelli. Die Schule der Macht. Frankfurt am Main 1999.
Friedrich Meinecke: Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte. München 1924.
Karl Mittermeier: Machiavelli. Moral und Politik zu Beginn der Neuzeit. Gernsbach 1990.
Dick Morris: The new prince. Machiavelli updated for the twenty-first century. Los Angeles 1999.
Herfried Münkler: Machiavelli. Die Begründung des politischen Denkens der Neuzeit aus der Krise der Republik Florenz. Frankfurt a.M 1995.
Herfried Münkler: Politische Bilder, Politik der Metaphern. Frankfurt am Main 1994.
Herfried Münkler: Thomas Hobbes. Frankfurt am Main 1993.
Herfried Münkler: Im Namen des Staates, Die Begründung der Staatsräson in der Frühen Neuzeit. Frankfurt am Main 1987.
Emil Nack, Wilhelm Wägner: Rom. Land und Volk der alten Römer. Wien 1969.
Julian Nieda-Rümelin: Bellum omnium contra omnes. Konflikttheorie und Naturzustandskonzeption im 13.Kapitel des Leviathan. In: Otfried Höffe (Hg.): Thomas Hobbes. Berlin 1996.
Peter Noll: Der kleine Machiavelli. Handbuch der Macht für den alltäglichen Gebrauch. München 1991.
Anthony Parel: The Machiavellian cosmos. New Haven 1992.
Heinrich Pleticha (Hg.): Diktatoren und Ideologien. Die Welt zwischen zwei Kriegen. In: Weltgeschichte in zwölf Bänden, Bd.11. Gütersloh 1996.
John Pocock: The Machiavellian Moment. Florentine political thought and the Atlantic republican tradition. New York 1975.
Giuliano Procacci: Geschichte Italiens und der Italiener. München 1983.
Alois Riklin: Die Führungslehre von Niccolò Machiavelli. Wien 1996.
Gerhard Ritter: Die Dämonie der Macht. Betrachtungen über Geschichte und Wesen des Machtproblems im politischen Denken der Neuzeit. Stuttgart 1947.
Bertrand Russel: Macht. Zürich 1947.
Genaro Sasso: Niccolò Machiavelli. Geschichte seines politischen Denkens. Stuttgart 1965.
Josef Scheipl u.a.: Zeitbilder 6. Geschichte und Sozialkunde. Wien 1992.
Thomas Scheider: Hobbes. In: Bernd Lutz (Hg.): Metzler-Philosophen-Lexikon. Dreihundert biographisch-werkgeschichtliche Porträts von den Vorsokratikern bis zu den Neuen Philosophen. Stuttgart 1989.
Arthur Schopenhauer: Trancendente Spekulationen über die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksal des einzelen. In: Parerga und Paralipomena I. Zürich 1988.
Quentin Skinner: Machiavelli zur Einführung. Hamburg 1990.
Tom Sorell: The rise of modern philosophy. The tension between the new and traditional philosophers from Machiavelli to Leibniz. Oxford 1993.
Dolf Sternberger: Machiavellis "Principe" und der Begriff des Politischen. Stuttgart (2.Auflage) 1975.
Leo Strauss: Thoughts on Machiavelli. Glencoe 1958.
Gerhard Streminger: David Hume. Sein Leben und sein Werk. Paderborn u.a. 1994.
Thomas (von Aquino): Über die Herrschaft der Fürst. Stuttgart 1981.
Alexander Ulfig: Lexikon der philosophischen Begriffe. Wiesbaden 1997.
Pascal Villari: The life and times of Niccolò Machiavelli. New York 1969.
Maurizio Viroli: Machiavelli. Oxford 1998.
Max Weber: Politik als Beruf. Stuttgart 1992.
Donald Weinstein: Savonarola and Florence. Prophecy and Patriotism in the Renaissance. New York 1970.
Norbert Weiss: Namen- und Begriffsverzeichnis zu Machiavellis Schrift "Der Fürst". Duisburg 1986.

Lebenslauf des Autors
Stand: Sommer 2000
Patrick Horvath
Ich wurde am 10.6. 1977 als Sohn des Dr.Werner und der Ilse Horvath (früher Beham) in Linz geboren. Mein Vater ist dort als Primararzt am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder tätig; sein medizinisches Fachgebiet ist die Radiologie mit dem Schwerpunkt der Behandlung von Blutgefäßerkrankungen. Zudem ist er als Kunstmaler erfolgreich (Ausstellungen z.B. in Wien, Budweis, Paris). Meine Mutter ist seit meiner Geburt Hausfrau. Ich habe noch eine kleine Schwester, Nina, die diesen Sommer maturierte und nun Biologie studieren wird.
Nach dem Besuch der Volksschule 41 am Pöstlingberg wechselte ich auf das Fadingergymnasium in Linz. Dort schloß ich alle acht Gymnasialklassen mit Auszeichnung ab. 1995 maturierte ich an derselben Schule, u.a. mit einer Fachbereichsarbeit in Psychologie mit dem Titel "Über die Beziehung zwischen Geistesstörung und Kreativität".
Im Herbst 1995 inskripierte ich an der Universität Wien in mehreren Fächern. 1997 schloß ich den 1.Abschnitt Publizistik und den 1.Abschnitt Geschichte ab, 1998 den 1.Abschnitt Philosophie (mit Auszeichnung) und den 1.Abschnitt Politikwissenschaft.
1996 wurde mir im Alter von 18 Jahren ein internationaler Wissenschaftspreis des KALEIDOSKOP-Programmes der Europäischen Union an der Universität Saloniki (Griechenland) überreicht; ich erhielt ihn für eine Arbeit über Nietzsche.
Mit der vorliegenden Diplomarbeit möchte ich das Studium der Philosophie und Politikwissenschaft abschließen. Ich stehe auch vor dem Abschluß eines weiteren Studiums (Publizistik und Geschichte), in dem ich bereits alle Einzelprüfungen absolviert habe. In einem dritten Studium, der Psychologie, bin ich ebenfalls fortgeschritten. Meine Neugierde und mein Wissensdrang sind allerdings noch immer ungestillt.


(Die Darstellungen Niccolo Machiavellis stammen aus der Hand von Werner Horvath.)

Patrick Horvath: "Über Philosophie und Politik"
Kontakt
© 2000 Patrick Horvath
