
...ist ein starkes Europa, nicht bloß ein loses Bündnis ohne praktische Bedeutung. Wer ein vereintes Europa will, die Europa-Idee also unterstützt, muß meiner Meinung auch für ihre tatsächliche politische Umsetzung eintreten.
In meinem Europa von Morgen werden die Einzelstaaten weiterbestehen. Aber die Union sollte alle Aufgaben übernehmen, die eine Union eben am besten und sinnvollsten erfüllen kann. Ich glaube, daß diese Aufgaben zum großen Teil bereits definiert sind und es nachvollziehbare Kriterien für die Festsetzung dieser Aufgaben gibt. Es existieren auch zahlreiche lobenswerte Ansätze für ihre Umsetzung, diese ist aber weder vollständig, noch perfekt.
Es ist allgemein anerkannt, daß z.B. eine internationale Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Währungsfragen Sinn macht. Die Wirtschaft wird belebt, wenn man ihr einen großen Markt gibt; und die “vier Grundfreiheiten” haben diesem Umstand Rechnung getragen. Der Euro kommt ebenfalls. Trotz einiger Anfangsprobleme (Kursverluste gegenüber dem Dollar) und einiger Risken (Gefahr einer falschen, aufgerundeten Umrechnung durch Wirtschaftsbetriebe) überwiegen meiner Meinung nach die Vorteile der gemeinsamen Währung. Das Hauptargument ist für mich ein wirtschaftliches: Man erspart sich durch eine gemeinsame Währung die Kosten für den Währungsumtausch und die Wechselkursschwankungen. Dies sind keine geringen Kosten. Die Firma Mercedes-Benz bezahlte im Jahre 1995 alleine 600 Mrd.Mark, also umgerechnet 4,2 Mrd.Schilling nur für diese beiden Punkte - also für nichts! Das ist Kapital- und meiner Meinung nach auch Arbeitsplatzvernichtung. In meinem Europa von Morgen haben dies alle europäischen Staaten erkannt; keiner bleibt aufgrund eines überholten Nationalismus und eines unangebrachten Isolationismus in selbst- und europaschädigender Absicht abseits - gegen jede wirtschaftliche Vernunft.
Die Zusammenarbeit in diesem Bereich, die man auch die 1.Säule der Europäischen Union zu nennen pflegt, ist schon sehr weit fortgeschritten. Sogar die EU-Gegner haben die Notwendigkeit eines gemeinsamen europäischen Marktes im Prinzip anerkannt. Aber sie sind der Meinung, daß es zwar eine wirtschaftliche, aber keine politische Fortentwicklung Europas geben sollte. Das ist meiner Meinung nach aber ein Selbstwiderspruch. Sobald man einmal zugestanden hat, daß es einen gemeinsamen Markt geben soll, muß man auch zugestehen, daß man für diesen Markt gemeinsame Regeln schaffen und durchsetzen muß; dazu sind politische Institutionen nötig. Wo es einen Markt gibt, existieren außerdem auch Arbeitnehmer; wo es Arbeitsnehmer gibt, existieren auch soziale Anliegen. Das könnte manchen so passen, daß sich die Politik um diese Anliegen auf europäischer Ebene nicht kümmert! Aber man muß wirtschaftliche Interessen auch nach außen vertreten und schützen. Ein wirtschaftlicher Riese, der ein politischer und militärischer Zwerg ist, scheint mir ein Unding. Politik folgt der Wirtschaft auf den Fuß, das hat schon Karl Marx gesehen. Und man muß kein Marxist sein, um dieser Aussage zuzustimmen.
Eine Zusammenarbeit der europäischen Staaten macht im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik ebenfalls Sinn. Bereits Jay, einer der Gründungsväter der USA, argumentiert im Artikel 4 der Federalist-Papers:
“Eine einzige Unionsregierung kann die Fähigkeiten und Erfahrungen der besten Männer zusammenholen und sie nutzen, wo immer sie in der Union zu finden sind. Sie kann auf der Grundlage einheitlicher politischer Prinzipien handeln. Sie kann zur Angleichung der unterschiedlichen Landesteile und Mitgliedstaaten beitragen, kann sie assimilieren und schützen und vorausschauend für den Nutzen jedes Mitglieds sorgen. Beim Aushandeln von Verträgen berücksichtigt die Regierung das Interesse des Ganzen und die Sonderinteresse der Teile, so wie sie mit dem Ganzen zusammenhängen. Sie kann Ressourcen und Macht des Ganzen zur Verteidigung eines bestimmten Teils einsetzen und zwar leichter und schneller als Einzelstaatesregierungen oder separate Konföderationen das je könnten, weil Geschlossenheit und Einheit des Systems bei ihnen fehlen würden. Sie kann die Miliz einer einheitlichen Ordnung unterstellen und - indem sie die Offiziere in eine zweckmäßige Hierarchie einordnet und dem höchsten zivilen Amtsträger, dem Präsidenten, unterstellt - diese in gewisser Weise zu einem Korps zusammenschweißen und damit schlagkräftiger machen, als die Miliz von dreizehn oder von drei oder vier separaten, unabhängigen Einheiten.”
Ich glaube, daß man es kaum besser formulieren kann. “Divide et impera”, teile und herrsche, war schon immer die Maxime derer, die andere kontrollieren wollten. Wer Europa zur außen- und sicherheitspolitischen Zersplitterung rät, kann nicht Europas Freund sein, weil er es in Schwäche und Abhängigkeit halten will. Kleinstaaten wie Österreich, die nur über 8 Mio. Einwohner verfügen, haben international einfach nicht soviel Gewicht wie die USA mit 270 Mio. oder China mit 1,2 Mrd. Einwohnern! Nehmen wir ein Beispiel: Der Nahe Osten ist ein unglaublich wichtiges Gebiet, die österreichischen Einflußmöglichkeiten sind aber sehr beschränkt. Zwar kann Kreativität und Engagement auch der kleinen Länder einiges bewirken, wie auch schon Bruno Kreisky als Vermittler im Nahen Osten bewiesen hat. Dennoch hätte gerade er erkannt, daß eine Europäische Union, die über eine glaubhafte außen- und sicherheitspolitische Stärke verfügt, wesentlich mehr bewirken könnte, auch für die Einzelstaaten. Mein Europa von Morgen gibt den EU-Gegnern und nationalistischen Hetzern nicht die Genugtuung, es als “gackernden Hühnerstall” verleumden zu können. Mein Europa von Morgen ist vielmehr ein “global player”, der nach außen mit einer Stimme spricht.
Das, was ich an der bisherigen Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) kritisiere, ist, daß sie hauptsächlich nach intergouvernementalem, nicht nach supranationalem Muster organisiert ist. Ich möchte dies an einem Beispiel ausführen. Man stelle sich vor, es gäbe einen Außenminister der Steiermark, einen des Burgenlands, einen Vorarlbergs etc. Diese neun Außenminister, die selbstredend nicht das Gesamtinteresse, sondern kleinliche Regionalinteressen vertreten, hätten nun alle Macht. Nun gäbe es auch einen österreichischen Außenminister, der keine Macht hat, sondern die Standpunkte der neun nur koordiniert und versucht, kleinste gemeinsame Nenner herauszufiltern. Eine solche Außenpolitik könnte man kaum als effizient bezeichnen, genausowenig wie die Außenpolitik der heutigen österreichischen Bundesregierung, in die immer wieder ein selbsternannter Außenminister von Kärnten hineingackert.
Leider verhält es sich aber im momentanen Europa so. Die Macht liegt bei den Außenministern der Einzelstaaten, lediglich ein “Mr.GASP” (Javier Solana) koordiniert die Stimmen. Ich glaube zwar, daß es gut ist, wenn die GASP als sogenannte 2.Säule der EU jetzt ein “Gesicht” und eine “Telefonnummer” hat, in meinem Europa von Morgen ist Außen- und Sicherheitspolitik aber supranational organisiert, sozusagen europäisiert. D.h. es gibt einen europäischen Präsidenten, einen europäischen Kanzler, einen europäischen Außenminister, der das Interesse der Gesamtheit verteidigt. Und er sollte auch die oberste Entscheidungsinstanz sein. Die Gesamtheit ist mehr als der Teil, das wußte schon Platon. Mein Europa von Morgen weiß es auch.
Welchen Sinn es macht, die nationalen Armeen aufrechtzuerhalten, kann man mir auch nicht wirklich erklären. Momentan fährt man ja zweigleisig: Man behält nationale Armeen, schafft aber nebenbei eine europäische Truppe von ca. 60.000 Mann, ein wichtiger Ansatz. Aber in meinem Europa von Morgen gibt es gleich eine nicht allzu große europäische Berufsarmee. Man hat dort erkannt, daß die nationalen Armeen die Verteidigungsaufgaben der heutigen Zeit nicht mehr so wahrnehmen können wie einst. Man hat daher die nationalen Armeen in eine europäische Armee übergeführt, sozusagen in sie aufgehen lassen. Das bietet mehr Sicherheit nach außen wegen der vereinten Kräfte, aber auch voreinander. Ich glaube, daß eine europäische Armee weniger kostet als fünfzehn oder zwanzig nationale Armeen, weil man nicht mehr gegeneinander rüsten muß. Man könnte so auch weniger Geld für Waffen ausgeben; stattdessen hätte man mehr für soziale Anliegen, Bildung und Gesundheit.
Auch die 3.Säule der EU, die Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres (JI) wäre in meinem Europa von Morgen weiter ausgebaut. Es gibt schon gute Ansätze, z.B. Zusammenarbeit der Behörden bei der Bekämpfung der Internationalen Kriminalität etc. Das macht auch Sinn, denn kein Einzelstaat kann dieser Bedrohung mehr alleine Herr werden. Auch eine Unionsbürgerschaft gibt es bereits; diese ist mit gewissen Rechten verbunden (Europa-Wahlrecht, Aufenthaltsrecht, Recht auf demokratische Vertretung, Petitionsrecht beim Europa-Parlament); ich trage sie mit Stolz. Dennoch halte ich es für seltsam, daß die wichtigste Funktion noch immer die Staatsbürgerschaft innehat; und es fünfzehn verschiedene Arten gibt, sie zu erwerben; und die Unionsbügerschaft dann als “Anhängsel” mitverliehen wird. In meinem Europa von Morgen hat sich dieses Verhältnis umgekehrt. Auch die Grundsätze zum Erwerb der Staats- und Unionsbürgerschaft sind vereinheitlicht. Das hätte auch den Vorteil, daß nicht ein einzelner Staat, in dem eine rechtsextreme Regierung an die Macht kommt, einfach so eine “Ausländer raus!”-Politik betreiben kann, weil eine Absprache mit den anderen europäischen Partnern erfolgen muß. (Überhaupt werden Parteien und Regierungen, die keine internationalen Partner finden, auf Europa-Ebene marginalisert - das ist ein guter Schutz vor nationalistischen und rassistischen Umtrieben!)
Die Unionsbürgerschaft sollte mit gewissen Grundrechten verbunden sein, auch um die Loyalität der Bürger zu Europa zu vergrößern. Das Europäische Parlament hat sich bereits bei der Formulierung eines solchen Grundrechtskataloges verdient gemacht. In meinem Europa von Morgen hat eine Grundrechtscharta allerdings nicht nur eine politische, sondern auch eine juristische Verbindlichkeit, d.h. sie ist einklagbar. Alles andere ist meiner Meinung nach höchstens ein erster Schritt, kein Endzustand.
In meinem Europa von Morgen gibt es darüberhinaus noch eine 4.Säule, die es heute noch nicht gibt, nämlich eine Zusammenarbeit im Bereich Soziales und Umweltschutz. Die Union darf kein rein kapitalistisches Projekt sein, das sich um die Interessen der Arbeitnehmer, der Frauen, der Kranken, der Jungen etc. nicht kümmert. Ich glaube, daß die Schaffung einer großen Union auch die Möglichkeit bietet, die Priorität der Politik über die Wirtschaft wiederherzustellen und dem heute herrschenden schrankenlosen Kapitalismus entgegenzutreten. Ein Einzelstaat ist erpreßbar. Ein großer Konzern kann zu ihm sagen: “Wenn Du diese Sozialgesetze einführst, wenn Du uns diese strengen Auflagen im Umweltschutzbereich machst, dann werden wir uns einen anderen Standort suchen und viele Menschen werden arbeitslos.” Die Europäische Union ist auf diese Art nicht erpreßbar, weil es sich kaum ein Unternehmen leisten kann, auf den europäischen Standort zu verzichten. Mein Europa von Morgen ist nicht das der Großkonzerne, sondern das des kleinen Arbeitnehmers. Und während alle Nationen in meinem Europa von Morgen blühen, gedeihen und wachsen, ist eine rapide zusammengeschmolzen, fast nicht mehr vorhanden: die Nation der Arbeitslosen, die leider eines der größten “Länder” der heutigen EU ist. Hier besteht politischer Handlungsbedarf!
Das gegenwärtige Europa hat meines Erachtens noch Schwächen, die die EU-Gegner leider zu Recht kritisieren: z.B. das Demokratiedefizit. In meinem Europa von Morgen ist dieses Argument entkräftet. Zunächst einmal ist die bisher schlampige Gewaltenteilung der EU beseitigt. Die Europäer von Morgen halten es für unerträglich, daß ein exekutives Organ (wie z.B. die Kommission) legislative Befugnisse hat. Seit Montesquieu ist dies ein Verstoß gegen fundamentale demokratische Standards. Und sie werden nicht verstehen, warum das EU-Parlament von 2001 als einzig von den Bürgern direkt gewähltes Europa-Gremium bei den legislativen Akten der EU nur mitentscheiden darf. In meinem Europa von Morgen ist das Europaparlament und damit das Volk massiv aufgewertet. Es ist entweder das einzige legislative Gremium oder zumindest das “Unterhaus” eines europäischen Kongresses, dessen Zustimmung zu einem Gesetz unbedingt notwendig ist. Ein “Oberhaus”, der aus dem Ministerrat hervorgeht, wird in meinem Europa von Morgen mit gewählten Staatenvertretern beschickt. Aus der Kommission hat sich eine Europa-Regierung entwickelt, die vom Parlament abhängig ist und genau überwacht wird. Zusätzlich gibt es einen von den Völkern direkt gewählten Präsidenten Europas, der v.a. diplomatische Aufgaben wahrnimmt. Ich habe zu Beginn des Artikels geschrieben, mein Europa von Morgen sei ein starkes Europa. Viel wichtiger ist mir eigentlich, daß es ein freies Europa ist. Daher: Ausbau von Demokratie, das heißt z.B. der Volkswahlen und der Grundfreiheiten.
Mein Europa von Morgen hat sich nach Osten erweitert und gleichzeitig auch vertieft. Polen, Ungarn, Tschechien, Slowenien, Kroatien, die Slowakei und das Baltikum wurden nach und nach in die große europäische Familie aufgenommen. Andere Staaten werden auch in Zukunft im Sinne der europäischen Solidarität durch Wirtschafts- und Förderungsprogramme zunächst aufgebaut und schließlich ebenfalls als gleichberechtigte Mitglieder aufgenommen - Europa soll keine geschlossene Gesellschaft werden, auch kein Club der Reichen, auch keine “Festung”. Mein Europa von Morgen hat aber als Antwort auf den amerikanischen Wirtschaftraum von Alaska bis Feuerland eine vergleichbare Freihandelszone im Mittelmeerraum geschaffen, indem Assoziierungsverträge mit allen dort vertretenen Staaten abgeschlossen wurden. Man hat neue Partner in Südostasien gefunden (einem Raum, den man bisher sträflichst vernachlässigt hat) und sich aus allen Formen der außenpolitischen Bevormundung gelöst. Die Teilung Europas durch außereuropäische Mächte erscheint nur mehr wie ein böser, aber längst verflogener Traum der vergangenen Nacht. Überall auf der Welt werden durch mein Europa von Morgen Demokratie und Menschenrechte aktiv gefördert.
In meinem Europa von Morgen hat sich auch der Nationsbegriff verändert. Man sagt dort nämlich, daß es nur mehr eine Nation gibt, nämlich eine europäische. Natürlich kann eine solche Nation niemals durch den überholten Begriff einer Sprachnation definiert werden; auch in meinem Europa von Morgen herrscht sprachliche Vielfalt - dies wird als eine kulturelle Bereicherung gesehen, nicht als Hindernis. Aber man kann eine Nation über gemeinsame, europäische Werte definieren: Über Demokratie, Menschenrechte, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Frieden, aber auch über soziales Engagement für die Schwachen. Letztlich sind diese Werte die wesentlichste Grundlage einer Nation, nicht Hautfarbe, Muttersprache, Herkunft, Rasse oder Religion. Und eine europäische Nation von Morgen braucht ein gut organisiertes europäisches politisches System, das in einer europäischen Verfassung bzw. einem Verfassungsvertrag seine legitime, von den Völkern bestätigte Grundlage findet.
* * *
P.S. Ich habe im Rahmen meines Studium der Politikwissenschaft eine Arbeit verfaßt, die sich mit den Argumenten pro und contra supranationale politische Zusammenschlüsse auseinandersetzt. Sie ist eine für diesen Aufsatz unentbehrliche Vorarbeit und entscheidend für meine hier genannten Überzeugungen zur Europäischen Union; sie wurde beim Wettbewerb der SPÖ auch als Teil des Aufsatzes miteingereicht. Das bisher über Europa Gesagte kann als ein Vorwort dazu aufgefaßt werden, obwohl es chronologisch eigentlich ein Nachwort ist. In der Arbeit kommen auch legitime und schlagkräftige Gegenargumente zu einer großen Union zur Sprache, die meiner Meinung nach allerdings nicht schlagkräftig genug sind.

Patrick Horvath
Union oder Einzelstaat?
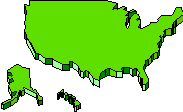

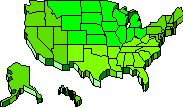
Die Frage nach Zentralisierung oder Dezentralisierung politischer Macht in der Diskussion der Federalists und Anti-Federalists und ihre Bedeutung für den Europäischen Integrationsprozeß
Patrick Horvath, Mat.-Nr.9502353, Studienkennzahl: 300, Seminar Politische Theorie und Ideengeschichte bei Frau Prof. Puntscher-Riekmann, Wintersemester 1999 / 2000, Universität Wien
Einleitung
Die Frage nach der Organisation von Macht kann man als die zentrale und grundlegende Frage jedweden politischen Denkens bezeichnen. In einer bestimmten Ausprägung stellt sich diese Frage so: Soll die Macht eines politischen Gebildes bei einem Zentrum konzentriert sein oder sollen sich die kleineren Einheiten (also z.B. Länder, Regionen etc.) ganz oder weitgehend eigenständig verwalten? Soll also, wie es ein Befürworter der kleineren Einheiten formulieren würde, das ferne und unbekannte Zentrum mit seinen undurchsichtigen Machtapparaten und ausufernden Bürokratien über das Schicksal des kleinen, hart arbeitenden Mannes walten, dessen Probleme den fremden Herrschern völlig unbekannt, vielleicht sogar völlig gleichgültig sind? Oder soll umgekehrt, wie es ein Befürworter der Zentralgewalt ausdrücken würde, ein Kontinent wie Europa oder Nordamerika, den die Kultur vereint, von der Politik in viele kleinräumige Einheiten zersplittert werden, die nach außen völlig unbedeutende und wehrlose Objekte auswärtiger Eroberer sind, nach innen aber von Provinzialismus, lokalen Vorurteilen und regionaler Eigensucht beherrscht werden?
Dies sind die gegensätzlichen Standpunkte, die man im deutschen Sprachraum als "Zentralismus" und "Föderalismus" bezeichnen würde (im Englischen ist aber ein "Federalist" genau das Gegenteil eines "Föderalisten" - die Federalists nämlich wollten eine Union mit starker Zentralgewalt, keinen bloß losen föderativen Zusammenschluß).
Schon rein theoretisch läßt sich ausführen, daß keiner der beiden Standpunkte in seiner reinsten Form durchzuhalten ist. Ein Staat oder ein Staatenbund, in dem wirklich ohne Ausnahme die gesamte Macht bei einem Zentrum liegt und dessen Regionen vollkommen entmündigt sind, wird sich keiner großen Akzeptanz weiter Bevölkerungsteile und infolgedessen auch keines langen Lebens erfreuen. Er wird in der Praxis, sobald vor äußere Probleme gestellt, gleichzeitig mit einer Unabhängigkeitsbewegung im Inneren zu kämpfen haben, wobei im harmlosesten (keineswegs aber angenehmsten) Fall jede Woche die Splitterbombe einer separatistischen Untergrundorganisation in der alles beherrschenden Hauptstadt explodiert, im schlimmsten Fall ganze Völker oder Volksgruppen offen gegen die Zentralgewalt zu den Waffen greifen und der oben genannte Konflikt um die Organisation von Macht zum Bürgerkrieg eskaliert.
Der umgekehrte Standpunkt allerdings, jener der Dezentralisierung der Macht, führt sich ohnehin selbst ad absurdum, sobald er bis in die letzte Konsequenz durchdacht wird. Es zeigt sich bei jeder unvoreingenommenen Betrachtung, daß das Wesen jedes Staates notwendig in der Zentralisierung von Macht besteht. Man könnte z.B. alle Macht von der österreichischen Hauptstadt Wien in die Bundesländer, sagen wir nach Oberösterreich zurückverlagern. Aber Oberösterreich hat wieder eine Hauptstadt, Linz, und mit einiger Berechtigung könnten auch die anderen Städte und Landgemeinden mehr Mitbestimmung verlangen. Verlegte man aber sämtliche Machtbefugnisse in die Gemeinden, also in Orte wie Puchenau, Grammastetten und Zwettel an der Rodl, dann würde sich bald herausstellen, daß diese wiederum ein Zentrum besitzen, von dem manche wiederum fern sind und sich daher fremdbestimmt fühlen (Gefühlsmäßige Einheiten wie Kultur, Identität, etc. lassen sich im übrigen beliebig und in jeder Größenordnung konstruieren).
In der letzten Konsequenz müßte dann jeder so handeln wie vor einigen Jahrzehnten jener besagte Verrückte, der um seinen Garten einen Stacheldrahtverhau aufgebaut und auf seinem Grundstück die unabhängige "Republik Kugelmugel" ausgerufen hatte. Er weigerte sich, Steuern an die Republik Österreich zu bezahlen und druckte sogar eigene Briefmarken für sein "Staatsgebiet", also für sein kleines Häuschen und den Garten. Damals lachte das ganze Land über diesen im Prinzip harmlosen Irren, der letztendlich nach seiner gerichtlichen Verurteilung aus eben diesem Grund vom Bundespräsidenten begnadigt wurde und so der Haftstrafe entging (Man kann diesen sympathischen Akt der Milde und Nachsicht im übrigen gar nicht genug loben). Allein das allgemeine Gelächter über diesen Mann zeigt deutlicher als jedes theoretische Argumentieren, daß diese letzte Konsequenz der Dezentralisierung der Macht nur mehr lächerlich, nicht aber ein wirklich ernstzunehmendes politisches Konzept sein kann.
Während beide Standpunkte in der extremsten Form wenig zukunftsträchtig erscheinen, spielt es aber sehr wohl eine große Rolle, welchem Pol dieses Spannungsfeldes jemand näher steht. Ist man eher für ein starkes Zentrum oder eher für die Macht der Regionen? Das ist die große Glaubens- und Gewissensfrage der Politik; ich verhehle übrigens nicht die Hoffnung, im Zuge dieser Arbeit dazu beitragen zu können, daß die bloße Glaubens- in eine Vernunftsfrage umgewandelt wird - egal, welchem Standpunkt man letztlich zuneigen sollte.
Die Frage nach der Zentralisierung und Dezentralisierung der Macht ist aus einem naheliegenden Grund sehr aktuell. Wir befinden uns mitten im Prozeß der europäischen Einigung; und die noch längst nicht abgeschlossene Vertiefung und Erweiterung der Europäischen Union verändert drastisch die politische Landschaft unseres Kontinents. Insbesonders Österreich ist erst 1995 als Vollmitglied beigetreten; und damals erlebten wir auch eine heftige Diskussion darüber, wo die Macht gelagert sein soll - auf der Ebene des Nationalstaates oder auf der europäischen Ebene. Daß diese Diskussion im übrigen sehr polemisch, zeitweise sogar hysterisch und mit unseriösen Argumenten geführt wurde (man denke an die Warnung Haiders, im Falle des Beitritts würde die Union uns Schildläuse ins Joghurt mischen), liegt an der ohnehin schon immer mangelhaften Diskussionskultur Österreichs. Nichtsdestotrotz kann jeder aus eigener politischer Erfahrung nachvollziehen, warum diese von mir genannte Grundfrage gerade heute große Wichtigkeit besitzt.
Daß aber auch in anderem Zusammenhang diese Frage in Europa immer wieder gestellt wird, bedarf auch kaum einer weiteren Erklärung. Man denke in diesem Zusammenhang z.B. an die jüngst erstarkten schottischen Nationalisten, die eine Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich fordern. In letzter Zeit hat auch die Organisation der baskischen Separatisten, die ETA, mit Terroranschlägen in Madrid wieder auf sich aufmerksam gemacht. Die Probleme Korsika oder Nordirland sind ebenfalls bei weitem noch nicht gelöst. Und auch der jüngst geführte Kosovokrieg hat sich letztlich auch an Sezessionsbestrebungen einer Volksgruppe entzündet. Man könnte die Geschichte Europas wahrscheinlich schreiben als Geschichte des Kampfes zwischen Zentrum und Peripherie.
Weniger blutig, mehr auf der intellektuellen Ebene, aber nicht minder heftig, wurde im 18.Jahrhundert in den Vereinigten Staaten von Amerika ein ähnlicher Kulturkampf ausgefochten. Befürworter und Gegner der heute noch immer gültigen Verfassung standen einander unerbittlich gegenüber; und während diese den Amerikanern heute heilige Verfassung, die kurz zuvor am Konvent von Philadelphia beschlossen worden war, sich im Prozeß der Ratifikation durch die Einzelstaaten befand, entzündete sich eine lebhafte, mit rhetorischer Brillanz und zumeist über die Medien geführte Kontroverse, die ebenfalls die Frage nach Zentralisierung und Dezentralisierung der Macht zum Inhalt hatte. Und während die sogenannten "Federalists" die Vorteile einer starken Union propagierten, beklagten die sogenannten "Anti-Federalists" lautstark ihre Mängel. Und wenngleich auch Polemiken und rhetorische Spitzen in dieser Debatte nicht fehlten, verhält sich die damalige öffentliche Diskussion, die die amerikanischen Kinder der Aufklärung untereinander führten, hinsichtlich des Niveaus und der Qualität der Argumente zu der vergleichbaren österreichischen Kontroverse zum EU-Beitritt nicht wie Gold zu Kupfer, sondern wie Gold zu Mist. Bei der Lektüre der alten Zeitungsartikel - und das waren diese Schriften zumeist - merkt man erst wehmütig, welche Qualität des öffentlichen Diskurses uns heute verlorengegangen ist; und daß es einmal eine Zeit gab, in der die Menschen ihre Meinung pointiert und selbstbewußt zur Sprache brachten, ohne ihre Gegner dabei hemmunglos zu beleidigen, zu verleumden und ihre Namen auf groteske Art zu verunstalten.
Was ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, was ist mein Forschungsinteresse? Ich möchte mit meiner Arbeit keine großartige These beweisen, die die Welt grundstürzend ändern soll. Vielmehr geht es mir darum, gewisse Argumente pro und contra Zentralisierung der Macht aus den Schriften der Federalists und Anti-Federalists herauszuarbeiten. Dabei erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ganz im Gegenteil: Ich mußte aufgrund der Fülle der Argumente notwendigerweise auswählen. Doch die Kunst, gute Arbeiten zu schreiben, liegt nicht so sehr darin, daß man jedes geringfügige Detail erwähnt, sondern, daß man den Blick für die wesentlichsten Aspekte unter Beweis stellt. Die Beurteilung, inwieweit ich dies geschafft habe, obliegt nicht meiner Person.
Zusätzlich möchte ich versuchen, plausible Parallelen zur Europäischen Union zu ziehen und untersuchen, mit welchen Einschränkungen sich die von Federalists und Anti-Federalists angeführten Argumente auch auf den europäischen Integrationsprozeß übertragen lassen.
Ich möchte in dieser Arbeit v.a. die Meinung vertreten, daß die beiden historischen Situationen der Formung der amerikanischen Union im 18.Jahrhundert und der Europäischen Union im 20./21. Jahrhundert trotz vieler Einschränkungen und gewisser Einmaligkeiten der Situationen doch miteinander vergleichbar sind. Und dies ist nicht zuletzt deswegen der Fall, weil die Frage nach Zentralisierung oder Dezentralisierung der Macht keine des 18.Jahrhundert oder der heutigen Zeit ist, sondern eigentlich eine zeitlose.
Ich bin gewiß, daß es diese Frage wohl geben wird, solange es Politik gibt; und Politik wird es geben, solange es Menschen gibt.
Die Argumente der Federalists für eine starke Union
| Nationalistische und patriotische Appelle, Verweise auf die "Vorsehung" |
| Nationalismus |
Vielleicht nicht die besten, möglicherweise aber die wirkungsvollsten Argumente der Federalists war ein gewisser Appell an nationalistische und patriotische Gefühle.
Jay schreibt im 2.Artikel der Federalist Papers, das amerikanische Volk sei eine Nation - und sollte daher nicht in verschiedene, voneinander unabhängige Staaten aufgeteilt werden. Die Amerikaner seien ein Volk, "das von denselben Vorfahren abstammt, dieselbe Sprache spricht, sich zum selben Glauben bekennt, für dieselben Grundsätze politischer Herrschaft eintritt, in Sitten und Gebräuchen sehr ähnlich ist und sich darüberhinaus nach gemeinsamer Beratung, nach Einsatz gemeinsamer Waffen und Anstrengungen in einem langen und blutigen Krieg Seite an Seite seine allgemeine Freiheit und Unabhängigkeit in edlem Kampf errungen hat". Und weiter meint er fast schon enthusiastisch: "Als Nation haben wir Frieden geschlossen und Krieg erklärt; als Nation haben wir unsere gemeinsamen Feinde besiegt; als Nation haben wir Bündnisse und Verträge abgeschlossen..." Hamilton vertritt eine ähnliche Meinung, wenn er im 85.Artikel darauf hinweist: "EINE NATION ohne ein NATIONALES REGIERUNGSSYSTEM ist aus meiner Sicht eine zutiefst beunruhigende Aussicht". Es ist auffallend, daß solche doch eher auf Gefühl, Identität etc. abzielende Appelle eher zu Beginn und am Ende der Federalist-Artikel zu finden sind; dies deutet auf bewußten rhetorischen Einsatz hin. Was mir an diesen Appellen noch auffällt, ist, daß immer wieder auf den gemeinsam gekämpften Bürgerkrieg Bezug genommen wird.
| Patriotismus |
Geschickt wird im Text der Federalist-Artikel auch immer wieder betont, daß den Befürworter der Verfassung ein außerordentlicher Patriotismus innewohnt. So bezeichnet schon Jay die Mitglieder des Konvents von Philadelphia als Männer von "Patriotismus, politischer Tugend und Weisheit". Im 45.Artikel, um nur ein Beispiel zu nennen, impliziert Madison, daß ein "guter Bürger" die Souveränität der Einzelstaaten dem Glück der Gemeinschaft opfern müßte. In gewisser Weise wird auf diese Art in den Federalist-Artikeln der Grundstein zu dem speziellen "Verfassungs-Patriotismus" gelegt, der den Amerikanern ja bis heute in einem hohen Ausmaß zukommt. Die Frage stellt sich, ob es nicht etwas unfair ist, zu implizieren, daß jeder, der nicht den Standpunkt der Autoren teilt, unpatriotisch sei. Ist es zulässig, anderen vorzuschreiben, was Patriotismus ist und was nicht? Oder für sich selbst ein Monopol für Patriotismus in Anspruch zu nehmen?
| Vorsehung |
Im 2.Artikel erwähnt Jay gleich mehrmals das Wort "Vorsehung". Diese, so argumentiert er, hätte seiner Meinung nach nicht nur das Land mit reichen natürlichen Gütern gesegnet, sondern hätte das mit guten Verkehrswegen (z.B. Flüssen) ausgestattete Gebiet einem zusammenhängenden Volk zur gemeinsamen Benutzung übertragen. Jay glaubt als "Plan der Vorsehung" zu erkennen, "daß ein Erbe, das so richtig und passend für eine Schar von Brüdern ist, die einander durch die stärksten Bande verbunden sind, nie in eine Vielzahl eogistischer, eifersüchtiger und einander fremde souveräne Mächte gespalten werden soll". Jay scheint einen guten Draht ins Jenseits zu haben, wo er doch so genau über die Absichten des Schicksals Bescheid weiß.
| Bedeutung der Union für Friede und Sicherheit |
| Bedrohung durch ausländische Mächte |
Schon wesentlich überzeugender als alle nationalistischen und patriotischen Appelle sind die Argumente, die mit der äußeren Sicherheit, also der Sicherheit "vor der Bedrohung durch ausländische Waffen und ausländische Einflußnahme" zusammenhängen. Eine einheitliche Bundesregierung könne als effiziente Hüterin der völkerrechtliche Verpflichtung Amerikas anderen Nationen Kriegsgründe nehmen (die aus Verletzungen von Verträgen entstehen). Eine einige Union, argumentiert Jay plausibel, wird Amerika in eine Lage versetzen, "die nicht zum Krieg einlädt, sondern von ihm abschreckt". Eine mächtige Union schreckt also potentielle Aggressoren ab. Sie kann aber auch die Verteidigung besser organisieren als eine Vielzahl von Einzelstaaten.
"Eine einzige Unionsregierung kann die Fähigkeiten und Erfahrungen der besten Männer zusammenholen und sie nutzen, wo immer sie in der Union zu finden sind. Sie kann auf der Grundlage einheitlicher politischer Prinzipien handeln. Sie kann zur Angleichung der unterschiedlichen Landesteile und Mitgliedstaaten beitragen, kann sie assimilieren und schützen und vorausschauend für den Nutzen jedes Mitglieds sorgen. Beim Aushandeln von Verträgen berücksichtigt die Regierung das Interesse des Ganzen und die Sonderinteressen der Teile, so wie sie mit dem Ganzen zusammenhängen. Sie kann Ressourcen und Macht des Ganzen zur Verteidigung eines bestimmten Teils einsetzen, und zwar leichter und schneller als Einzelstaatesregierungen oder separate Konföderationen das je könnten, weil Geschlossenheit und Einheit des Systems bei ihnen fehlen würden. Sie kann die Miliz einer einheitlichen Ordnung unterstellen und - indem sie die Offiziere in eine zweckmäßige Hierarchie einordnet und dem höchsten zivilen Amtsträger, dem Präsidenten, unterstellt - diese in gewisser Weise zu einem Korps zusammenschweißen und damit schlagkräftiger machen, als die Miliz von dreizehn oder von drei oder vier separaten, unabhängige Einheiten".
Jay fragt in diesem Zusammenhang, was denn die Miliz Großbritanniens wäre, wenn die englische Miliz den Befehlen der englischen Regierung, die schottische Miliz denen einer schottischen Regierung und die walisische Miliz den Anordnungen einer Regierung von Wales Folge leisten würde. Im Falle einer Invasion würde es schwierig werden, dem Feind koordiniert entgegenzutreten.
Eine einzige amerikanische Regierung könnte auch eine bedeutendere Armee oder Kriegsmarine unterhalten, als dies die Einzelstaaten könnten. Und würden, wäre Amerika in mehrere Konföderationen aufgeteilt, die Nachbarn im Falle eines Angriffs einander zu Hilfe eilen - oder durch großzügige Versprechungen und Geschenke zur Neutralität überredet werden?
Bedrohungen gäbe es, vor allem durch imperialistische europäische Mächte, wie Großbritannien oder Spanien, deren Kolonien damals an U.S.-Territorium grenzten. Konfliktstoff zwischen USA und Europa gäbe es ebenfalls genug, meinen die Federalists, man denke alleine an die reichen Fischgründe, Schiffahrtsrechte auf dem Missisippi oder eine wirtschaftliche Konkurrenz im China- oder Indienhandel. Abschreckung durch Einigkeit sei das beste Mittel, diesbezüglichen Kriegen vorzubeugen.
| Kriege zwischen Teilkonföderationen und Einzelstaaten |
Sollten sich die amerikanischen Gebiet in einige wenige Teilföderationen aufspalten, wäre eine Rivalität unter ihnen zu erwarten, unter Umständen sogar Kriege. Es gäbe, meint Jay, genug Gründe für die Befürchtung, "daß die hier vorgeschlagenen Konföderationen nicht so sehr Nachbarn als vielmehr Grenzanwohner wären, die sich nicht liebten und dem anderen nicht trauten, sondern im Gegenteil die Opfer von Streit, Eifersucht und gegenseitigen Kränkungen wären". Auch ein Gleichgewicht der Kräfte sei kein Schutz vor Kriegen, denn wer würde garantieren, daß dies bis in alle Ewigkeit erhalten bliebe?
Als erstes Negativ-Beispiel dient Jay Großbritannien, in dem es auch drei Teile gibt (England, Wales und Schottland), die über Jahrhunderte miteinander rivalisierten und so Großbritannien handlungsunfähig machten. Das zweite Negativ-Beispiel ist Europa, wo sich die einzelnen Nationen ebenfalls gegenseitig bekriegten. Hamilton meint in Richtung vieler Gegner, die eine Kriegsgefahr zwischen mehreren amerikanischen Staaten oder Konföderationen offenbar bestritten: "Man muß sich schon tief in utopische Spekulationen verloren haben, um ernsthaft zu bezweifeln, daß die Untereinheiten dieser Staaten, falls sie entweder voneinander getrennt oder aber nur in Teilkonföderationen vereint wären, untereinander häufige und gewalttätige Konflikte austragen würden".
Dies ergibt sich nach Hamilton einerseits aus der Natur des Menschen, der "machthungrig, rachsüchtig und raffgierig ist". Nicht nur seine Liebe zur Macht, Neid und Mißgunst könnte zu Kriegen verleiten, sondern auch wirtschaftliche Rivalität. Auch territoriale Konflikte, vor allem um noch zu besiedelndes Land im Westen, könnten entstehen. Hamilton hält die Meinung, es würde zwischen verschiedenen amerikanischen Staaten niemals Konflikte geben, für überspannte Illusionen von Träumern und Phantasten, die mit dem Lauf der Weltgeschichte nicht vertraut sind. Er zitiert einen Autor, der die Meinung vertritt, benachbarte Nationen seien immer die Feinde der anderen, außer, sie hätten sich zu einer Föderation zusammengeschlossen und so zu einem Ausgleich gefunden.
Eine Zersplitterung der USA in mehrer Staaten oder Konföderationen können nur ihre Feinde wünschen. "Divide et impera", meint Hamilton, "muß das Motto jeder Nation sein, die uns entweder haßt oder fürchtet". Ich persönlich halte die von den Federalists angeführten Argumente (bezüglich Frieden und Sicherheit) für sehr überzeugend.
| Kontrolle der Faktionen |
Das Wort Faktion ist in der heutigen Zeit einigermaßen aus der Mode gekommen, die Sache, die damit bezeichnet wird, scheint zumindest überlegenswert. Madison sagt: "Unter einer Faktion verstehe ich eine Gruppe von Bürgern, - das kann eine Mehrheit oder eine Minderheit der Gesamtheit sein, - die durch den gemeinsamen Impuls einer Leidenschaft oder eines Interesses vereint und zum Handeln motiviert ist, welcher zum Widerspruch zu den Rechten anderer Bürger oder dem permanenten und gemeinsamen Interesse der Gemeinschaft steht".
Madison vertritt nun die Meinung, daß es in einem kleinen Staat wahrscheinlicher ist, daß solche verschwörerische Kräfte zur Macht kommen als in einer riesenhaften, sich über den ganzen Kontinent erstreckenden Republik. Es ist heute schwer nachzuvollziehen, was Madison genau unter einer Faktion versteht. Es scheint sich um politische Bewegungen zu handeln, denen durchaus große Massen von Menschen anhängen können. Sie stellen "wilde Forderungen", z.B. nach gleicher Eigentumsverteilung etc. Der beste Weg, solche radikalen Bewegungen zu kontrollieren, eröffnet sich nach Madison in einer großen Republik. In dieser gibt es so viele verschiedene und einander widerstreitende Interessen, daß solche Bewegungen seiner Meinung nach niemals die Oberhand gewinnen könnten.
| Wirtschaftspolitische Argumente |
| Wirtschaftliche Vorteile durch einen Binnenmarkt |
Der unbestreitbare Vorteil einer Union liegt nach Hamilton darin, daß in ihrem Inneren keine Zölle existieren, die den Handel unnötig behindern. Durch den Wegfall dieser Handelshindernisse wird die Wirtschaft belebt.
"Der ungehinderte Verkehr zwischen den Einzelstaaten wird den Handel jedes einzelnen durch den Austausch der jeweiligen Produkte fördern und zwar nicht nur zur Versorgung seiner jeweiligen einheimischen Bedürfnisse, sondern auch zum Export auf fremde Märkte. Die Handelsströme werden überall stärker beansprucht und durch den freien Warenaustausch aller Landesteile an Dynamik und Kraft hinzugewinnen", meint Hamilton im 11.Artikel. Eine gestärkte Wirtschaft werfe auch mehr Steuern ab, daher nütze die Union auch dem Fiskus. Zölle innerhalb Amerikas würden nicht nur die Wirtschaft schädigen, sie seien aufgrund von geographischen Gegebenheiten in Nordamerika auch schwer zu kontrollieren. Eine Union der damaligen Ausdehnung hingegen müßte nur die Atlantikküste überwachen, was sich nach Hamilton verhältnismäßig leicht gestaltet, da hauptsächlich die Häfen kontrolliert werden müßten.
| Aufbau einer Handels- und Kriegsmarine |
Wenn die Einzelstaaten ihre Kräfte zusammenlegen, sind sie in vielfacher Weise nach außen schlagkräftiger. Dazu gehört auch, daß mehr Ressourcen für den Aufbau einer Marine vorhanden wären. "Zur Erreichung dieses großen nationalen Ziels, dem Aufbau einer MARINE, wird die Union in vielfacher Weise beitragen. Jede Institution wird im Verhältnis zur Menge und zum Umfang der Mittel wachsen und gedeihen, die zu ihrer Gründung und weiterer Finanzierung gemeinsam aufgebracht werden. Eine Marine der Vereinigten Staaten auf der Grundlage der Ressourcen aller ist ein weniger fernes Ziel als eine Marine jedes Einzelstaates oder jeder Teilkonföderation, der jeweils auch nur die Ressourcen eines Teils zur Verfügung stehen".
| Synergieeffekte bei der Verwaltung |
"Wenn die Einzelstaaten in einem Regierungssystem vereint sind, muß man nur eine zentrale Verwaltung unterhalten", meint Hamilton. Aus einer statt dreizehn Verwaltungen entstünden aber Synergie- und Einsparungseffekte, denn: "Von einer bestimmten Größe an benötigt ein Staat dieselbe Durchsetzungskraft für sein Regierungssystem und dieselben Verwaltungsstrukturen, die ein sehr viel größerer Staat auch braucht". Die Verwaltung in einer vereinten Union sei also kostengünstiger als mehrere solche Systeme in entsprechenden Teilföderationen.
| Wirtschaftliche und damit politische Behauptung gegenüber Europa |
Zuvor sprachen die Federalists von einer militärischen Behauptung gegen mögliche europäische Angriffe. Die wirtschaftliche Behauptung gegenüber Europa liegt ihnen nicht weniger am Herzen. Wenn es eine einheitliche Bundesregierung gibt, kann diese auch ihren Markt nach außen verschließen. Dies sei, bei dem großen Potential des amerikanischen Marktes, ein nicht zu unterschätzendes Druckmittel. "Durch Schutzbestimmungen, die in allen unseren Staaten gleichermaßen gelten, können wir ausländische Staaten dazu zwingen, um die Vorteile unseres Marktes meistbietend zu feilschen. (...) Wären wir dann nicht mit guter Aussicht auf Erfolg in der Lage, Verhandlungen zu führen und selbst Handelsvorteile wertvollster und umfangreichster Art in den überseeischen Gebieten (Großbritanniens) durchzusetzen?". Eine glaubhafte Handels- und Kriegsmarine könnte den USA auch politisch zu mehr Bedeutung verhelfen. "Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß uns das Fortbestehen der Union unter einem effizienten Regierungssystem in die Lage versetzen würde, in nicht allzu langer Zeit eine Marine aufzubauen, die, wenn sie sich schon nicht mit den ganz großen Mächten messen könnte, so doch zumindest ein beachtliches Gewicht hätte, wenn sie für eine der beiden konkurrierenden Seiten Partei ergriffen hätte. (...) Nicht nur unsere Freundschaft, auch unsere Neutralität hätte einen Preis. Durch unverrückbares Festhalten an der Union können wir in nicht allzu weiter Ferne darauf hoffen, der Schiedsrichter Europas in Amerika zu werden und das Gleichgewicht zwischen den europäischen Konkurrenten auf diesem Kontinent in unserem Interesse zu beinflussen".
Die Erwartungen der Federalists muten fast bescheiden an, wenn man die Machtfülle der U.S.-Marine im Jahr 2000 betrachtet. Sie kann sich mit den europäischen Marinen nicht nur messen, sondern hat diese weit überflügelt und beherrscht souverän alle Meere. Die USA sind im Laufe ihrer Geschichte nicht nur der Schiedsrichter des europäischen Gleichgewichts in Amerika, sondern, bedenkt man den Verlauf der beiden Weltkriege, zum Schiedsrichter in Europa geworden. Man sieht, wie sich die Ansichten der Federalists bestätigt haben; es ist wohl kaum anzunehmen, daß die Weltmachtsrolle der USA in diesem Umfang bestehen würde, hätte sie sich damals in viele Einzelstaaten oder Teilkonföderationen aufgespalten. Zur Begründung einer Weltmacht war die Union nötig. Nicht umsonst sprechen die Federalists schon im 1.Artikel - im Zusammenhang mit der amerikanischen Union - vom Schicksal eines Imperiums.
Das, wie ich es nennen will, imperiale Programm der Federalists äußert sich auch im folgenden Zitat: "Mögen die Amerikaner es unter ihrer Würde halten, Werkzeuge europäischer Größe zu sein! Mögen die dreizehn Staaten, fest verbunden in einer engen und unauflöslichen Union, gemeinsam ein großes amerikanisches System schaffen, das der Beherrschung durch alle transatlantischen Mächte und Einflüsse überlegen ist und die Bedingungen für die Beziehungen zwischen der alten und der neuen Welt selbst diktieren kann!".
In dem hier geäußerten Wunsche, nicht nur unabhängig zu sein, sondern auch anderen Ländern diktieren zu können, zeigt sich eine gleichsam bewunderswerte wie bedenkliche Eigenschaft der Federalists, die die amerikanische Union schufen; und vielleicht ist diese Eigenschaft der wichtigste Antrieb für ihr politisches Handeln: Der unbedingte Wille zur Macht.
Die Argumente der Anti-Federalists zugunsten kleinerer politischer Einheiten
Nicht von allen wurden die zuvor genannten Argumente geteilt, nicht von allen wurde die durch die Verfassung geschaffene Union begrüßt. Die damaligen Gegner der Union bezeichnet man als "Anti-Federalists". Moderne Autoren weisen darauf hin, daß man diesen nicht gerecht wird, wenn man sie nur (wie es die Federalists taten) als engstirnige, unverständige Lokalpolitiker mit beschränktem Gesichtskreis betrachtet. Die Anti-Federalists waren auch mehr als eine bloße Gegenbewegung, selbst wenn ihr Name auf letzters hindeutet. Denn ihre politische Überzeugung erschöpft sich nicht im bloßen Neinsagen. Die Gründe, aus denen sie die Verfassung ablehnten, bejahten nämlich gleichzeitig andere Dinge, z.B. die kleine Republik, die faire Repräsentation, das Bekenntnis zur Freiheit, als deren Hüter sie sich verstanden (die Federalists übrigens nicht weniger; es scheint, als ob man sich auf Demokratie und Freiheit genauso verläßlich bei jeder Gelegenheit berufen kann wie auf den lieben Gott).
Wie stark das Bewußtsein der Anti-Federalists war, die Freiheit gegen eine tyrannische Zentralgewalt zu verteidigen, zeigt sich allein an den von ihnen gewählten Pseudonymen. Der wahrscheinlich scharfsichtigste und klügste Anti-Federalist nannte sich selbst "Brutus", wer hinter diesem Pseudonym steckt, konnte bis heute nicht eindeutig geklärt werden (wahrscheinlich war es ein Mann names Robert Yates). Ein anderer bekannter Anti-Federalist, hinter dem sich wahrscheinlich der damalige Gouverneur von New York, George Clinton verbarg, nannte sich "Cato". Diese selbstgewählten Namen sind ein politisches Programm. Jeder, der in römischer Geschichte auch nur ein wenig beschlagen ist, weiß, daß Brutus und Cato zu den Hauptrivalen Caesars gehörten; sie verteidigten die Republik gegen den aufsteigenden Demagogen und Feldherren, der letztlich durch einen gewaltsamen Putsch die Macht an sich brachte. So sahen sie sich selbst: Als die Republikaner, die den Lobrednern der Tyrannei heldenhaft die Stirn bieten. In der Namenswahl steckt allerdings, ob beabsichtigt oder nicht, auch eine gewisse Tragik. Denn wie Brutus und Cato stehen die Anti-Federalists letztlich auf der historischen Verliererseite. Und einem amerikanischen Patrioten von heute könnte es durchaus als eine unbeabsichtigte Selbstkritik desjenigen Mannes erscheinen, der seine Feder gegen die fast wie Heilige verehrten amerikanischen Gründerväter erhebt, wenn sich dieser nach dem berüchtigten Mann der römischen Geschichte benennt, der seinen eigenen Vater einst in einem politisch motivierten Hinterhalt getötet hat.
Andere Anti-Federalists waren Agrippa, Centinel, The Federal Farmer, The Impartial Examiner und viele andere. Die gesamte Anti-Federalist-Literatur umfaßt ein Werk von mehreren Bänden, das ein ganzes Bücherregal ausfüllt ("The Complete Anti-Federalist", herausgegeben von Herbert Storing). Bei einer solchen Vielfalt sind Differenzen zwischen den einzelnen Anti-Federalists vorprogrammiert. Ich möchte eines der vielen Beispiele für ihre Uneinigkeit anführen. Brutus und der Federal Farmer meinen, daß das bisherige Konföderationssystem schlecht ist, daher Verbesserungen nottun. Zumindest in diesem Punkt würden sie mit den Federalists übereinstimmen. Centinel hingegen bestreitet dies und behauptet, der Grund für die beobachteten Mängel und Defizite lägen nicht im alten Konföderationssystem, sondern in der speziellen Situation des Bürgerkriegs. Man sieht also, daß die Anti-Federalists eine oftmals in sich widersprüchliche Bewegung waren.
Vielleicht, könnte man mutmaßen, steht dieser Umstand auch symbolisch für das Defizit ihrer politischen Konzeption: Genausowenig, wie viele kleine Einzelstaaten aufgrund ihrer Streitereien untereinander gegen ein zentral organisiertes Großreich aufkommen, konnten sich die Befürworter der kleineren Einheiten gegen die Vertreter der starken Union durchsetzen. Ist diese sich dem Beobachter aufdrängende Analogie ein Wink des Schicksals, mit dem das Grundproblem der antiföderalistischen Konzeption illustriert werden soll?
Man kann sich vorstellen, daß die Federalists oftmals mit Genuß auf die Uneinigkeit der Anti-Federalists hinwiesen; fast wird man dabei an das Motto "DIVIDE ET IMPERA" erinnert. Es sollte aber nicht vergessen werden, daß die Federalists in Wahrheit weniger einig waren, als es den Anschein erweckt. Zunächst gab es außer Hamilton, Madison und Jay noch andere Federalists. Aufgrund der kompakten Form der von diesen dreien verfaßten Federalist-Artikel gerieten die anderen aber in Vergessenheit. Was ein Federalist ist, bestimmt sich aus heutiger Sicht vor allem über diesen Standard-Text. Und die drei Autoren selbst, die unter dem gemeinsamen Pseudonym Publius schrieben, hatten auch viele Differenzen untereinander.
Hier muß man allerdings wieder einschränken, daß die drei Autoren diese Differenzen für ihr höheres Ziel, die Errichtung der Union, erfolgreich zurückstellen konnten. Alleine diese Vorgangsweise ist aber auch schon ein politisches Programm: Man stellt Differenzen zurück und betont Gemeinsamkeiten, um die Schlagkraft zu erhöhen. Letztlich ist das ja auch die von ihnen vertretene politische Grundidee: Die Einzelstaaten sollen ihren Hader untereinander vergessen und ihre Kräfte zusammenlegen. Sie haben diese Idee sehr verinnerlicht und auch selbst praktiziert.
Trotz ihrer historischen Verliererposition ist es dennoch interessant, sich mit den Gedanken der Anti-Federalists auseinanderzusetzen, weil diese, so scheint es mir, oft im höchsten Maße intelligent sind und damalige, längst beseitigte, genauso wie heutige Defizite der amerikanischen Union schonungslos aufdecken. Doch nun zu den Argumenten:
| Fehlen einer Bill of Rights |
Sehr heftig fiel die Kritik der Anti-Federalists an der amerikanischen Verfassung deshalb aus, weil sie damals über keine Bill of Rights verfügte, also einen Grundrechtskatalog der Bürger. Mittlerweile ist dieses offenkundige Defizit behoben; und noch der Federalist Madison wirkte federführend mit an der Schaffung einer Bill of Rights in Form von zunächst 10 Amendments, also Verfassungszusätzen, die dann 1791 in Kraft traten. Doch die Kritik war aus damaliger Perspektive zweifellos berechtigt; und wer weiß, wie lange sich die Federalists mit einer Schaffung einer Bill of Rights Zeit gelassen hätten, wenn der Protest der Anti-Federalists nicht so heftig ausgefallen wäre.
Die historischen Erfahrungen, meint Brutus, vor allem in Großbritannien, hätten gezeigt, daß es sehr zweckmäßig ist, der Allmacht des Staates gewisse Grenzen zu setzen und dem Individuum in einer Verfassung bestimmte Rechte ausdrücklich vorzubehalten, weil diese sonst mit Füßen getreten werden. "It is therefore the more astonishing, that this grand security, to the rights of the people, is not to be found in this constitution". Dies sei umso bedenklicher, weil die Bundesverfassung ja das "supreme Law of the Land" (Artikel 6, Absatz 2 der amerikanischen Bundesverfassung), das bindende Wirkung hat, trotz entgegenstehender Verfassungsbestimmungen der Einzelstaaten. Nun ist nach Brututs der Grundrechtsschutz in den Einzelstaaten schon sehr weit fortgeschritten; die Verfassungen der Einzelstaaten, die solche Grundrechtserklärungen oftmals erhalten, könnten aufgrund dieser supremacy-Klausel der Allmacht des Bundes aber nichts mehr entgegensetzen. Ein demokratiepolitischer Rückschritt.
Der Federal Farmer betont vor allem die Wichtigkeit der Religionsfreiheit, die ihm am Herzen liegt, ebenso wie Rechte des Angeklagten, die er in der bestehenden Verfassung nur unzureichend festgeschrieben sieht. Centinel plädiert insbesonders für einen Schutz der Pressefreiheit in der Verfassung. "The framers of it (...) have made no provision for the liberty of the press, that great palladium of freedom, and scourge of tyrants (...) It is the opinion of some great writers, that if the liberty of the press, by an institution of religion, or otherwise, could be rendered sacred, even in Turkey, that despotism would fly before it".
Die Federalists tun sich sichtlich schwer, diese überzeugende Argumente zu widerlegen. Hamilton nimmt sich dieser schwierigen und undankbaren Aufgabe im 84.Artikel an. Er nennt drei Rechtfertigungen: Zum ersten gäbe es auch in mehreren Einzelstaatsverfassungen keine Bill of Rights. Darauf kann man wiederum entgegnen, daß es sie in vielen Einzelstaatsverfassungen doch gab und daß man nicht einen Mißstand mit einem anderen rechtfertigen kann. Zweitens, meinen die Federalists, gehen gewisse Rechte aus der Verfassung schon hervor. So weisen sie z.B. darauf hin, daß die Verfassung die Verleihung von Adelstiteln ebenso verbot wie die Erlassung von rückwirkenden Gesetzen. Außerdem, sagt Hamilton, sei ein Grundrechtskatalog in einer Republik ohnehin nicht notwendig. Denn es gäbe, anders als in England, keinen Monarchen, dem man die Freiheitsrechte abtrotzen und den man sie beschwören lassen müsse. Das Volk, meint Hamilton, behielte sich alle Rechte vor, die es nicht ausdrücklich überträgt, daher auch alle Freiheitsrechte. Und außerdem, was bedeute denn schon die Erklärung, man müsse die Pressefreiheit schützen? Das Wort Pressefreiheit läßt sich beliebig auslegen und definieren; und außerdem ist die Gesinnung des Volkes oder der Regierung ein besserer Schutz als alle Festlegungen auf Papier.
Diese letzteren Argumente kann man aber nicht völlig unwidersprochen lassen. Zunächst muß einmal darauf hingewiesen werden, daß die Federalists sich selbst widersprechen. So betonen sie einerseits, in der Verfassung seien ohnehin gewisse Grundrechte festgelegt, andererseits betonen sie die Nutzlosigkeit eines Grundrechtskatalogs. Der Federal Farmer hat zudem darauf hingewiesen, daß es keineswegs eine ausgemachte Sache ist, daß sich das Volk alle Rechte vorbehält, die es nicht ausdrücklich überträgt. Er verweist auf Autoren die genau das Gegenteil behaupten, nämlich, daß das Volk alle Rechte überträgt, die es sich nicht ausdrücklich vorbehält. Wer von beiden aber auch immer objektiv im Recht sei, meint er, die Politiker werden sich immer auf jene Theorien berufen, die ihnen gerade nützlich und zweckmäßig erscheinen.
Und wenn man kein Vertrauen in Verfassungsbestimmungen hat und daran zweifelt ob sie in der Praxis umgesetzt werden - warum schreibt man dann überhaupt eine Verfassung? Soviel zu dem Argument, man brauche die Pressefreiheit nicht in der Verfassung festlegen, weil eine diesbezügliche Festlegung sie nur unzureichend schützt! Warum legt man aber dann andere Dinge in der Verfassung fest, wie zum Beispiel die Garantie der republikanischen Regierungsform (Artikel 4, Abschnitt 4)? Man kann das Wort "Republik" genauso gut oder schlecht definieren wie das Wort "Pressefreiheit"! Und wer garantiert, daß diese Verfassungsbestimmung oder überhaupt irgendeine eingehalten wird? Ich bin der Ansicht, daß es sehr wohl nützlich ist, wenn man sich auf Verfassungsbestimmungen berufen kann. Und warum sonst hätten sich die Federalists nach Annahme der Verfassung für einen Grundrechtskatalog stark gemacht, wenn dieser doch angeblich sinnlos sei? Ich unterstelle den Federalists, daß sie im 84.Artikel (nach dem Motto "Der Zweck heiligt die Mittel") die Wahrheit einmal Wahrheit sein ließen, um ihre (an sich gute) Idee einer großen Union durchzusetzen.
Und so kann man diesbezüglich die Meinung von Brutus teilen, der schreibt:
"And hence it was of the highest importance, that the most precise and express declarations and reservations of rights should have been made. (...) Ought not a government, vested with such extensive and indefinite authority, to have been restricted by a declaration of rights? It certainly ought".
| Die kleine Republik |
Viele Anti-Federalists bezweifelten, unter Berufung auf bedeutende Schriftsteller wie z.B. Montesquieu, ob eine Republik in einem so großen Gebiet wie den USA überhaupt funktionieren könne.
Centinel drückt dies so aus: "It is the opinion of the greatest writers, that a very extensive country cannot be governed on democratical principles, on any other plan, than a confederation of a number of small republics, possessing all the powers of internal government, but united in the management of their foreign and general concerns". Brutus argumentiert ähnlich, wenn er meint: "If respect is paid to the opinion of the greatest and wisest men who have ever thought or wrote on the science of government, we shall be constrained to conclude, that a free republic cannot succeed over a country of such immense extent, containing such a number of inhabitants, and these increasing in such rapid progression as that of the whole United States".
Sehr überzeugend legt Madison allerdings im 14.Artikel dar, daß die betreffenden Autoren, die dies meinten, Untertanen von Monarchien waren und daher versuchten, Argumente für diese zu finden; eines sei es gewesen, zu behaupten, Freistaaten könne es nur in kleinen Gebieten geben. Die Federalists betonten außerdem, daß man Demokratien und Republiken nicht verwechseln dürfe; Demokratien lägen vor, wenn sich alle Staatsbürger auf einer Agora oder einem Forum versammeln (wie in der Antike) und in Volksversammlungen Gesetze beschließen.
Dann freilich kann ein solcher Staat nicht sehr groß sein, seine maximale Ausdehnung "ist durch die Entfernung von einem zentralen Ort gegeben, der es auch den entferntesten Bewohnern gerade noch erlaubt, sich, so oft es ihre öffentliche Funktion erfordert, zu versammeln". In einer Republik hingegen wird die Macht von gewählten Volksvertretern ausgeübt; dieser der Antike fremde Repräsentationsgedanke ermögliche auch große Ausdehnungen von freien Staaten. Außerdem mahnen die Federalists, bei allem Respekt vor den alten Autoren müsse man auch bereits sein, neue Wege beschreiten.
So wenig überzeugend die pauschale Ablehnung der großen Republik durch die Anti-Federalists ist (noch dazu aus heutiger Sicht, wo man weiß, daß auch Staaten mit mehreren hundert Millionen Einwohnern ganz gut demokratisch organisiert werden können), so groß wäre der Fehler, ihre Kritik an der Repräsentation, wie sie in der amerikanischen Verfassung vorgesehen war, pauschal von der Hand zu weisen; und diese Repräsentationskritik legte ebenfalls eine kleine Republik nahe.
| Die "fair representation" |
Was die Anti-Federalists an der amerikanischen Bundesverfassung besonders auszusetzen hatten, war, daß sie ihrer Meinung nach eine unzureichende Art der Repräsentation des Volkes festlegte. Den Anti-Federalists schwebte ein anderes Repräsentationskonzept vor, eine "true" oder "fair representation".
Brutus erläutert diese Vorstellung so: "It must then have been intended, that those who are placed instead of the people, should possess their sentiments and feelings, and be governed by their interests, or, in other words, should bear the strongest resemblance of those in whose room they are substituted". Der Federal Farmer meint dasselbe, wenn er sagt: "...a full and equal representation, is that which possesses the same interests, feelings, opinions, and views the people would were they all assembled - a fair representation, therefore, should be so regulated, that every order of men in the community (...) can have a share in it - in order to allow professional men, merchants, traders, farmers, mechanics, etc. to bring a just proportion of their best informed men respectively into the legislature, the representation must be considerably numerous".
Die Vertreter des Volkes sollen also tatsächlich das Volk in seiner Gesamtheit widerspiegeln. Sie sollen sich im selben sozialen Verhältnis zusammensetzen wie das von ihnen vertretene Volk und sollen auch seine Interessen und Gefühle teilen. Nun kann aber das Volk in seiner Vielfalt nicht in einem oder wenigen Männern repräsentiert werden. "One man, or a few man, cannot possibly represent the feelings, opinons and characters of a great multitude". Also ist es unzureichend, wenn z.B. ein großer Staat wie New York zwei Senatoren und sechs Abgeordnete im Repräsentatenhaus zuerkannt bekommt. Denn niemals kann sich die Vielfalt des Volkes von New York in so wenigen Vertretern widerspiegeln - weder in zwei, noch in sechs. Das Prinzip der "fair representation" legt also eine kleine Republik nahe; denn es ist in einer großen Union nicht wirklich möglich, jedem Einzelstaat ein paar hundert Vertreter in den gemeinsamen Gremien zu geben.
Ein weiterer Kritikpunkt ist der Anti-Federalists, der eng mit dem vorigen zusammenhängt, war folgender: Damit das Vertrauen in ein politisches System wächst, sollte ein persönlicher Kontakt zwischen dem Volk und seinen Vertretern bestehen. Besteht dieser nicht, wird das System unpersönlich und wird als volksfern empfunden. Wenn nun ein riesiger Staat wie New York von nur zwei Senatoren vertreten wird, ist es fast unmöglich, daß der kleinen Mann von der Straße mit diesen in regelmäßig Kontakt treten kann. Man wird den Eindruck nicht los, daß das Ideal der Anti-Federalists eine kleine Dorfgemeinschaft mit einem oder mehreren lokalen Politikern ist; wenn man ein Problem hat, besucht man ihn als Nachbar, trinkt ein Bier mit ihm und redet einfach mit ihm darüber. Mit den beiden Senatoren von New York würde das schwer gehen; ich kann mir nicht vorstellen, daß man als einfacher Wähler zu ihnen formlos auf ein Bier vorbeikommen kann. Für die Anti-Federalists wäre ein lokales Politikmodell auch insoferne wünschenswert, weil man sich dann ein persönliches Bild von "seinem" Politiker machen kann. Man kann im persönlichen Gespräch seinen Charakter kennenlernen, seine Vorlieben, seine wahren Meinungen. Daß man sich aus den Massenmedien ein ähnlich gutes Bild machen kann, würden die Anti-Federalists wohl bezweifeln.
Brutus beschreibt das von mir gerade skizzierte Problem so: "A farther objection against the feebleness of the representation is, that it will not possess the confidence of the people. (...) it is impossible the people of of the United States should have sufficient knowledge of their representatives, when the numbers are so few (...). The people of this state will have very little acquaintance with those who may be chosen to represent them; a great part of them will, probably, not know the characters of their own members, much less that of a majority of those who will compose the foederal assembly; they will consist of men, whose names they have never heard, and whose talents and regard for the public good, they are total strangers to; and they will have no persons so immediately of their choice so near them, of their neighbours and of their own rank in life, that they can feel themselves secure in trusting their interests in their hands".
Kein gutes Haar lassen die Anti-Federalists an der Sklavenrepräsentation. Bei der ganzen Sklavenproblematik fällt auf, daß die Anti-Federalists in der Regel starke Gegner der Sklaverei waren. Was die Anti-Federalist auch schon zur Zeit der Gründung der amerikanischen Union erkannten, war, daß es zwischen dem Norden und dem Süden der USA fundamentale Auffassungsunterschiede in Hinblick auf die Sklaverei gab. Die Federalists, so scheint es mir, waren sehr stark bereit, diese Differenzen absichtlich hinunterzuspielen. Die Meinungsverschiedenheiten sollten dem höheren Ziel, der Schaffung der Union, untergeordnet werden. Eine solche moralische Verfehlung wie die Haltung von Sklaven aber unter den Teppich zu kehren, um andere politische Ziele nicht zu gefährden, erscheint aus heutiger Sicht als intellektuelle Prostitution. Heute wäre ein solches Verhalten ungefähr vergleichbar mit dem Schweigen vieler westliche Staatsoberhäupter über chinesische Menschenrechtsverletzungen mit dem Ziel, lukrative Wirtschaftsaufträge von der Großmacht China zu erlangen.
Die Anti-Federalists legten natürlich ihren Finger in diese Wunde. Und wiesen schonungslos auf jedes moralisch bedenkliche Entgegenkommen an die Südstaaten hin, so etwa auf den Abschnitt 9 des ersten Artikels der Bundesverfassung, der dem Kongreß bis zum Jahr 1808 (aus damaliger Sicht also mehrere Jahrzehnte lang) untersagte, die Einfuhr von Sklaven zu verbieten. Aber besonders heftige Worte fanden Anti-Federalists für die "Sklavenrepräsentation": Bei der Festlegung der Zahl der Repräsentanten in den Bundesgremien wurde nicht die Zahl der Wahlberechtigten oder die der freien Wohnbevölkerung zugrundegelegt, sondern die Sklaven wurden auch mitgezählt (jeder Sklave als drei Fünftel eines Freien). Das bedeutete natürlich, daß die Südstaaten mehr Vertreter in den Bundesgremien bekamen. Und umso mehr Vertreter, je mehr Sklaven sie einführten; man erlaubte ihnen also nicht nur den menschenunwürdigen Raub von Sklaven, sondern belohnte sie sogar noch dafür, indem man ihnen für jeden geraubten Sklaven mehr Einfluß in Bundesgremien gewährte.
Brutus sagt - in seinem schönen, altmodischen Englisch des 18.Jahrhundert - zu dieser Situation der Sklaven: "If they have no share in the government, why is the number of members in the assembly, to be increased on their account? Is it because in some of the states, a considerable part of the property of the inhabitants consists in a number of their fellow men, who are held in bondage, in defiance of every idea of benevolence, justice, and religion, and contrary to all principles of liberty, which have been publickly avowed in the late glorious revolution? If this be a just ground for representation, the horses in some of the states, and the oxens in others, ought to be represented - for a great share of property in some of them, consists in these animals; and they have as much controul over their own actions, as these poor and unhappy creatures (...) By this mode of aportionment, the representatives of the different parts of the union, will be extremely unequal; in some of the southern states, the slaves are nearly equal in number to the free men; and for all these slaves, they will be entitled to a proportionate share in the legislature - this will give them an unreasonable weight in the government (...) What adds to the evil is, that these states are to be permitted to continue the inhuman traffic of importing slaves, until the year 1808 - and for every cargo of these unhappy people, which unfeeling, unprincipled, barbarous, and avaricious wretches, may tear from their country, friends and tender connections, and bring into those states, they are to be rewarded by having an increase of members in the general assembly".
Was entgegneten die Federalist auf diese Einwände? Zunächst einmal muß gesagt werden, daß sich die Federalists bei den Repräsentationsargumenten in einer schwierigen Position befinden. Vor allem die oben ausgeführte Praxis der Sklavenrepräsentation ist wirklich offenkundig unfair und bedenklich. Das ist den Federalists wohl auch so erschienen, denn die Argumente für die diesbezüglichen Verfassungsregelungen trägt Madison im 54.Artikel der Federalist Papers nicht in eigenem Namen vor, sondern legt sie in den Mund eines fiktiven Südstaatlers. Durch diesen literarischen Kunstgriff zeigt er eigentlich mehr als deutlich, daß er sich von diesen Positionen distanziert, zumal er sie im Anschluß obendrein als "an manchen Stellen etwas weit hergeholt" bezeichnet. Die Argumente sind dann auch wenig überzeugend. Vor allem, weil man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, daß Madison selbst sie nicht glaubt, sondern sie wider besseres Wissen und Gewissen vorträgt. Es heißt, es sei richtig, Sklaven zwar einerseits als Einwohner zu zählen und Repräsentanten entsprechend zu verteilen, sie andererseits aber als Eigentum zu betrachten und entsprechend zu besteuern. Denn dies sei ihr Wesen: Sie seien teilweise Personen, teilweise Eigentum. Die Verfassung käme diesem Mischcharakter mit ihren Regelungen auf gerechte Art entgegen. Auch daß ein Sklaven nur zu drei Fünfteln mitgezählt wird, sei gerecht, denn: "Der Fall der Sklaven sollte als das betrachtet werden, was er in Wahrheit ist, als ein eigenartiger. Die Kompromißlösung der Verfassung sollte gegenseitig akzeptiert werden; sie behandelt die Sklaven als Einwohner, die jedoch durch die Sklaverei unter den gleichen Rang freier Einwohner abgesunken sind; sie betrachtet daher einen Sklaven als um zwei Fünftel seines Menschseins beraubt". Etwas ehrlicher mutet folgendes Argument an: "Hätte man vernünftigerweise annehmen können, die Südstaaten würden einem System zustimmen, das ihre Sklaven dann partiell als Menschen behandelt, wenn die Lasten verteilt werden, sich aber weigert, sie auch dann als solche anzusehen, wenn sich daraus Vorteile ergeben?". Es ging also letztlich darum, die Zustimmung der Südstaaten zur Verfassung zu erreichen; somit wird Madisons Vorgangsweise verständlich.
Die Federalists nennen in einigen Artikel wichtige Argumente für die Vorteile von kleinen Versammlungen. Nicht das schlechteste stammt von Hamilton, es ist sehr pragmatisch. Er meint sinngemäß, es sei einfach unzweckmäßig, jeder wirtschaftlichen oder sozialen Interessensgruppe einen Platz in der bundesweiten Repräsentation einzuräumen, weil diese dann einfach viel zu groß wird, um arbeitsfähig zu sein. "Eine Volksvertretung müßte um ein Vielfaches größer sein, als mit jedem Konzept von geordneten und fruchtbaren Debatten vereinbar ist, um dem erwähnten Einwand Rechnung zu tragen", formuliert er im 36.Artikel. Den Schluß, daß man eben deshalb eine so große Union nicht gründen dürfe, sondern man sich mit kleineren Einheiten begnügen sollte (so verstehe ich z.B. den Federal Farmer), zieht er freilich daraus nicht.
Ein weiteres Argument gegen eine zu große Legislative nennt Madison im 55.Artikel. "Nichts könnte verkehrter sein, als unsere politischen Überlegungen auf arithmetischen Grundsätzen aufzubauen. Sechzig oder siebzig Männern kann man ein bestimmtes Maß an Macht besser anvertrauen, als sechs oder sieben. Doch daraus folgt nicht, daß die Macht bei sechs- oder siebenhundert Abgeordneten proportional besser aufgehoben ist. Und wenn wir unsere Hypothese auf sechs- oder siebentausend verlängern, so verkehrt sich die Argumentation in ihr Gegenteil". Diese Argumentation besagt aber auch wieder nur, daß die Bundesgremien aufgrund der sonst fehlenden Arbeitsfähigkeit nicht zu groß sein dürfen. In gewisser Weise wird damit Anti-Federalists begegnet, die etwa vor zu kleinen Abgeordnetenhäusern aufgrund deren angeblich größerer Bestechlichkeit warnen, weil anderweitige Vorteile kleiner Gremien in Rechnung gestellt wird. Den Vorwurf der Bestechlichkeit kleiner Legislativen weisen die Federalists übrigens zurück. Der Kontinentalkongreß, argumentieren sie, war auch ein kleines Gremium und nicht bestechlich.
Aber auf die grundlegende Kritik der Anti-Federalists sind diese Argumente trotzdem keine befriedigende Antwort, ebensowenig wie ein weiterer im übrigen vollkommen richtiger Gesichtspunkt, den Madison im 58.Artikel noch ins Treffen führt: "In allen gesetzgebenden Körperschaften werden umso weniger Männer tatsächlich die Debatten leiten je größer die Zahl ihrer Mitglieder ist. Erstens, je größer eine gesetzgebende Körperschaft ist, ganz gleich aus welchen Persönlichkeiten sie sich zusammensetzt, desto stärker setzt sich die Leidenschaft gegen die Vernunft durch. Zweitens, je größer die Zahl, desto größer wird auch die Zahl der Abgeordneten mit begrenztem Wissen und geringen Fähigkeiten sein. Und gerade bei Menschen dieses Schlages entwickeln Beredsamkeit und Geschick der Wenigen bekanntermaßen ihre volle Stärke. In den Republiken der Antike, wo sich das ganze Volk persönlich versammelte, konnte man gemeinhin beobachten, wie ein einzelner Redner oder ein geschickter Staatsmann mit ebenso umfassender Macht herrschte, als habe man ihm ganz allein das Zepter übergeben". Um eine Versammlung vor Demagogen zu schützen, sollte sie also auch eher klein sein. Nun ist dies aber trotzdem eine Ablenkung von der Diskussion, weil nicht behauptet wird, daß riesenhafte Legislativen des Bundes gut wären, sondern daß der Bund eben schlecht ist, weil er zu große Legislativen nahelegt, wenn man sie fair einrichtet.
Zielführender erscheint aber folgendes Argument, das die Federalists im 56.Artikel anführen: Auch wenige Abgeordnete können ein Wissen um die Interessen und Lebensumstände ihrer Wähler erwerben und sie daher angemessen vertreten. Die Anti-Federalists würden darauf wahrscheinlich entgegnen, das abstrakte Wissen um den Willen eines anderen garantiert nicht, daß man seinen Willen vollstreckt. Es geht vielmehr darum, von den gleichen Gefühlen geleitet zu sein; und das garantiere nur die "fair representation".
Die Federalists grob vereinfacht: Wir wollen die Union aus diesen und jenen Gründen; in einer großen Union, sagen sie, kann aber aus pragmatischen Gründen nicht jede Bevölkerungsgruppe in den gesetzgebenden Gremien vertreten sein, weil diese sonst zu groß werden; also kann es nicht eine Vertretung jeder Gruppe geben. Darüberhinaus sei letztere gar nicht nötig; eine Repräsentation könne fair sein, ohne daß jede soziale Gruppe in ihr vertreten sei. Die Anti-Federalists sagen: Wenn nicht alle vertreten sein können, darf es eben keine Union geben. Es werden unterschiedliche Prioritäten gesetzt und unterschiedliche Schlüsse gezogen.
Was die Anti-Federalists entdeckt haben, ist meiner Meinung nach das, was Hans Kelsen einst als "Repräsentationsfiktion" bezeichnete: der bewiesene Umstand nämlich, daß Parlamente oft anders entscheiden als das Volk in derselben Frage entscheiden würde. Wie kann dies aber sein, wo doch das Parlament das Volk angeblich repräsentiert? Die Anti-Federalists versuchten dieser Repräsentationsfiktion entgegenzusteuern, indem sie forderten, das Parlament solle in sozialer Hinsicht genauso zusammengesetzt sein wie die Bevölkerung, damit dieselben Gefühle und Interessen es leiten. Die Federalists waren bereit, diese Repräsentationsfiktion in Kauf zu nehmen oder in Abrede zu stellen, um eine handlungsfähige amerikanische Union zu schaffen.
| Unzulässige Entmachtung der Einzelstaaten |
| "necessary and proper"- und "supremacy"- Klauseln / Bedenkliche Steuerkompetenz der Union |
Die Anti-Federalists kritisierten zwei Klauseln der Bundesverfassung mit besonderem Nachdruck, nämlich die sogenannte "necessary and proper" und die sogenannte "supremacy"-Klausel. Diese besagen:
Der Kongreß ist befugt, "alle für die Durchführung der vorstehenden Kompetenzen und aller anderen Befugnisse, die den Vereinigten Staaten, einem ihrer Verfassungsorgane oder einem ihrer Amtsträger aufgrund der Verfassung übertragen sind, notwenigen und angemessenen (necessary and proper) Gesetze zu erlassen".
"Diese Verfassung und alle auf ihrer Grundlage erlassenen Gesetze der Vereinigten Staaten, sowie alle im Namen der Vereinigten Staaten geschlossenen oder zukünftig abzuschließenden Verträge sind das höchste Recht des Landes (the supreme Law of the Land), und daran sind die Richter in jedem Einzelstaat ungeachtet entgegenstehender Verfassungs- oder Gesetzesbestimmungen eines Staates gebunden".
Die Anti-Federalists sahen darin zwei viel zu allgemein formulierte Bestimmungen, die in Verbindung mit anderen Kompetenzen die Macht der Einzelstaaten völlig aushöhlen könnten. "A power to make all laws, which shall be necessary and proper, for carrying into execution, all powers vested by the constitution in the government of the United States (...) is a power very comprehensive and definite, and may, for ought I know, be exercised in such a manner as entirely to abolish the state legislatures", meint Brutus. Und er nennt ein hypothetisches Beispiel: Was ist, wenn die Legislative eines Einzelstaates eine Steuer einhebt, der Kongreß aber diese Steuer aufhebt, weil er es "necessary and proper" für die Erfüllung seiner zahlreichen Kompetenzen findet, wenn diese Steuer nicht existiert; ein solches Gesetz, meint Brutus, wäre dann "supreme Law of the Land" und könne vom Einzelstaat nicht aufgehoben werden. Nun verhält es sich aber so, daß gerade die Steuerbefugnisse die wichtigsten sind, die man einer politischen Einheit geben kann. Brutus meint: "It is proper here to remark, that the authority to lay and collect taxes is the most important of any power that can be granted". Und an anderer Stelle fährt er fort: "The command of the revenues of a state gives the command of every thing in it. - He that has the purse will have the sword, and they that have both, have every thing". Nun besitze aber die Bundesregierung alles Geld, die Einzelstaaten seien aber in ihrer Steuergesetzgebung vom guten Willen des Bundes abhängig. Dadurch seien die Einzelstaaten aber de facto machtlos, "for a government without the power to raise money is only one in name". Die Federalists insistieren, daß eine solche Auslegung der Verfassung hinsichtlich Steuergesetzgebung nicht zulässig wäre. Sowohl die Suprematie, als auch die Angemessenheits-Klausel, seien nur auf Gesetze beschränkt, die gemäß der Verfassung zustandegekommen sind. Die Aufhebung einer Einzelstaatssteuer wäre aber ein Anmaßung, die von der Verfassung nicht gedeckt ist.
Beide kritisierten Klauseln, argumentieren die Federalists zudem plausibel in einem ihrer Artikel, liegen in der Natur der Sache; sinngemäß müßten sie sogar eingehalten werden, wenn sie nicht in der Verfassung stünden; aufgenommen hätte man sie nur sicherheitshalber, um Sophisten keinen Spielraum zu geben, die diese Kompetenzen bestreiten. Was wäre eine Verfassung, die nicht höchstes Recht des Landes wäre? Eine, an die sich alle nach Belieben halten können oder auch nicht? Gemeinschaftsrecht, das nicht für alle verbindlich gilt, sondern für das es im Ermessen jedes einzelnen Staates liegt, sich daran zu halten oder auch nicht, ist gar kein Gemeinschaftsrecht, sondern hat höchstens empfehlenden Charakter; in gewisser Weise ist es sogar sinnlos. Wenn man eine gemeinsame Union mit einer gemeinsamen Verfassung und einem Grundstock gemeinsamen Rechts will, dann muß die Verfassung und das auf ihrer Basis erlassene Recht auch für alle gelten und höchstes Recht des Landes sein. Und was die "necessary and proper"-Klausel betrifft: Wenn man dem Kongreß z.B. die Befugnis zugesteht, Steuern einzuheben und Truppen aufzustellen, dann muß man ihm die Befugnis erteilen, notwendige und angemessene Gesetze zur Durchsetzung dieser Kompetenzen erlassen zu dürfen. Was wäre ein Kongreß, der Steuern einheben darf, aber keine Steuergesetze erlassen kann? Der Truppen aufstellen darf ohne Gesetze zur Aufstellung von Truppen zu erlassen? Kurzum, die beiden Klauseln sind nicht unangemessen, sondern liegen in der Natur der Sache.
Den Vorschlag der Anti-Federalists, dem Bund nur Kompetenzen zur Einhebung ganz bestimmter Steuern zu erheben, lehnen die Federalists ab. Sie argumentieren, daß dies einer Grundmaxime vernünftigen politischen Denkens widerspreche, welche lautet: "Eine Regierung sollte alle Kompetenzen besitzen, die zur vollständigen Erreichung der ihr übertragenen Aufgaben nötig sind, und zur vollständigen Durchführung der ihr übertragenen Pflichten, für die sie verantwortlich zeichnet, frei von jeder Kontrolle, außer der Beachtung des öffentlichen Wohls und der Meinung der Bevölkerung". Mit anderen Worten, wenn man einer Institution bestimmte Aufgaben überträgt, muß man ihr auch alle Mittel in die Hand geben, die nötig sind, um die Aufgaben zu erfüllen. Wenn man einer Bundesregierung etwa die Landesverteidigung überträgt, muß man ihr auch genügend Geldmittel zur Verfügung stellen, damit sie diese erfüllen kann. Und da man das Ausmaß künftiger Gefahren nicht voraussehen kann, sind Beschränkungen auf diesem Gebiet nur schädlich. "Die zukünftigen Erfordernisse lassen sich weder berechnen noch begrenzen, und die Kompetenz, auf sie reagieren zu können, wenn sie auftauchen, sollte (...) ebenfalls unbeschränkt bleiben". Als konkretes Beispiel führt Hamilton folgenden Fall an: Angenommen, die USA wären in ihren ersten Krieg verwickelt, und die Gelder würden nicht ausreichen. Woher bekämen sie dann Geld? Die Erfahrungen aus dem Bürgerkrieg hätten gezeigt, daß die Einzelstaaten selbst in höchster Not zahlungssäumig sind. Nun könnte die Union nur mehr Gelder, die nach der Verfassung zu anderem da wären, zweckentfremden und umwidmen. Sieht man von der Illegalität einer solchen Handlung ab, würde die Schwierigkeit der Union, Geld aufzubringen, auch ihre Kreditwürdigkeit ruinieren. Eine moderne Kriegsführung ohne Anleihen sei aber selbst großen Nationen nicht mehr möglich. Daher sollte die Steuerkompetenz unbeschränkt bleiben.
Brutus freilich würde heftig gegen die letztgenannte Argumentation opponieren. Man könne zwar tatsächlich nicht alle zukünftigen Fälle genau voraussehen, allerdings ist es möglich auf der Basis vernünftiger Überlegungen und nach menschlichem Ermessen die Größe und Wahrscheinlichkeit gewisser Gefahren abzuschätzen. Jene einer Invasion hält Brutus für relativ gering. Es gäbe zwar europäische Kolonien in Nordamerika, diese wären aber machtlos ohne Truppen aus Europa, die man erst über den Atlantik schaffen müßte. Dies wäre nur mit massivem Aufwand möglich. Die Indianer sind militärisch dermaßen unterlegen, daß sie zwar Unannehmlichkeiten bereiten können, aber keine ernstzunehmende Gefahr für die Union darstellen. Auf jeden Fall könnte man nach menschlichem Ermessen die wichtigsten Gefahren bestimmen und dem Bund entsprechende ausreichende, aber doch begrenzte Mittel zur Verfügung stellen, um diese zu bekämpfen.
Unbegrenzte Steuerbefugnisse könnten auch mißbraucht werden. Sehr polemisch weist Brutus auf diese Mißbrauchsgefahr hin, wenn er über die unbegrenzte Steuerbefugnis der Union schreibt: "This power, exercised without limitation, will introduce itself into every corner of the city, and country - It will wait upon the ladies at their toilett, and will not leave them in any of their domestic concerns; it will accompany them to the ball, the play and the assembly; it will go with them when they visit, and will, on all occasions, sit beside them in their carriages, nor will it desert them even at church; it will enter the house of every gentleman, watch over his cellar, wait upon his cook in the kitchen, follow the servants into the parlour, preside over the table, and note down all he eats and drinks; it will attend him to his bed-chamber, and watch him while he sleeps; (...) it will watch the merchants in the counting-house, or in his store; it will follow the mechanic, and in his work, and will haunt him in his family, and in his bed; it will be a constant companion of the industrious farmer in all his labour, it will be with him in the house, and in the field, observe the toil of his hands, and the sweat of his brow; it will penetrate into the most obscure cottage; and finally, it will light upon the head of every person in the United States. To all these different classes of people, and in all these circumstances, in which it will attend them, the language in which it will address them, will be GIVE! GIVE!". Es stellt sich die Frage, ob diese Befürchtungen aus heutiger Sicht nicht doch ein wenig übertrieben wirken.
| Angst vor dem stehenden Heer in Friedenzeiten |
Die Anti-Federalists kritisierten, daß die neue Verfassung die Aufstellung stehender Heere in Friedenszeiten nicht verbiete. Die Federalists meinten, ein solches Verbot gäbe es erstens in vielen Einzelstaatsverfassungen auch nicht und es sei zweitens gar nicht praktikabel. Um militärisch gerüstet zu sein, sei ein stehendes Heer auch in Friedenszeiten nötig.
Brutus nimmt insbesonders auf diesen Artikel Bezug und läuft Sturm dagegen. "The power to keep up standing armies in time of peace, has been justly objected, to this system, as dangerous and improvident". Er verweist darauf, daß die europäischen Nationen seiner Zeit durch stehende Heere versklavt werden, daß stehende Heere sich immer als Feinde der Freiheit erwiesen hatten, daß ein Staat, in dem es eine mächtige, bewaffnete Gruppe von Männern gibt, die blind die Befehle der Obrigkeit befolgen, niemals seine Freiheit wird dauerhaft bewahren können.
Der Verweis auf die historischen Beispiele Julius Caesar und Oliver Cromwell fehlen bei den Anti-Federalists nicht. Beide haben mit der Hilfe der Armee die Macht an sich gebracht und eine Diktatur errichtet. Die Anti-Federalists würden auch die von den Federalists dargelegten Schutzmaßnahmen (Kontrollbefugnisse sowohl der Legislative als auch der Exekutive, beschränkte Amtszeiten der die Armee kontrollierenden politischen Instanzen etc.) als nicht ausreichend finden. Sie bezeichnen, so wie Centinel, eine stehende Armee in Friedenszeiten als "that great engine of oppression", deren Existenz allein die Freiheit der Republik bedroht. Mittlerweile sind die Argumente der Anti-Federalists als historisch zu betrachten; denn aus pragmatischen Gründen haben sich weltweit auch in Republiken die stehenden Heere durchgesetzt. Man kann angesichts dieses Zustandes nur hoffen, daß die Anti-Federalists mit ihrer Einschätzung im Unrecht waren.
| Wer bedroht wen? |
Es kann kein Zweifel darin bestehen, daß die Anti-Federalists die sich herausbildende Union - vielleicht nicht zu Unrecht - als übermächtiges Zentrum empfanden, das die Eigenständigkeit der Einzelstaaten bedrohte. In den vorhergehenden Abschnitten ist dies, meine ich, bereits deutlich geworden.
Die Federalists würden - als Antwort auf solche und ähnliche Vorwürfe der Anti-Federalists - genau die umgekehrte Meinung vertreten: Daß nämlich nicht der Bund die Einzelstaaten, sondern vielmehr die Eigensucht der Einzelstaaten die Funktionsfähigkeit des Bundes bedroht. "Bei allen Beispielen antiker und moderner Konföderationen beobachten wir eine äußerst starke Neigung der Mitglieder, die zentrale Regierung ihrer Vollmachten zu berauben, wobei letztere sich meist als sehr schwach und hilflos bei der Abwehr solcher Übergriffe erwies", argumentiert Madison.
Außerdem hätten nach Meinung der Federalists die Einzelstaaten mehr Einfluß auf den Bund, als dieser auf die Einzelstaaten. "Man kann die Regierungssysteme der Einzelstaaten als konstitutive und entscheidende Teile des Regierungssystems des Bundes betrachten, während letzteres in keiner Weise entscheidend für das Funktionieren oder die Organisation ersterer ist".
Die Federalists meinten zudem, so groß seien die Kompetenzen des Bundes gar nicht. "Die dem Bund (...) übertragenen Kompetenzen sind wenige und begrenzte; bei den Einzelstaaten verbleiben viele und unbegrenzte. Erstere werden hauptsächlich auf äußere Aufgaben angewandt werden, wie Krieg, Frieden, Verhandlungen und Außenhandel (...) Die den Einzelstaaten verbleibenden Kompetenzen werden sich auf alle Bereiche und Aufgaben des normalen Lebens erstrecken und Leben, Freiheit und Eigentum des Volkes betreffen, sowie die innere Ordnung, Reform und den Wohlstand des Einzelstaates". Die Tätigkeit des Bundes, meinten sie, werde in Zeiten von Krieg und Bedrohung am umfangreichsten und wichtigsten sein, die der Einzelstaaten in Zeiten von Frieden und Sicherheit. Man kann nicht umhin, diesen Hinweis als etwas heuchlerisch zu betrachten. Hamilton nennt im 23.Artikel als die vier Hauptaufgaben des Bundes: Landesverteidigung, Bewahrung des inneren Friedens, Regulierung des Handels und Außenpolitik. Gemeinsam mit der umfassenden Steuerkompetenz sind das ohnehin die wichtigsten Kompetenzen, die ein Staat haben kann. Was bleibt dann eigentlich noch für die Einzelstaaten übrig? Vielleicht, wie ein Anti-Federalist pointiert argumentiert hat, das Recht, den Menschen zu sagen, in welcher Farbe sie ihren Gartenzaun streichen können? Die Federalists sind im Recht, wenn sie darauf hinweisen, daß die Kompetenzen des Bundes taxativ aufgezählt sind und der gesamte Rest bei den Einzelstaaten verbleibt. Es sind nur so wesentliche Kompetenzen in der Verfassung aufgezählt, daß kaum mehr etwas übrigbleibt..
Sollte es dennoch gar zu einem bewaffneten Konflikt zwischen Bund und Einzelstaaten oder zu unrechtmäßigen Übergriffen und Kompetenzanmaßungen des Bundes kommen, hätten nach Meinung der Federalists die Einzelstaaten die besseren Chancen auf Sieg. Denn diese genießen nach Meinung der Federalists mehr Loyalität der Bürger als die Union. "Viele Überlegungen (...) räumen anscheinend jeden Zweifel daran aus, daß die erste und natürlichste Bindung des Volkes den Verfassungsorganen ihres jeweiligen Einzelstaates gilt". Aus diesem Grund, aber auch deshalb, weil die Einzelstaaten gemeinsam stärker seien als der Bund, könnten sie Übergriffe von Bundespolitikern leicht abwehren: "..., und ihre Ursurpationspläne werden leicht von den Einzelstaaten vereitelt werden, die dabei vom Volk unterstützt werden". Eine Putschgefahr bestünde von Seiten des Bundes also nicht. Die Frage der Anti-Federalists wäre in diesem Zusammenhang wahrscheinlich, ob ein mit solchen Vollmachten ausgestatteter Bund es überhaupt nötig hätte, zu putschen.
Ein weiterer Gesichtspunkt, den die Federalists als wirklichen oder vermeintlichen Beweis dafür anführen, daß die Einzelstaaten das Wohl der Union bedrohen und nicht umgekehrt, ist ihre Ansicht, daß die Politiker der Einzelstaaten das Wohl der Gesamtheit oft ihrem Lokalpatriotismus und engen Gesichtskreis opfern - das Umgekehrte käme allerdings leider seltener vor.
"Nur allzu häufig werden Maßnahmen aufgrund ihrer wahrscheinlichen Wirkung entschieden werden, nicht für Wohlstand und Glück und Wohlergehen der Nation, sondern in Hinblick auf Vorurteile, Interessen und Projekte von Regierung und Volk des jeweiligen Einzelstaates. (...) Wenn ein einziges Mal zu Unrecht lokale Erwägungen dem Machtzuwachs des Bundes geopfert wurden, dann haben die großen Interessen der Nation hundertmal durch die ungebührliche Beachtung lokaler Vorurteile, Interessen und Absichten bestimmter Staaten gelitten". Die Frage, die sich hier stellt, ist nur, ob man legitime Interessen der Staaten unter Berufung auf ein sogenanntes "Gesamtwohl" unterdrücken darf. Das Wohl der Gesamtheit ist doch letztlich die Summe der Einzelinteressen. Und wer kann bestimmen, gesetzt, es gibt ein "Gesamtwohl", was dieses genau ist? Wieviele Despoten haben sich schon angemaßt, einzig und allein dieses zu vertreten, während sie unterdrückerische Maßnahmen setzten? Es stellt sich auch die Frage, ob die Federalists fair sind, wenn sie in der Diskussion implizieren, die wahren Vertreter des Gesamtwohls zu sein.
| Abschließende Bemerkungen zum Werte der Souveränität |
Die Anti-Federalists sahen die Souveränität und Eigenständigkeit der Einzelstaaten bedroht und bezogen daraus ihre Legitimation, gegen die Union aufzutreten. Die Federalists hingegen stellen die kritische und zugleich mutige Frage, inwieweit eine solche Souveränität denn erstrebenswert sei. Im 45.Artikel vertritt Madison die Meinung, daß die Souveränität der Einzelstaaten kein Wert an sich sei; das höchste Ziel politischen Handelns sei vielmehr "the public happiness". Es sei daher für die Diskussion unwesentlich, ob die Einzelstaaten ihre Souveränität verlieren oder nicht. Vielmehr kommt es darauf an, zu beurteilen, was mehr zu Glück und Wohlfahrt des Volkes beiträgt: Die Souveränität des Einzelstaates oder eine starke Union; und Madison läßt keinen Zweifel daran, daß er an die Vorteile des letzteren glaubt. Wenn die Souveränität der Einzelstaaten dem Glück des Volkes aber im Wege steht, besteht kein Zweifel daran, welchem von beiden der Vorzug zu geben ist.
"...wenn, um es mit einem Wort zu sagen, die Union ausschlaggebend für das Glück des amerikanischen Volkes ist, ist es dann eine absurde Kritik an dieser Regierungsform (...) zu sagen, ein solches Regierungssystem könne die Bedeutung der Einzelstaaten schmälern?".
Und er fährt fort: "Ebenso muß sich jeder gute Bürger vernehmen lassen, wann immer die Souveränität der Einzelstaaten nicht mit dem Glück und Wohlergehen des Volkes in Einklang gebracht werden kann: ‘Ersteres muß letzterem geopfert werden!’ " (Art.45, S.279).
Wie immer man zum Verhältnis von Union und Einzelstaat stehen mag und wem von beiden man die größere Macht einzuräumen bereit ist: Auch die Gegner einer Union - und hier ist den Federalists zuzustimmen - müssen einsehen, daß die einzig zulässige Diskussion über Vorteile und Nachteile einer starken Union das Wohl des Volkes als seinen Maßstab zu akzeptieren hat. Begründet man seine Ablehnung einer Union mit dem Argument, durch sie sei die Souveränität eines Staates gefährdet, besagt dies allein noch gar nichts, wenn man nicht gleichzeitig beweist, daß die Souveränität dem Volk Vorteile bringt. Denn die Souveränität ist, wenn sie überhaupt zu etwas gut ist, nur ein Vehikel zur Erreichung anderer Ziele, nicht ein absoluter Wert, der in sich selbst begründet ist und keiner weiteren Begründung bedarf. Wer gegen eine Union zu Felde zieht, muß sich also schon stärkere Argumente einfallen lassen als die Bewahrung von vermeintlichen Werten, die in der modernen Welt möglicherweise gar keinen Platz mehr haben. Es kann aber nicht geleugnet werden, daß die Anti-Federalists manche solcher starken Argumente gefunden haben.
Gedanken zur Übertragung einiger Argumente auf den Europäischen Integrationsprozeß
Ich möchte diese Arbeit nicht abschließen, ohne zu versuchen, gewisse Parallelen der zuvor skizzierten Debatte zur Europäischen Union zu ziehen. Ich möchte betonen, daß gerade in diesem Kapitel meine persönliche Einschätzung gewisser politischer Sachverhalte stärker zum Ausdruck kommt als in den vorangegangen Abschnitten, wo ich lediglich einen Diskurs anderer skizzierte. Gerade das halte ich aber für eine Herausforderung.
Es ist offenkundig, daß viele Aspekte der damaligen Diskussion eindeutig nicht auf den Europäischen Integrationsprozeß übertragbar sind. So gibt es zum Glück keine Sklaverei in Europa und entsprechend spielt auch die Frage keine Rolle, ob Sklaven als Einwohner bei der Festlegung von Sitzen in Repräsentationsgremien mitgezählt werden sollen oder nicht. Über mögliche negative Auswirkungen eines stehenden Heeres wird, so ist mein Eindruck, eigentlich auch kaum mehr nachgedacht; man kann diese Debatte (leider?) als überholt bezeichnen. Trotzdem gibt es Punkte, über die man in Hinblick auf die EU diskutieren kann.
Zu den Argumenten der Federalists: Die amerikanische Bevölkerung wird von Jay zurecht als ein Volk dargestellt mit einer gemeinsamen Sprache (was Jay nicht als einziges, aber doch wesentliches Kriterium einer Nation nennt). Obwohl diese Gemeinsamkeit aufgrund der gegenwärtig doch steigenden nicht-europäischen Einwanderung in die USA und der tendentiell nachlassenden Assimilationsbereitschaft der neuen Einwanderer im Rückgang ist, kann man von den USA im Gegensatz zu Europa noch immer von einem sprachlich relativ homogenen Gebiet sprechen. Von Europa kann man dies nicht behaupten. Ein Charakteristikum des europäischen Kontinents ist vielmehr, daß dort auf einem relativ engen Raum eine große Vielzahl verschiedener Sprachen existiert. Die gegenwärtige EU mit ihren 15 Mitgliedsländern kennt allein 11 Amtssprachen; und diese Zahl wird sich bei der bevorstehenden Osterweiterung sicherlich wesentlich vergrößern. Eine Sprachnation ist Europa also sicherlich nicht. Obwohl es auch andere Nationsbegriffe gibt und ich nicht ausschließen will, daß eines Tages auf Basis eines speziellen, modifizierten Nationsbegriff eine Art europäisches Nationalgefühl entsteht, meine ich, daß der Begriff Nation in Europa noch immer sehr eng mit den Einzelstaaten verknüpft ist; entsprechend sind die am heftigsten an nationalistische Gefühle appellierenden Politiker erfahrungsgemäß auch die größten Gegner der Union.
Nationalistische Argumente zur Rechtfertigung einer politischen Einheit (egal, welchen Nationsbegriff man zugrunde legt), scheinen uns Europäern auch heutzutage mehr als zweifelhaft. Die Gründerväter konnten mit wesentlich mehr erfrischender Naivität zu Werke gehen. Aber gerade in Mitteleuropa haben wir die historische Erfahrung gemacht, daß mit nationalistischen Parolen ganze Völker verhetzt werden können. So schreibt auch Karl Popper, dessen Buch von der offenen Gesellschaft maßgeblich für unser heutiges Demokratieverständnis ist: "Das Prinzip des Nationalstaates, das heißt die politische Forderung, daß das Territorium jedes Staates mit dem von einer Nation bewohnten Territorium zusammenfallen solle, ist durchaus nicht so einleuchtend, wie es vielen Menschen heute erscheinen mag. Selbst wenn man den Begriff der Nation genauer umschreiben könnte, wäre es doch noch lange nicht klar, warum gerade die Nationalität eine fundamentale politische Kategorie sein soll, eine Kategorie, die wichtiger ist als zum Beispiel die Religion oder die Geburt innerhalb eines bestimmten geographischen Gebietes oder die Loyalität zu einer Dynastie, oder als ein politisches Bekenntnis, wie das der Demokratie". Entsprechend wenig überzeugend erscheinen uns auch Konzepte, die eine ethnische Einheit beschwören, wie dies auch Jay tut, wenn er von der gemeinsamen Abstammung der Amerikaner spricht.
Am ehesten auf die Europäische Union übertragbar ist Jays Konzept von den gemeinsamen Werten. Politiker aller Couleur sind sich darüber einig, daß die Europäische Union auf gewissen allgemeinen anerkannten Wertsystemen beruht, wozu unter anderem gehören: Demokratie, Menschenrechte, Herrschaft der Gesetze, Friede, etc. Dazu kommt noch die Marktwirtschaft als allgemein anerkannte Wirtschaftsform. Die Europäische Union erscheint in dieser Hinsicht als eine Wertegemeinschaft - was unter Umständen identitätsstiftend wirken kann. Ich bin mir nicht sicher, ob man schon von einem europäischen Patriotismus sprechen kann; wenn, dann ist es meiner Einschätzung nach eher ein zartes Pflänzchen, das eben erst aufzublühen beginnt. Was mir an Europa im Unterschied zu den USA auffällt, ist, daß ein gemeinsames großes Ereignis fehlt, in dem gemeinsam ein großer, identitätsstiftender Sieg errungen wurde, z.B. vergleichbar mit dem Sieg im Unabhängigkeitskrieg, auf den sich die Federalists immer wieder berufen. Allenfalls wird in Diskussionen auf die gemeinsamen leidvollen Erfahrungen des 2.Weltkriegs verwiesen. Aber tatsächliche gemeinsame nationale, symbolische Ereignisse scheinen noch zu fehlen. Vielleicht wird es eine Aufgabe der Zukunft zu sein, solche Symbole zu schaffen.
Wir leben wahrscheinlich in einem zu nüchternen und abgeklärten Zeitalter, als daß wir dem Argument einer "Vorsehung", die das vereinte Europa wollte, Glauben schenken könnten. Jay, der eine solche Vorsehung für Amerika annahm, lebte in einer erfrischend naiven Zeit, die nicht so wie die unsere vom Skeptizismus übersäuert war (ich spreche hier übrigens als Skeptiker, der sogar den Skeptizismus bezweifelt). Trotz dieses sympathischen Zugs der Federalists ist das Argument aus heutiger Sicht unzureichend und unglaubwürdig.
Die Federalist-Argumente hinsichtlich Frieden und Sicherheit sind auf jeden Fall auf die Europäische Union übertragbar. Man darf nicht vergessen, daß die europäischen Nationen jahrhundertelang gegeneinander Krieg führten; daß den Federalists der Hader zwischen den europäischen Staaten zurecht als abschreckendes Beispiel für den nordamerikanischen Kontinent diente und dies eines ihrer Hauptargumente für die Errichtung einer amerikanischen Union war; daß zwei Weltkriege von Europa ausgingen, entsetzlich viel Leid über die Menschen brachten und den ganzen Kontinent schließlich in Schutt und Asche legten. Ein Rückfall in diese Zeiten, in denen Nationalstaaten sich ständig gegenseitig überfielen, ist alles andere als wünschenswert. Die Bewegung der europäischen Integration entstand nach 1945 und war im wahrsten Sinne des Wortes ein Friedensprojekt. Ich erinnere daran, daß die EGKS (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl), die erste der drei Europäischen Gemeinschaften, die heute noch das Fundament der 1.Säule der EU bilden, explizit zum Ziel hatte, eine gemeinsame Kontrolle über diese beiden kriegswichtigen Substanzen zu erzielen, um jeden künftigen Krieg zwischen Deutschland und Frankreich zu verunmöglichen. Die Ansicht, daß die Europäische Union den Frieden auf dem europäischen Kontinent genauso sichern kann wie die USA auf dem amerikanischen, ist durchaus vertretbar.
Ich hatte einige Schwierigkeiten, den Begriff der Faktion nachzuvollziehen, den Madison im 10.Artikel einführt. Es scheint sich um eine radikale politische Bewegung zu handeln, der unter Umständen eine auch große Masse anhängt, die Wahlerfolge verbuchen kann, aber dem Gemeinwohl und den elementaren Rechten mancher Mitbürger schadet. Ich bin mir nicht sicher, ob Madison dies meinte, aber wenn ich diesen Begriff auf das heutige Europa übertrage, fühle ich mich bei dieser Definition in gewisser Weise an die österreichischen Freiheitlichen, aber auch an noch radikalere Bewegungen (wie den Vlaams Blok in Belgien oder die Front National in Frankreich) erinnert. Beim Vlaams Blok wäre der Faktionsbegriff noch am deutlichsten anwendbar. Diese Bewegung ist sehr erfolgreich bei Kommunalwahlen, spielt auch im nationalen Kontext eine Rolle. Ihre umstrittenste Forderung ist die Unabhängigkeit der Flamen von Belgien, also praktisch eine Zerschlagung des belgischen Staates. Hier hätten wir also eine Faktion: Der Vlaams Blok ist auf die Zerstörung des Staates ausgerichtet, rechtsextrem, radikal, möglicherweise gefährlich, bei Wahlen aber durchaus erfolgreich. Wenn Madisons Argument stimmt, daß in großen föderativen Republiken Faktionen leichter unter Kontrolle zu bekommen sind, weil es in diesen so viele unterschiedliche Interessen gibt, daß radikale Faktionen dort nicht aufkommen können, müßte es sich auch so verhalten, daß im Rahmen der EU diese Faktionen keine allzu große Macht besitzen. Dies ist auch offenkundig der Fall; denn Le Pens Truppe oder der Vlaams Blok sind im EU-Rahmen praktisch marginalisiert; man betrachte nur die Sitzverhältnisse im Europäischen Parlament, wo diese im Gegensatz zu den Heimatparlamenten keine Rolle spielen. Und sollte tatsächlich eine rechtsextreme Kraft in eine Regierung kommen und somit auf Institutionen wie den Ministerrat Einfluß nehmen können (wie z.B. die FPÖ), reagiert die EU mit Sanktionen und Druck auf die Staaten, in denen Faktionen um sich gegriffen haben. Das bedeutet aber u.a. auch, daß die Gegner solcher rechtsextremer Bewegungen in ihrem eigenen Interesse umso stärker auf Vertiefung und Erweiterung der Europäischen Union drängen sollen.
Die wirtschaftlichen Vorteile einer großen Union, die auch die Federalists betonen, können von niemandem ernsthaft bestritten werden. Der gemeinsame Binnenmarkt und seine Vorteile, die er dem Handel bringt, sind und bleiben Hauptargumente nicht nur für die amerikanische, sondern auch für die Europäische Union.
Die Argumente der Federalists zur internationalen Bedeutung einer amerikanischen Union kann man sinngemäß auch auf Europa übertragen. Sollte der Europäische Einigungsprozeß gelingen, ist eine neue Weltmacht entstanden. Während sich die Großmächte in einem zersplitterten Europa gegenseitig neutralisieren, ist die Macht Europas beachtlich, wenn diese Kräfte zusammengelegt werden - schon die gegenwärtige EU (2000) ist nicht nur die größte Wirtschaftsmacht der Welt, sondern umfaßt mit 380 Mio. Einwohnern weit mehr Menschen als die USA. Und die Europäische Union ist noch um ein Vielfaches erweiterbar. Vielleicht könnte man ein Buch über den Europäischen Integrationsprozeß ähnlich einleiten wie die amerikanischen Federalists ihren Kommentar zur amerikanischen Verfassung: "Das Thema allein zeugt von seiner Bedeutung; im Ergebnis umfaßt es nicht weniger als die Existenz einer UNION, die Sicherheit und das Wohlergehen der Teile, aus denen sie sich zusammensetzt, das Schicksal eines Imperiums, das in vieler Hinsicht das interessanteste der Welt ist". Daß Europa, wie es vielfach bezeichnet wird, eine "Weltmacht in Wartestellung" ist, wird heute von kaum mehr jemandem bezweifelt - vorausgesetzt, daß die entsprechenden Integrationsbemühungen erfolgreich sind. Die Federalists führten als ein wesentliches Argument für die Wichtigkeit der amerikanischen Union die Selbstbehauptung Amerikas gegenüber den europäischen Mächten an. Können wir an der Schwelle des 21.Jahrhunderts diese Argumentation umdrehen und so eine Rechtfertigung für die Europäischen Union gewinnen?
Zu den Anti-Federalists: Auch in Europa wird heftig über die Einführung einer Art Grundrechtscharta für die Europäische Union debattiert. Ich schließe mich in dieser Frage den Anti-Federalists an und meine, daß eine solche sehr zweckmäßig wäre, nicht zuletzt, weil auch in demokratischen Systemen Machtmißbräuche vorkommen und gewisse in Verfassungen festgeschriebene Rechte mir zweckmäßig erscheinen, um diese zu verhindern. Ich fände es auch bedauerlich, wenn die "Europäische Verfassung", die jetzt zur Diskussion steht, ohne einen Grundrechtskatalog formuliert würde. Nicht nur, daß dieser Umstand Gegnern der Union als Argument gegen den europäischen Integrationsprozeß dienen könnte, die Unionsbürgerschaft könnte auch in den Augen der Menschen aufgewertet werden, wenn mit ihr gewisse grundlegende Rechte verknüpft sind (bis zu einem gewissen Grad ist dies ja bereits der Fall). Eine rein deklaratorische Grundrechtserklärung ohne juristische Verbindlichkeit hielte ich für eine Beleidigung; ich glaube, die Union sollte mehr sein, als ein Verein, der viel sinnloses Papier produziert.
Ich möchte einige Worte zur Größe einer Republik verlieren, weil dies in der zuvor skizzierten Debatte eine große Rolle spielte. Ein direkt-demokratisch organisierter Staat ist notwendigerweise auf kleine räumliche Einheiten begrenzt; dies haben die Federalists deutlich gemacht. Man wird in der heutigen Zeit, weder auf nationaler, noch auf europäischer Ebene, um die Vertretung des Volkes durch gewählte Repräsentanten umhinkommen. Die Anti-Federalists haben hingegen gezeigt, daß dadurch das System notwendigerweise volksferner, unpersönlicher und abstrakter wird - und umso mehr, je größer die politische Einheit ist, die auf diese Art organisiert wird. Denn weder kann in einem riesenhaften politischen Gebilde wie den USA oder auch der EU jede nur denkbare Bevölkerungsgruppe in Repräsentationsgremien vertreten sein, ohne daß diese bis zur Arbeitsunfähigkeit aufgebläht würden, noch kann die persönliche Bekanntschaft des Volkes mit seinen Repräsentanten gewährleistet werden. Ich gestehe, daß ich nicht weiß, wer für mich im österreichischen Nationalrat oder im Europäischen Parlament sitzt. Es würde mich auch sehr wundern, wenn mich der oder die Betreffende empfangen würde, wenn ich ein Problem hätte; soviel Geduld wäre mehr als bewundernswert. Ich glaube auch nicht, daß ich Herrn Prodi, Herrn Solana oder Frau Fontaine anrufen könnte, wenn ich ihnen meine Meinung zur Kenntnis bringen wollte. Die Größe der Europäischen Union, aber eigentlich schon die der Nationalstaaten, führt, wie die Anti-Federalists richtig betonten, dazu, daß das System unpersönlicher wird und es aber dadurch wiederum beim Volk Vertrauen einbüßt. Möglicherweise ist der europaweite Aufstieg und erstaunlich große Erfolg von Demagogen, die die Volksferne der "Politikerkaste" beklagen und den Unmut des Volkes gegen das etablierte System schüren, auch dadurch zu erklären, daß ein Repräsentationssystem in großen politischen Gebilden tatsächlich und notwendig Volksferne zur Folge hat, die durch Fernsehauftritte der Parteiführer nur unzureichend gemildert werden. Das Volk spürt trotzdem ein Defizit.
Ist die Rückkehr zu kleineren Einheiten aber wirklich das beste Konzept, um dieses Problem zu lösen? Oder die Ablehnung der zweifellos vorhandenen Vorteilen einer großräumigen Union? Wie dem auch sei, nach Lektüre der Anti-Federalists ist mir nun klar, warum etwa die Schweiz bisher von einem EU-Beitritt abgesehen hat: Ein direkt-demokratisches System wie das der Schweiz, wo zu fast jeder wichtigen Frage Volksabstimmungen vorgesehen sind, ist in einem Europa mit fast 400 Millionen Einwohnern wenig praktikabel. Die Zugehörigkeit zu einer größeren Einheit erfordert aber teilweisen Verzicht des Volkes auf direkte Mitbestimmung bei wichtigen Gesetzesmaterien. Für manche wiegt dieser Verzicht zu schwer. Aber obwohl dies prinzipiell verständlich ist, wird man angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen und der unbezwingbaren Kräfte der Globalisierung den Eindruck nicht los, daß nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa die Gegner der Union auf der Verliererseite der Geschichte stehen; und was mich betrifft, wünsche ich zu dieser nicht zu gehören.
Literatur
Alexander Hamilton, James Madison, John Jay: Die Federalist-Artikel. Paderborn u.a. 1994.
Frank Pfetsch: Die Europäische Union. Geschichte, Institutionen, Prozesse. München 1997.
Karl Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Tübingen (7.Auflage) 1992.
Herbert J. Storing (Hg.): The Anti-Federalist. Writings by the Opponents of the Constitution. Chicago 1985.
Emmerich Tálos, Gerda Falkner (Hg.): EU-Mitglied Österreich. Gegenwart und Perspektiven: Eine Zwischenbilanz. Wien 1996.
